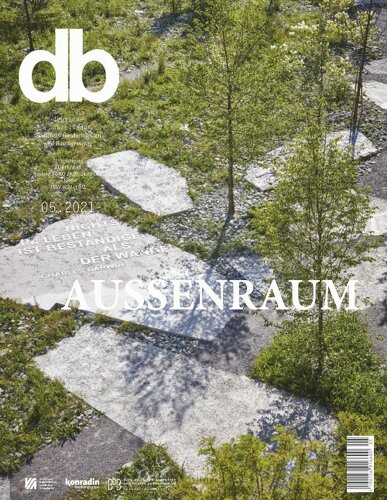Editorial
In Zeiten von Corona finden für selbstverständlich gehaltene Begegnungen sinnvollerweise weitgehend online statt und mangels eines Angebots bleibt man auch ansonsten zu Hause. Dabei wird sich mittlerweile wohl selbst der passionierte Stubenhocker des limitierenden Charakters der eigenen vier Wände schmerzlich bewusst geworden sein. Als einzig vernünftige – da nicht gesundheitsabträgliche – Alternative bietet sich genau genommen nur der aerosolverdünnende Aufenthalt an der frischen Luft an. Auf diese Idee jedoch kommt früher oder später jeder, und so braucht es für all die Spaziergänger, Picknicker, Sporttreibende usw. auch genügend Platz, den Stadtplaner hoffentlich großzügig vorgesehen und Landschaftsplaner sinnvoll gestaltet haben!?
Insbesondere in den Ballungsräumen stehen jedoch immer weniger Freiflächen zur Verfügung. Selbst die letzte bis vor Kurzem noch für unvermarktbar gehaltene Lücke im städtischen Gefüge ist unversehens bebaut. Mancherorts fällt deshalb das Lob auf die bauliche Dichte nicht mehr überschwänglich aus, wie noch vor der Pandemie.
Schon die Nähe – oder im besten Fall der unmittelbare Zugang – zu einer durchgrünten Freifläche in der Stadt ist inzwischen zu einem der wichtigsten Verkaufsargumente auf dem Immobilienmarkt geworden und der lange als zu aufwendig verpönte Planungsansatz, den Außenraum nicht nur zwischen der Bebauung, sondern auch auf ihr konsequent zu erschließen, gewinnt zunehmend an Attraktivität.
Dieser Idee folgend soll im Berliner Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf bis 2023 das Bürogebäude AERA von Bauwens Development entstehen. Grüntuch-Ernst Architekten aus Berlin haben dafür ein Konzept entwickelt, das über einen 480 m langen Weg auf dem kaskadenartig geformten Gebäudevolumen vom umgebenden öffentlichen Park bis hinauf auf das Dach des 8. OGs eine fußläufige Verbindung ermöglicht. Der insgesamt 2 200 m² große Dachgarten, geplant von den Landschaftsarchitekten Capatti Staubach, ebenfalls aus Berlin, soll mit 25 verschiedenen Pflanzenarten und bis zu 12 m hohen Bäumen begrünt werden.
Bei den Projekten in db 05/2021 bleiben wir fürs Erste auf dem »Boden« und unser Blick richtet sich auf einige sehr individuell umgesetzte Außenraumprojekte, die ganz nebenbei auch Abstandsfläche und dadurch wiederum ein großes Stück persönlicher Freiheit bieten. Dass dies ein hohes Gut ist, zeigt sich während der Pandemie besonders deutlich. | Martin Höchst
Wahlkampf mit urbanem Benefit
(SUBTITLE) Außenraumgestaltung »Schwimmende Gärten« an der Kaiserbadschleuse in Wien (A)
Im Rekordtempo wurde an der Kaiserbadschleuse des Donaukanals der öffentliche Freiraum durch die »Schwimmenden Gärten« erweitert. Das Projekt ist nicht nur Resultat eines etwas provinziell wirkenden Wahlkampfs, sondern glücklicherweise auch einer strengen und zugleich überaus erfrischenden Handschrift der Wiener Landschaftsarchitektin Carla Lo. Der urbane Benefit ist enorm.
Ein sonniger Freitag Ende März. Der erste heiße Nachmittag dieses Jahres. Im gefühlt zehnten Corona-Lockdown wird die Kaiserbadschleuse, die bis vor Kurzem ungenutzte Betoninsel im Wiener Donaukanal, von Dutzenden Menschen belagert. Ohne T-Shirt, ohne Schuhe und ohne jede Hast, dafür aber mit dunklen Sonnenbrillen, in denen sich der wolkenblaue Frühlingshimmel spiegelt.
Carla Lo ist eine von ihnen. Die 44-jährige Landschaftsarchitektin, weites Leinenhemd, zerrissene Patchwork-Jeans, liegt inkognito inmitten der sich sonnenden Menge und freut sich über den sozialen Erfolg ihrer »Schwimmenden Gärten«. Nie hätte sie gedacht, dass ihr Büro dieses Projekt eines Tages wirklich realisieren würde, und meint: »Nun sitzen wir da, und ich bin froh darüber, dass dieser städtische Raum von den Wienerinnen und Wienern so gut angenommen wird.«
Angefangen hat alles im Jahr 2016. Kurz vor der Wiener Gemeinderatswahl wünschte sich die damalige Umweltstadträtin Ulli Sima als »Wahlzuckerl« ein paar coole Renderings, die auf stadtromantische Weise darstellen, wie man die Kaiserbadschleuse aus ihrem mehr als 100-jährigen Dornröschenschlaf reißen und endlich einer urbanen Nutzung zuführen könnte. Errichtet wurde das massive Bollwerk mit 125 m Länge und 10 m Breite ursprünglich anstelle des ehemaligen Kaiserbads in den Jahren 1904 bis1908 für die Schiffbarmachung und Regulierung des Donaukanals. In Betrieb genommen wurde die Schleuse, die sich gegenüber von Otto Wagners (1841-1918) berühmtem Schützenhaus befindet, allerdings nie.
»Also haben wir einen Entwurf gemacht und uns überlegt, wie wir die Insel mit Plattformen zugänglich machen und mit Pflanzentrögen und großen Holzdecks zum Sitzen und Liegen aufwerten würden«, erinnert sich Carla Lo. Mit einer Handvoll attraktiv gerenderter Visionen ging die Wiener SPÖ dann tatsächlich ins Rennen. Nach dem Wahlsonntag war dann allerdings jahrelang Funkstille. Das Projekt wurde auf Eis gelegt, bis wenige Monate vor der darauffolgenden Gemeinderatswahl. Aus den Medien erfuhr die Landschaftsarchitektin, dass die Schwimmenden Gärten nun tatsächlich umgesetzt werden sollten. Vom verbindlichen Anruf der Stadträtin bis zur geplanten Fertigstellung blieben wiederum genau sechs Monate. Ein straffer Zeitplan. Damit wurde das fiktive Wahlzuckerl von 2016 zu einem konkreten Wahlversprechen für 2020 aufgewertet.
Am Holzdeck neben uns liegt eine Gruppe Jugendlicher. Ein paar Dosen Bier werden gerade »aufgepoppt«. Es wird gelacht, getrunken, fotografiert. In den Mülleimern nebenan manifestiert sich der hohe Stellenwert des Projekts als buchstäbliche Zufluchtsinsel vor dem Virus und den damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen: Prosecco-Flaschen und Pizzakartons. »Es funktioniert«, sagt die aus Heidelberg stammende Landschaftsarchitektin, die in der Regel v. a. öffentliche und halböffentliche Freiräume im geförderten Wohnungsbau plant. »Mehr kann man sich nicht wünschen, oder?«
Kräftig dimensioniert
Im Zuge der Neugestaltung wurde die denkmalgeschützte Schleuseninsel über zwei breite Brückenbauwerke mit massiven T-Trägern aus Stahlbeton an den Uferweg des Donaukanals angebunden. Die Tragwerksplanung des Wiener Ingenieurbüros Gmeiner Haferl hat es mit der statischen Sicherheit dabei sehr genau genommen und orientiert sich weniger an sommerlicher Leichtigkeit als leider vielmehr an den brutalistischen Dimensionen talüberspannender Autobahnbrücken. Gut, dass sich die Blicke der Flaneure nur selten unterhalb des Wegeniveaus verirren.
Viel ansprechender ist da schon das urbane Leben darüber. Auf beiden Verbindungsplattformen eröffnet sich eine Gehlandschaft aus Beton mit Besenstrich-Oberfläche und daran angrenzenden Holzdecks, die sich mit eckig eingefassten Böschungen zu einer polygonalen Sitz- und Liegelandschaft auf zwei Ebenen hochentwickelt. Die Neigungen mit mal 45°, mal 60° sind ergonomisch gut gewählt, die Sitzhöhen könnten kaum komfortabler sein.
Mit 55 mm Dicke weisen die Eichenbohlen, die auf einer Unterkonstruktion aus Holz und Stahl montiert sind, einen im Zeitalter steigenden ökonomischen Drucks ungewöhnlich hohen Materialeinsatz auf. Dies ist der Langlebigkeit geschuldet: Bei Vandalismus durch Graffiti und motorische Beschädigungen, so der Plan, lässt sich das Holzpodest diverse Male abschleifen und sogar -hobeln.
Auf Kopfhöhe der Sitzenden, Liegenden und Lümmelnden entspinnt sich ein kleiner grüner Dschungel mit heterogener Bepflanzung. 15 verschiedene Pflanzenarten – darunter Gräser, Kräuter und Blumen – werden mit den nun ins Land ziehenden Sommermonaten dank automatischer Bewässerung stattliche Höhen erreichen und prächtige Farben entfalten. Dazwischen tauchen immer wieder mehrstämmige Bäume auf: Wildäpfel, Felsenbirnen und zartrosafarbene Zierkirschen.
Grüner als entworfen
Carla Lo wirkt glücklich. Doch dann verändert sich die Laune ein wenig. In ihrem mitgebrachten Aktenordner finden sich Pläne, die dokumentieren, wie alles hätte aussehen sollen, bevor es so wurde, wie es heute ist. »Meine Vision war, dass wir die Schleuseninsel revitalisieren, sie aber in ihrer archaischen, nutzungsoffenen Erscheinung erhalten«, sagt Lo. Geplant war, die Kaianlage lediglich mit ein paar Ulmen zu bepflanzen und mit schlichten Stahlplatten, die die Kontur der historischen Insel säumen, zu belegen. Die restliche Fläche zwischen den riesigen »Vorlegeplatten« sollte ungeordnet gepflastert werden.
Doch die Wiener Umweltstadträtin wollte es grüner. Mehr Bäume, mehr Grasbeete, mehr bewachsene Pflanzentröge an den Kaimauern. Ein paar Bänke und punktuelle Sitzelemente mussten auch noch her. Und gusseiserne Einfassungen der grünen Grasrabatte, wie sie vom Stadtgartenamt klassischerweise in ganz Wien eingesetzt werden. Und selbstredend Mülleimer sowie gepflasterte Segmentbögen, um noch ein bisschen mehr italienischen Romantizismus hineinzubringen. Und am Ende ist alles so vollgestellt und vollgegrünt und mit notwendigen Verkehrswegen vordefiniert, dass kaum noch Platz bleibt, um in den warmen Sommermonaten irgendwo eine Picknick-Decke auszubreiten.
»Es hört sich eigenartig an, dass ausgerechnet ich als Landschaftsarchitektin so viele Monate gegen Grün gekämpft habe«, erklärt Carla Lo. »Aber tatsächlich ist die zur Verfügung stehende Sitz- und Liegefläche für die Menschen auf ein Minimum geschrumpft. Die alte Schleuseninsel ist nutzungstechnisch bis zum letzten Quadratmeter durchgeplant und durchmöbliert. Innovative Freiraumplanung sieht für mich anders aus.«
Absturzgesichert
Während der gesamte Donaukanal an seinen beiden Uferkanten auf vielen Kilometern Länge ohne Geländer auskommt, mussten die Schwimmenden Gärten rundherum auch noch eingezäunt werden. Der Grund – und damit erreicht der politische Zynismus seinen Höhepunkt: Aufgrund der vielen definierten Sitzelemente sei die Insel keine nutzungsoffene Verkehrsfläche mehr, sondern ein möblierter Stadtplatz, für den man nun entsprechende Absturzsicherungen vorsehen müsse. Glücklicherweise fand sich mit den schlanken Holmen und dem kaum sichtbaren Edelstahl-Netz eine sensible, ortsverträgliche Lösung.
Die Schwimmenden Gärten (Baukosten 3,5 Mio. Euro) sind ein durch und durch politisches Projekt. Sie zeigen auf, wie die Gestaltung öffentlichen Freiraums in dieser Stadt funktioniert. Für die meisten Menschen jedoch sind diese Anekdötchen und Provinzpossen unsichtbar und irrelevant. Übrig bleibt ein Projekt, das trotz aller Querelen und trotz des immensen Zeitdrucks zu den gelungensten und sympathischsten Freiraum-Oasen Wiens zählt. Zu verdanken ist dies wohl der krisenerprobten Handschrift einer Landschaftsarchitektin, die gelernt hat, selbst im geförderten Wohnbau unter enormem Kostendruck überaus passable Freiraumkonzepte zu realisieren.
»Ich glaube, das war die stressigste und zugleich schönste Baustelle meines Lebens«, sagt Carla Lo. „Die Stimmung vor Ort war ausgelassen, und die Brückenbauer, die üblicherweise Autobahnbrücken an irgendwelchen schwer erreichbaren Unorten errichten, haben sich gefreut, dass sich ihr Arbeitsplatz erstmals inmitten der Wiener Innenstadt befindet.« Die Freude am Prozess überträgt sich auf das Resultat. Die Sonne wird immer wärmer. Die Menschen werden mehr. Die Selfies nehmen zu.db, Di., 2021.05.11
11. Mai 2021 Wojciech Czaja
Künstliche Natürlichkeit
(SUBTITLE) Park des Naturmuseums in St. Gallen (CH)
Am Naturmuseum in St. Gallen stellte sich für Robin Winogrond und Studio Vulkan die Herausforderung, einen Park auf einem Autobahndeckel zu gestalten, der sowohl museumsdidaktische Qualitäten aufweist als auch in der heterogenen städtebaulichen Situation verbindend wirkt. Entstanden ist eine anregende künstliche Wildnis, die sich dem Widersprüchlichen der vorgefundenen suburbanen Situation annimmt und auf subtile Weise das Wechselspiel von Künstlichkeit und Natürlichkeit thematisiert.
Die Autobahn A1 durchmisst die Schweiz von Osten nach Westen, von der österreichischen Grenze bei St. Margrethen bis Genf. Seit der Inbetriebnahme des ersten Abschnitts bei Bern 1962 wurde die Trasse sukzessive ausgebaut. Die Stadtautobahn St. Gallen, eröffnet 1987, zählt zu den späteren Teilstücken. Gerade in diesem Bereich gilt die Autobahn als Nadelöhr: Weil sie mitten durch den Ostschweizer Kantonshauptort führt, dient sie nicht nur dem Transit, sondern auch dem innerstädtischen Verkehr. Zwei Tunnel reduzieren das Lärmproblem: Der unter dem Rosenberg wurde in bergmännischem Vortrieb erstellt, während der 570 m lange Stephanshorn-Tunnel sich als überdeckelte Trogstrecke zwischen den Stadtteilen Neudorf und St. Finden erstreckt. Am östlichen Tunnelportal, also dort, wo die Rorschacher Straße die Autobahn kreuzt, hat seit Ende 2016 das Naturmuseum St. Gallen sein neues Domizil gefunden. Die mächtige Kirche St. Maria Neudorf, das zwischen spätem Historismus und Jugendstil oszillierende Hauptwerk des Architekten Adolf Gaudy, bildet bis heute die städtebauliche Dominante dieser Gegend. Als der Kirchenbau 1917 nach dreijähriger Bauzeit geweiht wurde, war er gleichsam ein Versprechen auf weiteres Wachstum der aufgrund des Stickereigewerbes prosperierenden Stadt. Doch lange stand der Bau im Abseits und noch heute steht er etwas verloren da: wenn auch nicht auf weiter Flur, so doch in schütter bebauter Umgebung, die in ihrer heterogenen Struktur alle Merkmale des Suburbanen trägt.
Pendant zur Kirche
Das hat sich nun mit dem Naturmuseum geändert. Die 1846 gegründete Institution war zuvor im innerstädtischen Stadtpark mit dem Kunstmuseum baulich vereinigt. Der Altbau des Museums zeigte sich indes trotz Sanierung 1987 den wachsenden Sammlungen nicht gewachsen. Doch da das Stimmvolk 2003 einen benachbarten Erweiterungsbau des Kunstmuseums ablehnte, musste das Naturmuseum an den Stadtrand umziehen. Im Wettbewerb des Jahres 2009 konnte sich das Gemeinschaftsprojekt der Zürcher Architekturbüros Michael Meier und Marius Hug sowie Armon Semadeni durchsetzen.
Meier Hug und Semadeni haben ein Gebäude realisiert, das sich zunächst der direkten Einordnung entzieht. Kommt man aus Richtung Innenstadt, so steht es – durch eine Freifläche getrennt, unter der hindurch der Autobahntunnel verläuft – hinter der Kirche St. Maria Neudorf, nimmt deren Achse auf – mit anderen Worten: steht parallel zur Straße. Die Grundrissfläche ist ähnlich groß wie jene der Kirche, sodass sich eine gewisse optische Balance ergibt. Fünf parallele Trakte von gleicher Breite mit Satteldächern von gleicher Höhe und den First bekrönenden Oberlichtbändern sind zu einem kompakten Volumen vereint. Aussparungen an den Ecken führen dazu, dass man das Gebäude von keiner Perspektive aus in seiner Gesamtheit überblicken kann.
Die landschaftsarchitektonische Gestaltung der Umgebung war von Anfang an zentraler Bestandteil des Gesamtprojekts. Zum einen, um Kirche und Museum gestalterisch zu verbinden, zum anderen, um die Thematik und Fragestellungen des Naturmuseums auch im Außenraum fortzuführen. Und schließlich ging es darum, eine suburbane, von der Infrastruktur der Autobahn und der verkehrsreichen und lärmintensiven Rorschacher Straße geprägte Situation aufzuwerten, wobei die geringe Überdeckung über dem Autobahntunnel eine besondere Herausforderung darstellte und tiefwurzelnde Pflanzen unmöglich machte.
Vermeintliche Widersprüche
Unbefangen von Natur zu sprechen, mag im Anthropozän ohnehin verfehlt sein. Aber beim Museumspark in St. Gallen handelt es sich um einen in jeder Hinsicht artifiziellen Park. Robin Winogrond und Studio Vulkan haben diese Ausgangssituation, die für die Schweiz durchaus nicht untypisch ist, zum Thema gemacht: Sie sprechen vom Paradoxon der Schweizer Landschaft, von künstlicher Natürlichkeit und natürlicher Künstlichkeit.
Buchenhecken und Hainbuchen umgeben den Park, dazu treten Stauden und Farne – und Hortensien, mithin einheimische und zugleich exotische Pflanzen. Vor dem Haupteingang des Museums stehen zwei Ginkgos, ursprünglich ostasiatische Bäume, die aufgrund ihrer Eigenschaften eher den Nadelbäumen zuzuordnen sind, vielmehr jedoch als Spezies jenseits der Nadel- oder Laubbäume zu verstehen sind. An der östlichen Stirnseite wächst eine Lärche, also jener einheimische Nadelbaum, der – einem Laubbaum vergleichbar – seine Nadeln abwirft. Die Ambivalenz des Bepflanzungskonzepts findet in den übrigen zur Parkgestaltung verwendeten Elementen ihre Fortsetzung. Der typische Ostschweizer Sandstein mit seiner grünlichen Färbung wurde in Form von Schotter zum bodenbedeckenden Material. Nahe der Kirche ist eine Gruppe von Findlingen angeordnet, die während der letzten Eiszeit von Gletschern bis ins Schweizer Mittelland transportiert wurden.
Die meisten Brocken und Platten des Parks bestehen hingegen aus Nagelfluh, dem für das nördliche Alpenvorland typischen Konglomeratgestein, v. a. aber aus seinem menschengemachten Pendant, dem Beton. Die Betonplatten zeigen vielfältige Spuren der Bearbeitungen, aber auch Abdrücke von Drainagematten und Holzplatten. Und Abgüsse von Fossilien, etwa Ammoniten oder Saurierknochen. Andere Steine sind mit Begriffen versehen, die auf die Erdgeschichte der Region verweisen: »Tropisches Meer«, das sich während der Kreidezeit bis in die Schweiz erstreckte, »Ultrahelveticum«, »Metamorphose«, »Holozän«, »Superkontinent«. Inspirieren und neugierig machen will dieser Park, und schließlich auch zum Nachdenken anregen. »Nichts im Leben ist beständiger als der Wandel«, ein Zitat von Charles Darwin, liest man auf einer Betonscholle, Max Plancks Aussage »Die Naturwissenschaften braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln« auf einer anderen. Und auf der bankartigen Mauer, welche den Bereich hinter der Kirchenapsis vom Park abgrenzt, ist ein Bibelzitat (1 Mose 2,15) eingelassen: »Gott übertrug den Menschen die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu bewahren.« Glaube und Naturwissenschaft, auch diese beiden Pole verbindet der Park. Indem ein Wegesystem zwischen Kirche, Museum und dem nördlich gelegenen Botanischen Garten entsteht. Und indem die Blickachse zwischen den beiden Gebäuden aufgrund der niedrigeren Bepflanzung in der Mitte frei bleibt. Schließlich spielt auch das Wasser als Grundlage allen Lebens eine wichtige Rolle: Vor der Terrasse des Museumscafés liegt der »Forscherteich«, der von der Museumspädagogik genutzt wird, nahe der Kirche ein runder Brunnen, der »Ort der Begegnung«, der auch für Taufen dient.
Der Park ist rund um die Uhr zugänglich, man kann die Wege nutzen, aber auch von Stein zu Stein springen und das Schotterdickicht durchqueren. Er ist ein Ort zum Lernen und Entdecken, er verweist aber auch subtil auf die Tradition des historischen Landschaftsgartens mit seinen Fragmenten, künstlichen Ruinen und Sinnsprüchen. Kritisieren könnte man einzig, dass hier auf vergleichsweise engem Raum zu viel gewollt wurde. Die Offenheit der angesprochenen Themen wirkt allerdings einer möglichen didaktischen Überfrachtung entgegen. Und das Spiel mit Natürlichkeit und Künstlichkeit ist auf ebenso intelligente wie anregende Art und Weise umgesetzt.db, Di., 2021.05.11
11. Mai 2021 Hubertus Adam