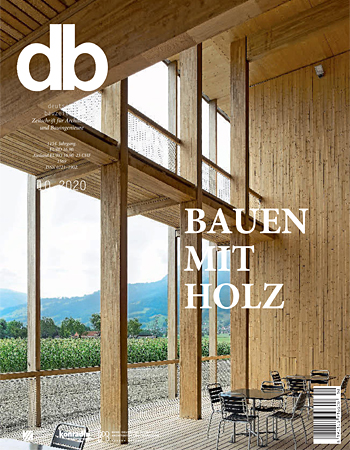Editorial
Das erste Heft, das ich 2005 bei der db konzipierte, war ein Heft zum Thema Holz. »Konstruktionen in Holz« haben wir es genannt, und ich erinnere noch sehr genau, dass wir damals bei der Projektauswahl ganz und gar nicht aus dem Vollen schöpfen konnten. Natürlich fanden sich einige Holzbauten, doch der eine »jodelte« uns zu sehr, der andere kam enorm technisch daher. Das, was wir uns vorstellten – eine zeitgemäße Gestaltung mit Holz, klar konzipiert und detailliert – mussten wir schon ziemlich suchen. 15 Jahre und drei Holz-Hefte später ist die Situation eine ganz andere. Bauen mit Holz wird nicht nur viel diskutiert, sondern hat sich weitgehend etabliert und der moderne Holzbau folgt längst der Maxime: Stilsicher geplant, durchdacht konstruiert und wirtschaftlich produziert. Unsere Auswahl an Projekten zeigt, dass Holz sowohl eine architektonisch reizvolle Hülle ergibt, als auch ein intelligentes Tragwerk darstellt. | Ulrike Kunkel
Holz Total
(SUBTITLE) Bürohaus Holzbau Küng in Alpnach (CH)
Eine Innerschweizer Holzbaufirma setzt seit Längerem auf den Vollholzbau. Nun ist auf dem Werksareal ein Bürogebäude entstanden, das demonstriert, wie man (fast) ohne Verbundwerkstoffe, Leim, Schrauben und Nägel bauen kann: nur mit Holz eben – und einem Kern aus Beton.
Dass Bauholz im Winter geschlagen werden muss, wusste schon Vitruv: nach der Vegetationsperiode kommt der Baum zur Ruhe und gewinnt an Festigkeit. Zusätzlich von Bedeutung sind die Mondphasen, wie es verschiedene holzwirtschaftliche Traktate behaupten. Zur Zeit des abnehmenden Monds geht das Wasser im Holz zurück, nach Neumond steigt es wieder in die Spitze. Das vor Neumond geschlagene Holz ist mithin weniger feucht und dichter: Es muss weniger stark getrocknet werden und ist überdies stärker geschützt gegenüber Schädlingsbefall.
Zugegeben, am Mondholz scheiden sich die Geister. Technokratisch gesinnte Zeitgenossen mit einem instrumentellen Verhältnis zu natürlichen Ressourcen sehen darin esoterischen Schnickschnack, doch jüngere Studien legen durchaus nahe, dass lunar-korrelierte Phänomene im Holz, die über Jahrhunderte die Holzfällerregeln im zentralen Europa bestimmten, nicht von der Hand zu weisen sind. Stephan Küng ist vom Mondholz überzeugt. Sein Vater Walter hatte die lokale Zimmerei und Schreinerei 1977 in Alpnach im Schweizer Kanton Obwalden gegründet. Anfangs waren es vier Personen, die alles aus Holz anfertigten, was man im Dorf und seiner Umgebung benötigte. Fünf Jahre später arbeiteten schon 15 Beschäftigte in Alpnach, und seither ist die Firma stetig gewachsen. 2006 – Sohn Stephan war gerade ein Jahr in der Firma tätig – wurde das »holzpur-System« eingeführt. Dieses ist heute das eigentliche Aushängeschild des Unternehmens, das gleichwohl parallel auch konventionelle Holzbauten erstellt.
Nichts als Holz
holzpur, nomen est omen, ist ein Bausystem, das nur aus Holz besteht. Die Wände werden aus zwei Elementen mit jeweils sieben kreuzweise wie bei Sperrholz übereinander gelegten Bretterschichten von 3 cm gebildet, sodass sich die Gesamtwanddicke zu 42 cm addiert. Es gibt drei Hersteller für derartige Vollholzsysteme in der Schweiz, und auch diese Technik ist nicht ganz unumstritten: Kritiker führen an, dass auch mit der nachwachsenden Ressource Holz sparsam umgegangen werden sollte und man aus der Menge an Material, die für ein Vollholzgebäude verbraucht werde, mehrere konventionelle Holzbauten erstellen könnte. Allerdings findet bei den inneren Lagen der holzpur-Elemente Fichtenholz geringer Güte Verwendung, das sonst allenfalls geschreddert und zu Holzfaserprodukten verarbeitet oder gar thermisch verwertet wird. Unregelmäßigkeiten spielen übrigens keine Rolle, da Lufteinschlüsse im Innern der Wände sogar durchaus gewünscht sind.
Eine zusätzliche Dämmung ist bei diesem System aufgrund der Massenträgheit und der isolierenden Wirkung nicht nötig, und Holzbau Küng geht so weit, die Lagen nicht zu verschrauben, zu nageln oder zu verleimen, sondern mit angefeuchteten und dann aufquellenden Buchendübeln zu verbinden.
Ein Gebäude als Visitenkarte
Der Verzicht auf Verbundwerkstoffe sowie auf Leim, Metall und andere Zusätze, die Verwendung unbehandelter Hölzer stößt auf steigendes Interesse, und so beschäftigt die Firma derzeit 80 Mitarbeitende und 15 Projektleitende – also Personen, die für und mit den Architekten die Entwürfe umsetzen und die Details zeichnen. 2013 wurde eine Werkshalle errichtet, in der die holzpur-Elemente vollautomatisiert produziert werden. Den Auftrag erhielt das im nahen Sarnen sowie in Luzern ansässige Büro von Patrik Seiler und Søren Linhart, das mit Küng zuvor schon einige Bauten realisiert hatte. Die Beziehung zwischen Architekten und Unternehmen intensivierte sich noch, als Stephan Küng, der 2017 die Firmenleitung von seinem Vater übernahm, 2015-18 sein privates Wohnhaus durch Seiler Linhart errichten ließ. Und nun ist als jüngstes Gemeinschaftsprojekt das Bürogebäude entstanden, in dem sich die dringend benötigten Besprechungsräume sowie die Einzel- oder Doppelbüros für die Projektleiter befinden. Und in dem ganz oben unter dem Dach zukünftig in einem kleinen Ausstellungsbereich auch Gäste empfangen und mit den Produkten der Firma und dem Thema naturnahem Bauen vertraut gemachten werden können.
Das Gebäude löst also Raumnot, besitzt, als Visitenkarte der Firma, aber auch Strahlkraft nach außen. Und selbstverständlich bestehen die Wände aus holzpur – außen mit sägerohem Fichtenholz, innen mit Weißtanne verschalt. Über den Fenstern und Türen sind Mondmotive in Platten eingefräst, die ornamental auf das Mondholz verweisen.
Doch die Fassade des viergeschossigen Gebäudes tritt hinter einer äußeren Lauben-Raumschicht, die aufgrund der Exponiertheit als Hängetragwerk aus Eiche konstruiert ist, zurück. Seiler Linhart orientieren sich an der Idee der Lauben der traditionellen Innerschweizer Häuser, erweitern diese jedoch zu Umgängen. Die, aufgrund der nach oben hin zunehmenden Auskragungen leicht schräg geführten Zugstangen, die Gleichgewichtigkeit der Fassaden und das von einer Laterne durchbrochene Zeltdach lassen ein markantes, bildhaftes Volumen entstehen. Die Lauben selbst übernehmen gleich mehrere Funktionen: Über die französischen Fenster für die Mitarbeitenden zugänglich fungieren sie als Außenraum, dienen gleichzeitig der Verschattung – sodass Store überflüssig wurden – und sind natürlich auch konstruktiver Holzschutz für die Fassade.
Schale und Kern
Tritt man ins EG mit Empfang, Chefbüro und rückwärtigem Gemeinschaftsraum, in dem gemeinsam gegessen oder auch gefeiert wird, so stößt man zunächst auf einen Kamin. Das mag in einem Bürogebäude überraschen, doch die Bauherrschaft, die Wohnhäuser herstellt, wünschte sich auch hier eine Atmosphäre der Wohnlichkeit. Wer auch immer im Winter das Gebäude als Erster betritt, macht den Kamin an. Dieser ist integriert in den Kern des Gebäudes, der aus Sichtbeton besteht, komplett sandgestrahlt ist und die Treppen, Aufzüge und Nasszellen umfasst. Gewissermaßen stellt der Kern eine Gegenwelt zur Konstruktionslogik des umgebenden Holzbaus dar: gegossen und dunkel, nicht gefügt und hell. Die Kanten sind plastisch ausgebildet, sodass der skulpturale, fast felsige Charakter verstärkt wird, und runde Aussparungen in den Wänden lenken beim Hinauf- oder Hinabgehen den Blick in das Geschoss darüber oder darunter.
Präzision und Perfektion
Beeindruckend ist die Präzision, mit der Seiler Linhart die Materialien verwendeten. Alle Türen und Möbel, die im Kern liegen, bestehen aus schwarz geölter Eiche. Alles Übrige ist in unbehandelter Weißtanne und Fichte ausgeführt. Für die Handläufe und die Staketengeländer der Lauben kam geöltes Eisen zur Anwendung, im Eingangsbereich findet sich ein Sumpfkalkboden, der von den Mitarbeitenden selbst gestampft wurde. Der Deckenaufbau mit seinen Gitterstrukturen aus Buche ist ebenfalls eine eigene Erfindung und eigene Produktion. Wie bei holzpur möglich, wurden die Kanäle für die Heizschlaufen der Fußbodenheizung direkt in die Bretterlage gefräst. Die Trennwände im Innern sind nichttragend und gewähren daher die gewünschte Flexibilität in den Büros. Die Architekten entwarfen auch das gesamte Mobiliar und entwickelten ein Stecksystem für Schrankmöbel. Auch dieses kommt ohne Leim und Schrauben aus und kann von den Mitarbeitenden je nach Bedarf zusammengestellt und verändert werden. Dazu kommen verstellbare Tische, die mit Winden hoch- und runtergefahren werden.
Ohne Zweifel, Seiler Linhart ist die Balance zwischen Funktionalität und Opulenz aufs Beste gelungen. Es handelt sich eigentlich um ein klares, kompaktes Volumen, das aufgrund seiner umlaufenden Lauben und des skulpturalen Betonkerns überraschend vielgestaltig, also keineswegs spröde oder kantig wirkt. Es demonstriert, wie ein präziser und perfekter Holzbau heute aussehen kann, und ist damit nicht zuletzt auch das gewünschte Anschauungsobjekt für das von Küng Holzbau entwickelte Vollholzsystem.db, Fr., 2020.10.02
02. Oktober 2020 Ulrike Kunkel
Dreieckiges Tor zur Stadt
(SUBTITLE) Bahnhof in Assen (NL)
Mit ihrem neuen Bahnhof hat die niederländische Kleinstadt Assen ein charaktervoll gestaltetes neues Entrée mit optimierter Anbindung erhalten. Der Entwurf der beiden Architekturbüros Powerhouse Company und De Zwarte Hond überzeugt v. a. durch seine luftig-elegante Dachkonstruktion aus Holz, die scheinbar über der verglasten Bahnhofshalle schwebt.
Mit rund 9.000 Reisenden am Tag ist der Bahnhof der 70.000 Einwohner zählenden Kleinstadt Assen der meistfrequentierte Verkehrsknotenpunkt in der Provinz Drenthe im äußersten Nordosten der Niederlande. Seit 1989 wurde der zwischen Zwolle und Groningen gelegene Durchgangsbahnhof durch einen wenig einladenden Glaskörper mit einem banal gestalteten Dach in blauer Farbigkeit geprägt. Im Rahmen der groß angelegten städtebaulichen Masterplanung »FlorijnAs« ist das gesamte Areal mittlerweile aber erneuert worden. Neben einer grundlegend umgestalteten Verkehrsführung hat die Stadt dabei auch ein neues Bahnhofsgebäude erhalten.
Aus dem Architekturwettbewerb mit fünf eingeladenen Büros war 2014 das Team von Powerhouse Company aus Rotterdam und De Zwarte Hond aus Groningen als Sieger hervorgegangen. Ihr gemeinsamer, in enger Kooperation mit der Gemeinde Assen sowie mit der Niederländischen Bahn entwickelter Entwurf schafft ein offen und freundlich gestaltetes Tor zur westlich angrenzenden Innenstadt und ermöglicht durch eine neue Fußgängerunterführung in Kombination mit einem zuvor bereits eröffneten Fahrradtunnel gleichzeitig eine optimierte Anbindung der östlich der Bahnlinie gelegenen Stadtteile.
Architektonische Ikone für die Stadt Assen
Charakteristischer Blickfang des Neubaus ist das dreiecksförmig gestaltete, über den Bahnsteigen und den Gleisen weit auskragende Holzdach. Die nach Südwesten in Richtung Stadt deutlich aufsteigende und über den Gleisen aufgrund der hier verlaufenden Oberleitungen teilweise geschwungen ausgebildete Konstruktion bietet eine luftig-elegante Überdachung für die durchgehend verglaste Bahnhofshalle. Zudem schafft sie ein markantes, aus allen Blickrichtungen attraktives architektonisches Zeichen, das mit seiner Materialität deutlich sichtbar die Ambitionen der Stadt im Hinblick auf Nachhaltigkeit zeigt. »Unterbrochen wird die Struktur lediglich durch einige transparente Elemente aus Polycarbonat in der Mitte des Dachs, durch die ausreichend Tageslicht in die Bahnhofshalle und auf die Bahnsteige fällt und dort je nach Wetter ein bewegtes Spiel von Licht und Schatten erzeugt«, erklärt Projektarchitekt Dik Houben vom Büro Powerhouse Company.
Die unter dem riesigen Schirm gelegene Bahnhofshalle fungiert als wettergeschützter Aufenthaltsraum und integriert gleichzeitig die Zugänge zu den beiden Gleisen, verschiedene Läden sowie Information, Ticketschalter, Fahrkartenautomaten und Toiletten. Ein Teil der Funktionen wurde als eigenständige Pavillons mit abgerundeten Gebäudekanten und mit rot-braunen Klinkerfassaden frei unter das Dach geschoben. Die angenehm-warme Farbigkeit der Steine ermöglicht dabei einen fließenden Übergang zu dem für die Bodengestaltung verwendeten Roten Porphyr und zu dem roten Pflasterstein, der die Ankommenden vom Vorplatz bis in die Innenstadt leitet. Sehr wichtig war bei der Gestaltung der Pavillons außerdem die Berücksichtigung einer maximalen Flexibilität: »Ganz bewusst haben wir die freistehenden Stützen des Dachs unabhängig von der Struktur der Einbauten konstruiert, sodass sich die Aufteilung der Flächen bei Bedarf jederzeit ohne größere Eingriffe ändern lässt«, so Dik Houben.
Komplettiert wird das Raumprogramm durch eine unterhalb der Erde platzierte, nach Norden hin von einem Gründach überdeckte und direkt an die neue Unterführung angegliederte Fahrradgarage mit insgesamt 2.600 Stellplätzen: »Den durch die Umgestaltung weitgehend verkehrsberuhigten Bahnhofsvorplatz konnten wir somit frei halten und entsprechend attraktiv und einladend mit einer neuen Pflasterung und Sitzbänken gestalten.« Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die 7 m hohe, durch den Architekten Maurice Nio gemeinsam mit dem Künstler Q.S. Serafijn geschaffene hölzerne Hundeskulptur »Mannes«.
Komplexe Dachkonstruktion aus Brettschichtholz-Bindern
Besondere Anforderungen bei der Planung und Umsetzung des Projekts stellte das dreiecksförmige, mit Kantenlängen von 78, 88 und 90 m ausgeführte und insgesamt rund 3.080 m² große Dach aus Fichtenholz. Nach Südwesten steigt die Konstruktion bis auf eine maximal zulässige Höhe von 10 m auf, in Richtung Osten ist das Dach demgegenüber leicht nach unten geneigt, sodass anfallendes Regenwasser hier in einen Sickerteich abfließen kann. Im zentralen Bereich ist das Dach durch die aufliegenden Elemente aus Polycarbonat witterungsdicht abgedichtet, in den Randbereichen haben die Planer einen 8 m breiten, mit Bitumen ausgebildeten Sedum-Grünstreifen integriert, um eine Witterungsbelastung des Holzes zu verhindern und das Überlaufen von Regenwasser zu minimieren.
Das Bahnhofsdach in Assen ist das erste in den Niederlanden, das primär aus Holz besteht. Um die am Abend eindrucksvoll beleuchtete Konstruktion fachgerecht umsetzen zu können, wurde für die Ausführungsplanung und Tragwerksplanung des Dachs das Ingenieurbüro Miebach aus Lohmar bei Köln hinzugezogen. In enger Kooperation von Architekten und Tragwerksplanern und in einem durchgehend BIM-gestützten Prozess wurde das großflächige Flächentragwerk berechnet und ausgearbeitet, bestehend aus insgesamt 324 unsymmetrisch geformten, im Grundriss jeweils 5,0 x 4,85 x 4,30 m großen Dreiecken, die aus 5 m langen, 1,20 m hohen und 22 cm dicken Brettschichtholz-Bindern gebildet werden.
Der Werkstoff Holz erweist sich immer öfter als wirtschaftliche Alternative zu Stahl oder Beton: »Das Verhältnis von Eigengewicht zu Tragfähigkeit und das gut einschätzbare Brandverhalten machen den Baustoff dabei v. a. für Dachtragwerke mit großen Spannweiten sehr attraktiv«, so Lukas Osterloff vom Ingenieurbüro Miebach. Ein wichtiges Argument ist außerdem die hohe Nachhaltigkeit des Baustoffs: »Insgesamt kamen bei dem Projekt 620 m³ Holz zum Einsatz, sodass in der Summe der Kohlenstoff von 620 Tonnen CO2 dauerhaft gebunden wird.«
Parametrische Berechnung der Knotenpunkte
Eine große Herausforderung bei der Planung bedeutete die Lastabtragung der Dachkonstruktion und die Berechnung sämtlicher Stäbe (Brettschichtholz-Binder) sowie der zwischen den einzelnen Dreiecken entstandenen Knotenpunkte: »Aufgrund der unsymmetrischen Form des Dachs und der abweichenden Spannweite über den Gleisen mussten wir die 471 Stäbe und die 190 Knotenpunkte alle individuell berechnen«, erklärt Lukas Osterloff. »Ohne den Einsatz parametrischer Softwarelösungen wäre es letztlich kaum möglich gewesen, die Verbindungen der Stäbe über Schlitzbleche und Stabdübel abgestuft entsprechend der lokalen Belastung durch Eigengewicht, Schnee, Wind und Regenwasser zu konstruieren.«
Ebenfalls individuell angepasst werden mussten die unterschiedlich langen, nach oben biegesteif an das Dach angeschlossenen und unten gelenkig gelagerten Stützen, die in ihrer Materialität aber leider von der übrigen Konstruktion abweichen: »Um einen homogenen Gesamteindruck zu erhalten, hatten wir ursprünglich Holzstützen mit einem Stahlfuß vorgesehen«, berichtet Dik Houben. »Aus Kostengründen und weil die Stützen sonst zu massiv geworden wären, haben wir dann aber abweichend hell beschichtete und nach oben sternförmig auskragende Rundstahlstützen mit einem Durchmesser von jeweils 60 cm gewählt.«
Um das große Flächentragwerk umsetzen zu können, wurden die verschiedenen Bauteile nach Fertigung per CNC-Fräse als Einzelstäbe zur Baustelle geliefert und dort in unterschiedlich großen Elementen vormontiert und eingehoben. Die größten Elemente wurden dabei für die Überbrückung der Gleise eingebaut und beidseitig der Gleise mithilfe von zwei Kränen in Millimeterarbeit zusammengeführt. »Trotz des hohen Gewichts der beiden Teile hat das alles aber reibungsfrei funktioniert, sodass wir das Dach in einer Bauzeit von neun Monaten fristgerecht bei laufendem Bahnbetrieb umsetzen konnten.«db, Fr., 2020.10.02
02. Oktober 2020 Robert Uhde