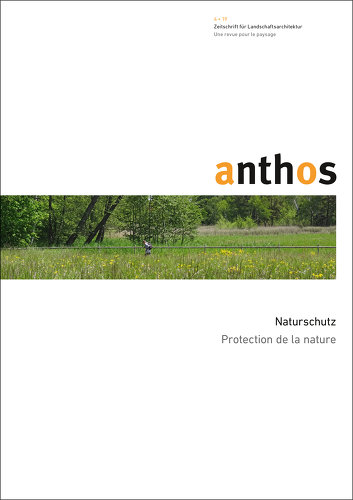Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Mit besten Grüssen von der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 verabschieden wir uns von Ihnen. Der Vorstand des BSLA hat im Frühjahr 2019 entschieden, anthos, das seit 1962 erscheinende einzige Schweizer Fachmagazin für Landschaftsarchitektur, mit Ausgabe 1/2020 einzustellen. Wir räumen bereits mit Ausgabe 4/2019 das Feld und bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen. Dafür, dass Sie anthos zum Teil über Jahrzehnte die Treue gehalten haben, für das entgegengebrachte Vertrauen, die spannenden Diskussionen und die vielen positiven Rückmeldungen. Unser besonderer Dank gilt dem Engagement der Autorinnen und Autoren in zahlreichen Büros weltweit, die uns mit ihren Beiträgen Einblicke in Projekte gewährt haben, ohne die es anthos nicht hätte geben können.
Unsere letzte Ausgabe nimmt den Naturschutz in den Fokus. Ein Thema, dem leider immer noch viel zu oft kaum mehr als Konservieren und Verhindern zugetraut wird. Dabei tut sich gerade hier so viel! Wir stellen Projekte vor, die sich mit unterschiedlichsten Aspekten dieses breiten Aufgabenfelds befassen.
Sie haben gemein, dass sie ein zeitgemässes und zukunftsgewandtes Verständnis von Naturschutz vertreten. Und sie zeigen, dass Technik und technische Hilfsmittel zwar die Arbeit im Detail erleichtern, vieles aber weiterhin Handarbeit bleibt. Viel Vergnügen.
Ihr Redaktionsteam, Dania Genini, Zélie Schaller, Sabine Wolf