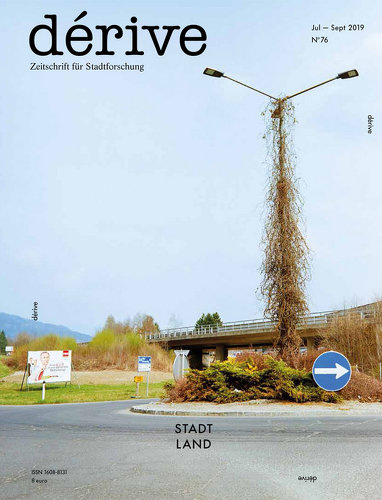Editorial
Das Verhältnis zwischen Stadt und Land ist in den letzten Jahren wieder verstärkt in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Auslöser dafür sind vor allem politischer Natur, der Anlass immer wieder Wahlergebnisse, Statistiken über Landflucht und manchmal auch Protestbewegungen. So klar viele der Phänomene bei oberflächlicher Betrachtung scheinen, so unscharf werden sie bei näherer Beschäftigung. In den USA haben die Tea-Party-Bewegung oder die Wahl Donald Trumps dazu geführt, dass sich WissenschaftlerInnen und AutorInnen vermehrt die Frage gestellt haben , was mit diesen Menschen in den Flyover-Staaten eigentlich los ist, die auf einmal Stunk machen und populistische Maniacs in höchste Ämter wählen. Man muss nicht lange suchen, um dann doch auf etliche nachvollziehbare Gründe zu stoßen, die berechtigterweise Anlass dazu geben, unzufrieden zu sein: Die baulichen Infrastrukturen in den USA sind in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt worden, für finanziell ausgehungerte Kleinstädte und Landstriche im Nirgendwo interessiert sich kein Mensch, das Wort Overtourism kennt hier niemand.
Die Einkommen vor allem der unteren Mittelschicht sind seit den 1990er-Jahren gesunken, ebenso die Lebenserwartung, besonders in der Arbeiterklasse.
Gut bezahlte Jobs verschwinden, Alkoholismus, Drogenkonsum, Selbstmorde und psychische Krankheiten nehmen zu. Wie Angus Deaton, Nobelpreisträger 2015 für Ökonomie, behauptet, passiert mit der weißen Arbeiterklasse in den USA heute das, was mit der schwarzen Arbeiterklasse schon in den 1970er-Jahren geschah. Sie wird nicht mehr gebraucht.
Eine in den letzten Wochen in den US-Medien diskutierte Studie der beiden Politikwissenschaftler Peter Ganong und Daniel Shoag weist nach, dass eine der klassischen ökonomischen Aufstiegsmöglichkeiten für die ländliche bzw. kleinstädtische Arbeiterklasse, nämlich der Umzug in eine größere Stadt, aufgrund sinkender Löhne und steigender Lebenshaltungskosten in den Städten keinen Sinn mehr macht. Das Ergebnis: In den USA verzeichnen fast alle der großen Städte Bevölkerungsrückgänge. Die Lebenshaltungskosten sind für Menschen ohne Uniabschluss im Vergleich zu den Verdienstmöglichkeiten mittlerweile einfach zu hoch.
Ganz ähnlich sind die aktuellen Entwicklungen in England. Der *Guardian* zitiert eine Studie, die besagt, dass die Zahl der Menschen zwischen 25 und 34, die übersiedeln, um einen neuen Beruf zu beginnen oder zu finden, heute im Vergleich zu den 1990ern um 40 Prozent gesunken ist. Grund dafür sind auch hier die hohen Lebenshaltungskosten in den urbanen Zentren, im Speziellen natürlich die hohen Mieten, die sich immer weniger Menschen leisten können. Pessimistisch zugespitzt könnte man sagen: Das Leben am Land bietet keine Perspektive, das Leben in der Stadt können sich nur mehr Reiche leisten.
Im vorliegenden Schwerpunkt geht Ilse Helbrecht der Frage nach, was denn Stadt und Land bzw. Urbanität und Ruralität nun eigentlich unterscheidet und was die Stadtforschung dazu sagt. Ähnlich wie auch Maximilian Förtner, Bernd Belina und Matthias Naumann in einem weiteren Beitrag in diesem Heft wehrt sie sich, anhand von z. B. Wahlergebnissen eine scharfe Grenze zwischen urban und rural zu ziehen und beiden Seiten eindeutige Charakteristika zuzuordnen. Die drei genannten Autoren zeigen am Beispiel von Wahlerfolgen der AfD, dass auch hier ein genauerer Blick notwendig ist und einfache Stadt-Land-Zuordnungen in die Irre führen können. Mit dem bekannten österreichischen Sozialforscher Günther Ogris haben wir über die Geographie des Wahlverhaltens in Österreich gesprochen und mit Erstaunen gehört, wie stabil die österreichische Wahlkarte ist. Theresia Oedl-Wieser beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema der Abwanderung der weiblichen Landbevölkerung in die Städte und hat darüber einen Artikel für den Schwerpunkt verfasst.
Auch hier wird klar, dass ohne genauen Blick die Gefahr von vereinfachten, voreiligen Schlüssen droht. Judith Eiblmayr schreibt in ihrem Beitrag über Hintergründe, Ursachen und Begleiterscheinungen von Suburbanisierung speziell in den USA und ihren britischen Anfängen. Die oben angesprochenen ökonomischen Verwerfungen finden ihre Berücksichtigung in einem von uns für dieses Heft übersetzten Artikel aus der *London Review of Books* über die Gelbwesten von Jeremy Harding.
Ebenfalls mit dem Thema *Stadt/Land* hat sich eine Veranstaltung beschäftigt, die wir Anfang Juni für das *Kunst Haus Wien* kuratiert haben. Die Vorträge bildeten eine Begleitveranstaltung zur sehenswerten Ausstellung *Über Leben am Land*, die noch bis 25. August läuft.
Von 9. bis 13. Oktober veranstalten wir bereits zum zehnten Mal das *urbanize!*-Festival, diesmal zur allerorten höchst virulenten Wohnungsfrage. Im Jubiläumsjahr *100 Jahre Rotes Wien* begeben wir uns auf die Suche nach Fragestellungen und Möglichkeiten einer gerechten Wohnraumversorgung für alle: *Alle Tage Wohnungsfrage* fragt nach dem Menschenrecht auf Wohnen und seiner Durchsetzbarkeit gegen das derzeit vorherrschende Modell »Wohnen als Ware«, nach Wohnmodellen für eine Gesellschaft im Wandel und dem Beitrag von Architektur und Stadtplanung zur Lösung der Klimakrise. Dazu laden wir nach Wien-Favoriten, dem mit rund 200.000 Einwohnern größten Wiener Gemeindebezirk, mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungsorten, Vorträgen und Diskussionen, Stadterkundungen und Workshops, Filmen und Interventionen zwischen dem traditionellen Favoriten und seinem neuen Stadtentwicklungsgebiet Sonnwendviertel.
(Noch) keine Veranstaltung wird es im Hausprojekt *Bikes and Rails* im Sonnwendviertel geben, an dem wir beteiligt sind. »Ökologisch – Solidarisch – Unverkäuflich« lauten die Säulen des Holzbau-Passivhauses, das im Sommer 2020 bezugsfertig sein wird. Nach wie vor freuen wir uns über Menschen, die das erste Neubauprojekt im *habiTAT – Mietshäuser-Syndikat* unterstützen, indem sie Erspartes zwischen 500 EUR und 50.000 EUR als Direktkredit auf Zeit zur Verfügung stellen. 1,2 Mio. EUR befinden sich schon in diesem Alternativ-Finanzierungstopf, rund 300.000 EUR werden noch benötigt, um endgültig zu beweisen: Solidarität schafft Raum! Mehr Informationen und die Direktkredit-Unterlagen gibt es auf www.bikesandrails.org.
Die Redaktion