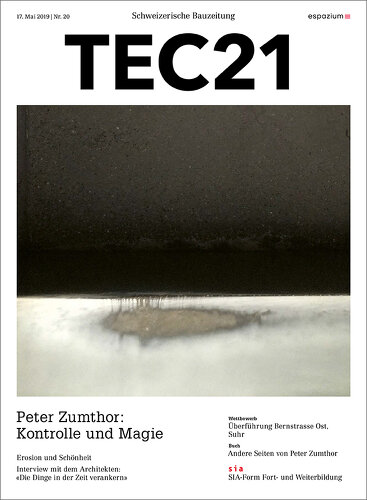Editorial
Die Frage der Zeit, des Alterns ist eines der grossen Themen im Werk Peter Zumthors. Als wir uns das anlässlich der Ehrung durch den Verband Schweizer Innenarchitekten (VSI.ASAI.) nochmals vor Augen führten, hat uns verblüfft, wie alt viele der Bauten sind. Das erste Bad in der Therme Vals während des Architekturstudiums ist in bester Erinnerung. Die Feldkapelle Bruder Klaus, gefühlt eines der jüngeren Bauwerke, entstand bereits zwischen 2001 und 2007.
Neugierig, ob der Anspruch an Material und Ausführung, die der Architekt kompromisslos einfordert, langfristig gerechtfertigt ist, haben wir uns erneut auf eine Reise begeben, um den heutigen Zustand der Bauten unter die Lupe zu nehmen. Fast hätten wir unser Vorhaben vergessen, als wir mit der Bademeisterin im Morgengrauen durch die Therme wandelten. Und der Rundgang zwischen den Häuten des Kunsthaus Bregenz hat uns die Augen für die Schönheit feinster Spuren geöffnet – so zart, dass sie theoretisch nicht der Rede wert wären. Anschliessend sprachen wir mit Peter Zumthor in seinem Wohnhaus über seine Sicht aufs Altern in der Architektur. Dazu ein Satz von Max Frisch aus «Stiller», der uns Menschen widerspiegelt, aber auch auf Zumthors Bauten passt: «Für jedes Lebensalter, ausgenommen das kindliche, bedeutet die Zeit ein gelindes Entsetzen, und doch wäre jedes Lebensalter schön, je weniger wir verleugnen oder verträumen, was ihm zukommt, denn auch der Tod, der uns einmal zukommt, lässt sich ja nicht verleugnen, nicht verträumen, nicht aufschieben.»
Die Zeit hat den Zauber der Gebäude verändert. Heute ist er mancherorts sogar intensiver zu spüren als zuvor.
Danielle Fischer, Hella Schindel
Inhalt
03 EDITORIAL
07 WETTBEWERB
Ausschreibungen | De Foifer und ’s Weggli
13 BUCH
Andere Seiten von Peter Zumthor
13 FORSCHUNG
Braucht es noch Statiker?
14 ESPAZIUM
Aus unserem Verlag
16 VITRINE
Bad und Küche frisch herausgeputzt
19 SIA
SIA-Form Fort- und Weiterbildung
20 AGENDA
22 KONTROLLE UND MAGIE
22 EROSION UND SCHÖNHEIT
Danielle Fischer, Hella Schindel
Eine Reise zu einigen Bauten von Peter Zumthor lenkte den Blick auf die Spuren, die Elemente und Nutzer im Lauf der Zeit an ihnen hinterlassen haben.
30 «DIE DINGE IN DER ZEIT VERANKERN»
Danielle Fischer, Hella Schindel
Ein Gespräch mit Peter Zumthor über den Alterungsprozess von Bauten, ihre Materialien sowie die Bedeutung der Geschichte.
34 STELLENMARKT
37 IMPRESSUM
38 UNVORHERGESEHENES
Erosion und Schönheit
Das Werk von Peter Zumthor gilt als zeitlos. Um das Verhältnis von Aufwand und Qualität einordnen zu können, haben wir einige seiner prägenden Bauten, die zwischen 1985 und 2007 entstanden, wiederbesucht.
Ein Architekt entwirft einen Bau mit bestimmten Proportionen, Formen und Materialien. Wie und wo er sie einsetzt und kombiniert, das und vieles mehr ist Teil seines Entwurfs. Dem Eröffnungszeitpunkt wird von Architekten und Bauherren in der Regel grosse Bedeutung beigemessen. Wenn ein Bauteil nicht funktioniert oder es von der ästhetischen Norm abweicht – sich zum Beispiel stärker verfärbt als erwartet –, dann wird der Mangel durch Garantiearbeiten behoben. Differenzen, die nicht zu korrigieren sind, werden meistens als Fehler betrachtet. Anlässlich der Fertigstellung soll der Bau eine möglichst perfekte Momentaufnahme der Ausgangsidee verkörpern und sich seinem Abbild so stark wie möglich annähern.
Wie der Architekt über diese erste, inszenierte Erscheinung des Baus hinaus mit zukünftigen Veränderungen umgeht, ist unterschiedlich. Dabei kann er eine Taktik des Verlangsamens oder Vermeidens einschlagen oder die Spuren ohne Gegenmassnahmen zulassen. Diesem direkten alltäglichen und anhaltenden Alterungsprozess misst man häufig weniger Bedeutung bei. Wie eine Fassade nach 20 oder 30 Jahren aussieht, wird selten und wenn, dann eher als mutmassliches Randphänomen in den Ausgangsentwurf einbezogen. Bei den laufend neu entwickelten Zusammensetzungen von Putzen, Farben oder Baumaterialien ist es auch kaum möglich, diese Frage eingehend zu beantworten: Langzeitstudien gibt es kaum. Doch welche Taktik gewählt wird – der Prozess setzt sofort ein: Licht, Regen, Wind und Nutzer verändern die Oberflächen. Das Bild des Baus wandelt sich langsam – und das betrifft den weitaus längsten Teil seines Bestehens.
Manche Altersspuren werden eher akzeptiert, so z. B. traditionelle, sich in der Witterung verfärbende Holzfassaden. Andere sind wenig beliebt – man denke an Algenablagerungen, an Wetterspuren auf Kompaktfassaden. Es würde sich lohnen, in Zukunft regelmässig nach 10, 20 oder 50 Jahren nochmals einen Blick auf Bauten zu werfen, die zu Beginn ihrer Entstehung gelobt wurden. Denn was ist nachhaltiger als ein Bau, der gut und schön altert? Wie sehen Mauerwerk, Verputz, Fenster oder Böden aus? Wurde renoviert und wenn ja, wie? Wie artikulieren sich diese Spuren? Stören sie oder machen sie den Bau besser?
Natürlich ist auch beim Altern die Empfindung des Betrachters subjektiv: Was schön ist und was nicht, bleibt ihm überlassen. Doch es muss darüber hinaus etwas geben, was gemeinhin als ästhetisch und angenehm gelten kann – ähnlich wie bei menschlichen Gesichtern. Die Bauten von Peter Zumthor sind dafür bekannt, dass sie ansehnlich und würdevoll altern – darin sind sich die meisten Betrachter einig. Doch was liegt diesem Eindruck zugrunde?
Kapelle Sogn Benedetg, Sumvitg 1985–1988
Die Kapelle an einem Berghang in Sumvitg ist ein Ersatzbau für einen älteren, von einer Lawine zerstörten Steinbau, der weiter talwärts lag. Seit Fertigstellung vor 31 Jahren haben unzählige Architekten und Architektinnen den kleinen, einfachen Holzbau mit Schindelfassade besucht. Seine Grundform weckt viele Assoziationen – Peter Zumthor beschrieb sie als einen Fisch, eine Arche, ein Auge, ein Blatt. Die Lärchenschindeln der Fassade altern seither in Sonne, Wind, Regen und Schnee. Die Südseite ist dunkel, lebendig in den Farben, aber keinesfalls monochrom; durch das unterschiedlich austretende Tannin wirkt sie auffällig gesprenkelt. Im Norden, gegen den Berg hin, ist die Farbe dagegen fast einheitlich silbern. Am schräg abfallenden Sockel sind die Holzstücke am Übergang zur Wiese fast weiss.
Eine seitlich angebrachte Treppe führt an der Bergseite über drei Stufen ins Innere. Der Boden in dem kleinen Kapellenraum schwebt im Schnitt einige Meter über dem steilen Berghang. Die Bohlen sind auf eine Unterkonstruktion verlegt, und beim Durchschreiten beginnen sie leicht zu schwingen. Ihr etwas eigensinniges Knarren wirkt, als habe es sich im Lauf der Zeit auf diesen Klang «eingestimmt». Rund um die Bänke, entlang der Wand zeigen sich die Tritte der Besucher am abgenutzten Lack, und auch zwischen den Bänken weisen die Abnutzungsspuren am Boden auf die Kirchgänger hin. Die Anwohner haben sich den Bau auf eine natürliche Art zu eigen gemacht, ihm Schränke und Bodenbeläge eingefügt, ohne damit seine luftige Wirkung zu schmälern. Die silbern gestrichene Wand schimmert im Licht, das durch den rings um die Decke angebrachten Fensterkranz ins Innere dringt. Das Silber hat über die Jahre an einigen Stellen seinen matten Glanz etwas eingebüsst und wirkt blinder als zu Beginn. Der dezent sakrale Innenraum lädt heute wie damals zur Kontemplation ein.
Kunsthaus Bregenz (A) 1989–1997
Mit grösstmöglicher Klarheit bietet das Museum Flächen, die zwischen drei vertikalen Wandscheiben aufgespannt sind. Das Tageslicht, das über die matten Glasscheiben der doppelten Aussenhaut einströmt, ist – umrahmt von den Schatten der Wände – das prägende Gestaltungselement. Es taucht die Räume in ein diffuses Licht, das tatsächlich an die Stimmung draussen über dem Bodensee erinnert. Die Technik verschwindet zwischen den vertikalen Häuten und oberhalb der abgehängten Glasdecken. Ein Schacht, der das Technikuntergeschoss mit den vier Ausstellungsetagen verbindet, sowie die Erschliessung sind ausserhalb der drei Wandscheiben angelagert, Verwaltung und Café sogar in ein eigenes Haus gerückt. Was bleibt, sind vollkommen leer geräumte Ausstellungsräume, die sich ganz in den Dienst der künstlerischen Interventionen stellen.
Die industriell anmutenden, kraftvollen Materialien bilden eine eigene Präsenz, auf die die Künstler reagieren können. Dieses Angebot verführt die Ausstellenden hin und wieder zum schonungslosen Kräftemessen. Exponate aus Gewichten, Lehm, Wachs, Feuer und Eis haben das Haus schon an den Rand seiner Belastbarkeit gebracht und ihre Spuren hinterlassen. Der tragende Baukörper ist so massiv, dass er einiges aushält. Terrazzoboden und Wände aus unbehandeltem Rohbeton wirken auf den ersten Blick monochrom. Bei genauerem Hinsehen entfaltet sich eine Landschaft aus Klebspuren, Flecken, Füllungen und Rissen. Die Oberflächen sind wie Speicher, die die Gegenwart der vergangenen Ausstellungen präsent halten. Die künstlerischen Werke klingen nach, bis die Eingriffe überlagert oder verblasst sind und wieder Raum für Neues geben. Wenn nötig, werden die Wände aufgebohrt und beklebt, die Glasfassaden verschattet oder die abgehängten Glasdecken entfernt, womit der Raum gut zwei Meter Höhe gewinnt.
Der Aufbau der Glasdecke und der aussen liegenden Hülle folgt dem Prinzip, dass alle Teile einzeln zugänglich sind und jederzeit demontiert und ausgetauscht werden können. So entstand in den letzten 20 Jahren ein nuanciertes Farbenspiel im Puzzle der Glastafeln, das im Lauf der Zeit immer feiner werden wird. Den radikalen Umgang der Künstler mit dem Ort nimmt ein eingespieltes Team für Technik und Restauration, das für den Unterhalt des Gebäudes zuständig ist, als Herausforderung. Es kuratiert das Haus im Wortsinn. Mit einem Blick auf die langfristige Bestandserhaltung unterstützt es das Ausreizen des Möglichen und lässt den Spuren anschliessend Zeit zum Verschwinden. Das Geheimnis liegt hier in der Behandlung des Alterns als Wechselspiel von Markierung und Erneuerung. Die Beanspruchung verleiht dem Baukörper eine Ausdruckskraft, die mit den Jahren wächst.
Therme Vals 1990–1996
Von aussen sieht die Valser Therme beinahe aus wie vor 29 Jahren zur Zeit ihrer Eröffnung. Die innere und die äussere Schicht aus lokalem Gneis verbinden sich mit dem Betonkern zu einer selbsttragenden Konstruktion und verleihen dem Bau etwas Stoisches, Beherrschtes: Durch die massive, monolithische Gestalt scheint ihr Alter eher in dem des Steins zu liegen als in seiner Konstruktion und Erstellung. Im Innern reflektiert das Wasser das Licht jederzeit anders, und in einigen Räumen prägt Dunkelheit die Atmosphäre. Überall finden sich unterschiedliche Verweise auf das Verhalten der Badegäste, die Wege des Wassers und seiner Mineralien. Sie wirken im gedämpften Licht geheimnisvoll. Einige muss man suchen und entdecken wollen, andere wiederum springen ins Auge.
Viele Spuren sind durch Ablagerungen entstanden. An den Wasserausläufen im Gang vor den Garderoben und zum Dampfbad sind die Betonwände vom Ausguss bis zum Boden mit einer Mineralienkruste in schimmernden Braun- und Gelbtönen überzogen. An den Wänden der Badekammern funkeln entlang der Wasseroberfläche kristallene Streifen. Sie sind in jedem Raum unterschiedlich – wahrscheinlich hängt ihre Konsistenz mit Verputz, Temperatur und Zusammensetzung des Wassers zusammen, die in jedem Becken anders sind. In einem Raum wächst der Kalk fein, flammenförmig aus dem Wasser und umrahmt so als filigraner Kranz das Becken.
Auch die Farbe des Verputzes hat einen Einfluss – im 43 Grad heissen, roten Raum erzeugen die gewellten Rinnsale dicht unter der Wasseroberfläche den infernalischen Eindruck von geronnenem Blut. Im Blütenbad haben sich die Minerale unter Wasser über die Jahre in perlmuttartigen Schichten über die Beckenwände gelegt. Je nach Blickwinkel bricht das Wasser das Weiss, das sich zart vom rauen Stein abhebt, unterschiedlich. Über den Sitzstufen im Wasser, wo sich die Besucher an die Wand lehnen, sind die mineralischen Schichten in flachen Ovalen wieder abgetragen. So zeigen sich manche Spuren auch im Fehlen von Material.
Die Wände an den Durchgängen sind von den Gesten der Besucher dort, wo sie berührt werden, leicht speckig. Auf dem Gneisboden um das zentrale Becken zeugen flache Mulden von unzähligen Füssen. Die Abnützungen verlieren sich in der Maserung des Steins und sind eher zu fühlen als zu sehen. Einige der Armaturen und Geländer sind durch den Gebrauch und das Wasser gezeichnet, und unter dem Messing wird das rötliche Kupfer sichtbar.
Die hohe Steinwand im Aussenbad ist von Rissen durchzogen – eigentlich sind sie Ausdruck der Massivität der Mauer und kein Zeichen von Schwäche. Dies zeigt sich auch an der Treppenwand im Aussenbad: Die weissen, flockigen Ausblühungen scheinen buchstäblich aus dem Innern der Steinwände hervorzuquellen – die Stärke des Baus entspringt nicht einer oberflächlichen Schicht, sondern kommt aus der Tiefe des Materials.
Feldkapelle Bruder Klaus, Wachendorf (D) 2001–2007
Die Geschichte der Feldkapelle Bruder Klaus begann bereits vor ihrer physischen Existenz. Peter Zumthor bildet die Entwicklung des Baukörpers auf subtile Art in der Materialisierung ab. Denn das Ringen um den geeigneten Entwurf, der Vorgang des Bauens selbst macht bereits einen starken Teil der Identität des Gebäudes aus. Dies ist sichtbar und spürbar.
Auf freiem Feld stellte der Bauherr mit Freunden zunächst eine Art Köhlerhütte aus 112 Baumstämmen auf. Zwischen glatten Schaltafeln und dem Holzzelt stampften sie Betonschichten ein. Anschliessend brannten sie das Gerüst langsam ab. Zurück blieb im Innenraum die verkohlte Oberfläche des Betons, die bis heute einen Geruch nach Holzfeuer ausströmt. Die gerippte Struktur der Innenwände war im neuen Zustand bereits von Spuren geprägt, die wesentlich für die sinnliche Wahrnehmung des Raums sind. Die vertikalen Stege des grobkörnigen Betons sind rau und ungleichmässig. Tritt der Besucher aus der Helligkeit in den dunklen Raum, stösst er möglicherweise an der geneigten Wand an. Lockere Kieselsteine fallen heraus, oder spitze Kanten schneiden in den Arm. Das von oben einfallende Licht spiegelt sich in einer Pfütze, deren Form der Öffnung im Dach gleicht, denn eine Mulde im Boden wiederholt ihren Umriss. Regenwasser, das über die zentrale Öffnung an den Innenwänden entlang rinnt, erzeugt verschiedene Farben auf dem Beton. Moos wächst in den Furchen, die Sonnenlicht bekommen.
Peter Zumthor hat den Innenraum mit gleicher Intensität entwickelt wie die bauliche Skulptur. Einem umgestülpten Handschuh vergleichbar besteht er zwar aus dem gleichen Material wie die äussere Hülle, überrascht aber mit einer ganz eigenen Form. Die äussere Gestalt lässt keine Rückschlüsse auf den Innenraum zu. Das hoch aufragende Volumen verbindet sich auf eine selbstverständliche Art mit der Landschaft, als wäre es ein Stapel Strohballen. Im Stampfbeton sind rote und gelbe Sande enthalten sowie Flusskiesel der Gegend, sodass er farblich ganz in der Umgebung aufgeht, sich verwurzelt. Die horizontalen Schichten der fünf Aussenflächen zeigen, in welchem Takt der Bau entstanden ist. An den Setzfugen bilden sich je nach Wetterseite Ausblühungen, Risse und Verfärbungen, die sich mit dem Baumaterial verbinden und es auf natürliche Weise beleben.
Durch den Spazierweg über die Felder tragen die Besucher den Lehm an den Sohlen in den Innenraum und bedecken nach und nach die graue Zinnbleischicht am Boden. Hervorzuheben ist, dass die ganze Kapelle nicht aus purem Lehm hergestellt wurde. Die massive Gestalt würde sich mit jedem Regenguss verformen und zum Teil der Landschaft werden und sich damit einer Kontrolle entziehen. Auf ein solches Experiment hätte man sich mit heutigen Erfahrungen im Lehmbau vielleicht eher eingelassen als zur Bauzeit der Kapelle.
Die Abwesenheit des Gerüsts, das als Brandgeruch weiterhin präsent ist, die Wettereinflüsse, die den Innenraum gestalten, ohne dass sie seine schützende Wirkung beeinträchtigen, setzen den Bau in einen zeitlichen Kontext, der vor und zurück reicht. Spuren der vergehenden Zeit sind kaum sichtbar, sondern finden in der gespeicherten Entstehungsgeschichte und der langfristigen Erosion ihren Ausdruck.
Einfachheit, Geschichte und Pflege
Während unserer Recherche sind wir auf wiederkehrende Anhaltspunkte für das qualitätvolle Altern von Zumthors Bauten gestossen. Es beginnt mit dem grossen architektonischen Massstab: Die Baukörper sind durch Kompositionslinien, Material oder Ausrichtung in einem aufmerksamen Verhältnis zur Umgebung und ihren Elementen platziert. Die Kapelle im Sumvitg hat zum Beispiel klar eine dem Wetter zugewandte und eine vor ihm geschützte Seite.
Des Weiteren wird das Material zurückhaltend in seiner rohen Form eingesetzt. Holz, Stein, Leder, Keramik, aber auch Beton sind uns in vielfältigen Zuständen und Formen vertraut. Sie haben ihre Wurzeln in unserer Baukultur. Wir kennen sie von neueren und älteren Bauten – in den Bergen, an der Sonne, an einer Verkehrsachse, in einem Schlosshof. Sie flossen mit der Zeit in das kollektive Materialvokabular ein. Die Poesie der Stoffe tritt unverfälscht in Erscheinung. Diese Echtheit erweckt ein instinktives Vertrauen, manchmal sogar das Verlangen, das Material zu schützen. Ein künstlicher, heterogener Baustoff kann diese Verbindung in den meisten Fällen nicht herstellen, da er in unserer Zeitmessung keine Geschichte hat und laufend durch neue Materialien ersetzt wird – es ist also nicht abschätzbar, wie er nach einigen Jahren aussehen wird.
Ähnlich reduziert wie das Material sind die konstruktiven Details bei Zumthors Bauten. Die Fassade am Kunsthaus Bregenz oder die Scharniere der Bodenklappe in der Kapelle im Sumvitg unterliegen einer mechanischen Logik, die nachvollziehbar und vertraut ist. Die materielle und konstruktive Einfachheit führt zusammen mit der architektonischen Komposition zur Wahrnehmung des Baukörpers als Ganzes über eine längere Zeitachse.
Die mit dem Planungs- und Bauprozess verbundene zusätzliche Aufmerksamkeit ist oft kostenintensiv. Das hat schon so manche Bauherrschaft verschreckt. Rückblickend bestätigt sich aber die Richtigkeit dieser Haltung. Die besuchten Bauten haben nichts an Funktion oder Erscheinung eingebüsst. Das Bauen ist keine Episode, die mit der Bauübergabe abgeschlossen ist, sondern ein andauernder Prozess: Wenn Material- und Nutzungsanpassungen möglich sind, ohne ins Innerste des Gebäudes einzugreifen, bleibt es ein gültiger Teil des gegenwärtigen Geschehens, ja wächst mit der Veränderung.
Die expressive Präsenz der Häuser, ihre Beziehung zur Baukultur und ihre eigenen ablesbaren Geschichten schaffen die Grundlage für eine starke Identifikation. Ihr nachhaltiger und umfassender Fortbestand hängt massgeblich vom Umgang der Beteiligten beim Herstellen, Pflegen und Benutzen ab. Dies scheint uns die wichtigste Voraussetzung für ihre kontinuierliche Wertschätzung zu sein. Es entstehen Zeitzeugen, deren Ende nicht vorgezeichnet ist.TEC21, Fr., 2019.05.17
17. Mai 2019 Hella Schindel, Danielle Fischer
«Die Dinge in der Zeit verankern»
Eine Qualität, die Peter Zumthors Bauten prägt, ist ihr ästhetisches Alterungsverhalten. Wir haben mit ihm über Architektur gesprochen, die Jahrhunderte überdauert, über die Spuren der Zeit, über natürliche und künstliche Materialien und die Rolle, die der Geschichte beim Bauen zukommt.
TEC21: Herr Zumthor, in der vergangenen Woche haben wir auf einer Tour durch Graubünden, in die Eifel und nach Bregenz einige Ihrer Gebäude besucht. Manche davon sind ja schon zu Ikonen geworden. Die meisten Architekten kennen sie von früheren Besuchen oder zumindest von Fotos. Wir waren neugierig zu sehen, wie sich die Bauten in der langen Zeit seit unseren ersten Besuchen verändert haben. Zu unserer Überraschung sind sie wenig gealtert. Wie beziehen Sie den Alterungsprozess eines Baus in den Entwurf mit ein?
Peter Zumthor: Ich kenne mich einigermassen aus damit, wie man natürliche Baumaterialien behandelt oder eben nicht behandelt. Wie sie altern, das hat mich schon immer interessiert. Stahl, Holz, Beton und Stein – und das sind sie schon, die ich hauptsächlich verwende. Da ist noch Keramik, Ton, Ziegel und gebrannte Ware. Ich arbeite gern mit diesen Dingen. Allein die Hölzer bieten eine grosse Palette. Es ist das Material selber und wie man damit umgeht – ich bin zufrieden, wie sich das jeweils entwickelt. Zum Beispiel das Atelier nebenan ist aus Lärchenholz. Das ist heute so, wie ich es mir beim Entwerfen in den Achtzigerjahren vorgestellt habe: silbrig auf der Nordseite und verbrannt auf der Südseite.
TEC21: Trägt der Alterungsprozess zur Schönheit der Gebäude bei?
Peter Zumthor: Sicher, das ist wie bei den Menschen, die sollen auch schön altern.
TEC21: Was heisst das genau, schön altern? Bei Menschen sagt man doch eher «würdevolles Altern».
Peter Zumthor: Ich glaube, es ist kein Zerfall. Holz, das 300 Jahre in der Sonne ist und schwarz wird, bei dem die weichen Jahresringe ausgewaschen sind und die harten hervorstehen, erhält eine eigenartige Schönheit. Es ist der Abbau von Material, aber er ist tatsächlich würdevoll. Farbe blättert ab, aber Holz tut dies nicht.
TEC21: Kann nicht auch abblätternde Farbe schön aussehen?
Peter Zumthor: Ja, das kann der Fall sein, aber in der Regel vermeide ich Farbe. Ich will nicht, dass man die Gebäude unterhalten muss, ich will, dass sie aus sich heraus schön altern. Bei der Fassade an meinem neuen Atelierhaus gegenüber habe ich zum ersten Mal etwas gemacht, das ganz gut gelungen ist: Um die ersten zehn unansehnlichen Jahre von Natureichenholz zu überbrücken, haben wir das Holz gebeizt und es vorbewittert, wie man es auch vom Zinkblech kennt. Die Beize ist auf Wasserbasis. Sie wäscht sich im Lauf der Jahre heraus, und dieser Prozess überschneidet sich mit dem Alterungsprozess, in dem der typische Grauton der Eiche erscheint.
TEC21: Man kann versuchen, den Alterungsprozess zu verlangsamen oder wie bei der Eiche vorwegzunehmen oder sogar zu verhindern. Wie stehen Sie dazu?
Peter Zumthor: Verhindern will ich die Alterung sicher nicht. Im Übrigen hängt das auch vom Material ab. Die Idee, in den Verwitterungsprozess der Eiche einzugreifen, hängt damit zusammen, dass sie zehn Jahre lang unschön aussieht. Wenn man geduldig ist, gewinnt sie aber ihre Schönheit zurück. Aber Keramik oder Backstein muss man nicht verändern. Das sind von Anfang an perfekte Materialien, die sinnvoll eingesetzt werden können. Da können Sie meine Mutter fragen – in ihrem Haushalt hat sie Materialien immer passend eingesetzt: hier Holz, dort Keramik. Das ist auch in der Architektur das Tolle, dass man die Materialwahl mit dem Gebrauch begründen kann – dann wird es selbstverständlich und schön.
TEC21: Was gefällt Ihnen am Alterungsprozess in Ihrem Privathaus? Werden bestimmte Orte besser als andere, die man erneuern müsste? Gibt es Materialien, über die Sie sich freuen?
Peter Zumthor: Ich bin extrem zufrieden. Gerade hier mit der Stube. Das ist der Schweizer Ahorn, der ist gelb (Tisch), und das an den Wänden und am Boden ist kanadischer Ahorn. Der wird rötlich und dunkler, das ist bewusst so gewählt. Die Oberfläche ist geölt und geseift.
TEC21: Sie arbeiten meist mit natürlichen Materialien – jeder von uns kann sich altes Holz vorstellen oder Stein. Im Gegensatz dazu gibt es keine Langzeiterfahrungen mit modernen hybriden Materialien, von denen man nicht genau weiss, wie sie sich mit den Jahrzehnten verändern.
Peter Zumthor: Ja, das ist so. Andererseits weiss man aber genug über Plastik. Das schwimmt in grossen Mengen im Meer. Dazu will ich nicht auch noch beitragen. Ich habe Mühe damit, dass wir in zehn Generationen unsere biologischen Reserven aufbrauchen, die in Billionen Jahren entstanden sind. In der biologischen Masse ist so viel Energie enthalten. Manchmal komme ich aber nicht drumherum. Die Markise da vorn ist auch ein Gewebe aus Nylon, damit sie Wetter und Licht eine Weile standhält. Klar, man muss in gewissen Fällen Kompromisse eingehen. Das Hexenmemorial in Norwegen, ein zeltartiges Objekt, wollte ich aus richtigem Segeltuch machen. Aber man hat mir gesagt, dass das alle sieben Jahre ersetzt werden müsste. Daraufhin haben wir uns für ein Gewebe aus Nylon mit einer Teflon-Beschichtung entschieden. In diesem Fall mussten wir das so machen, aber ich versuche, den Einsatz solcher Materialien zu minimieren.
TEC21: Ablagerungen und Abtragungen sind zwei verschiedene Altersspuren. In der Therme Vals kann man beide auf eine sinnliche Art spüren, und in der Bruder-Klaus-Kapelle gibt es Spuren von Dingen, die gar nicht mehr da sind. Geruch und Russ vom Verbrennen der inneren Schalung.
Peter Zumthor: Das habe ich mir noch nie so genau überlegt, aber Sie haben recht. Dazu gibt es neben Ablagerungen und Abtragungen noch Verfärbungen. Beim Beton ist es offensichtlich ein chemischer Prozess, durch den das Material sich selbst reinigt und heller wird. Die Wände in meinem Haus waren so dunkel, dass ich deprimiert war, als sie aus der Schalung kamen. Jetzt sind sie hell und werden zusehends noch heller. An anderen Orten bin ich umgekehrt traurig über das Aufhellen. In der Feldkapelle ist ein Mineralisierungsprozess im Gang: Irgendetwas kommt an die Oberfläche, das das Schwarz verdrängt. Der Beton lebt. Er frisst den Russ. Eines Tages wird er nicht mehr da sein. Leider! Das Innere dort war pechschwarz, und so hatte ich es mir gewünscht.
TEC21: Ja, so etwas hat uns auch der technische Leiter vom Kunsthaus Bregenz bestätigt. In einem langsamen Prozess lassen sich die Klebspuren an den Ausstellungswänden abwaschen. Der Rohbeton stösst den Klebstoff immer wieder von innen an die Oberfläche, wo er wiederholt abgespült werden kann, bis er irgendwann ganz verschwindet. Aber dem Terrazzoboden ist offenbar ein Stoff zugeschlagen, der ihn elastisch macht, damit der monolithische Belag nicht reisst. Warum möchten Sie diese Risse, die typisch für Terrazzo sind, nicht zulassen?
Peter Zumthor: Das ist mir neu. Ich wollte das sicher nicht verhindern. Wenn das so ist, dann liegen die Gründe dafür bei der Herstellerfirma. Es gibt ausserdem feine Haarrisse.
TEC21: So rein sind die Baustoffe also manchmal nicht, wie man sich das wünscht?
Peter Zumthor: Nein, das sind aber praktische Aspekte, um zum Beispiel das Arbeiten zu erleichtern. Auch die Gläser der Fassade in Bregenz sind mit Folie zwischen den Scheiben gesichert, die verhindert, dass grosse Stücke herunterfallen könnten – das sind Situationen, wo das Plastik viel kann. Aber das geschieht nicht oft.
TEC21: Im Fall der Fassade am Kunsthaus ist das mit den geklemmten Scheiben geschickt detailliert. So sind keine Bohrlöcher nötig, die eine weitere Angriffsfläche für die Verwitterung der Plastikfolie darstellen würden.
Peter Zumthor: Ja, das wollten wir unbedingt so, dass sie ganz altmodisch aufliegen und nicht gebohrt sind.
TEC21: Ist Ihr Verständnis zum Alter von Material mit Ihren Erfahrungen ein anderes als in früheren Jahren?
Peter Zumthor: Das Altern hat mir immer gefallen. Mit dieser Vorstellung arbeite ich. Hingegen habe ich mich früher gern über fachliche Zusammenhänge hinweggesetzt – wenn ich zum Beispiel ein spezielles Detail haben oder eine bestimmte ästhetische Wirkung erzielen wollte. Im Nachhinein muss ich sagen: Gewisse Dinge sind sinnlos. Zum Beispiel die furnierte Tür hier im Atelier, die ich schon zweimal austauschen musste, und das wäre jetzt schon wieder nötig, denn das Furnierholz blättert ab. Ich musste auch andere Dinge ändern, die ich ein bisschen forciert habe: Da stand auch draussen beim Atelierhaus ein Eichenpfosten mit dem Stirnholz auf einer Metallplatte. Ich habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass er fault. Mein Vater, ein Schreinermeister, hatte immer gesagt, mit Eiche könne man alles machen – was offenbar nicht stimmt. Das nehme ich inzwischen ernster, ich bin sorgfältiger geworden mit den Materialien.
TEC21: Und wie gehen Sie mit wirklichen Schäden an einem Bau um?
Peter Zumthor: Da gibt es kein Patentrezept. Im Kolumba in Köln besteht die Wand aus einem massiven einschaligen Mauerwerk. Nach rund acht Jahren ist auf der Westseite Wasser eingedrungen und innen ein feuchter Fleck entstanden. Der Mörtel war wohl zu fest, sodass es Haarrisse in den Fugen gegeben hat. Der Schlagregen hat dann unter dem Winddruck die Feuchtigkeit hineingedrückt, und im Sommer konnte diese nicht austrocknen. Es hat lang gedauert, eine Lösung zu finden. Jetzt hat der Dombaumeister von der Kathedrale nebenan jede Fuge der ganzen Fassade von Hand oben geschlossen und verspachtelt. Aber das sind die verdeckten Mängel, die Garantiearbeiten, die mit dem eigentlichen Alterungsprozess nicht viel zu tun haben.
TEC21: Gibt es ein Gebäude, das Sie sehr lieben wegen der Art, in der es altert?
Peter Zumthor: Generell finde ich alte Landschaften, alte Kunst, alte Bauten fantastisch – so die Kathedrale in Chur oder das Kloster in Müstair. Ich will auch Teil davon sein und etwas machen, das alt wird – das vor allem schön alt wird. Ich weiss nicht, ob meine Bauten je so alt werden, dass man vergisst, wer sie entworfen und gebaut hat, und nur noch die Arbeit von Menschen darin sieht. Je älter ich werde, desto mehr fasziniert mich diese Einbettung in einen historischen Kontext.
TEC21: Die Geschichte, die ein Gebäude sich einverleibt, ist vielleicht nicht sichtbar – aber ist sie auch eine Spur des Alters?
Peter Zumthor: Ja, es ist schön, einen Tisch zu haben, an dem der Grossvater schon sass. Es ist auch schön, einen Gegenstand oder ein Gebäude zu machen, das immer wieder gebraucht, geändert oder umgebaut wird – und das trotzdem oder gerade deshalb bleibt. Das verbindet mit dem Ort, aus dem man kommt. Das ist nicht so in einer billigen Neubausiedlung, wo alles nach sieben Jahren auseinanderfällt, wo das Plastik von den Decken und Fassaden herunterkommt. Ich will so bauen, dass etwas bleibt – nicht meinetwegen, sondern damit etwas in der Welt bleibt und verschiedene Menschen daran Teil haben können. Das ist wichtig – die Dinge in der Zeit zu verankern.
TEC21: Wie ist das hier in Haldenstein, am Süsswinkel, wo Sie wohnen?
Peter Zumthor: Das ist ein Langzeitprojekt. Meine Familie, meine Freunde und ich besitzen einen grossen Teil der Häuser in der Strasse. Ohne uns wären sie schon lang ersetzt durch pseudohistorische Bauten. Wir betreiben so eine Art Denkmalpflege durch Besitz. Jetzt will das Bauamt überall die Strassen erneuern. Sie haben oben im Dorf angefangen und Randsteine angebracht – klar abgegrenzte Trottoirs gegen die Strasse, hier gehen, dort fahren. Da sind einige von uns vom Süsswinkel zur Gemeindepräsidentin gegangen und haben gesagt, dass wir uns etwas anderes wünschen: Traditionell läuft bei uns der öffentliche Raum über die Strasse bis an die Türschwelle. Der Unterschied zwischen öffentlichem und privatem Grund ist nicht sichtbar. Sie hat das zur Kenntnis genommen, und jetzt gibt es eine Wohnstrasse, so sind wir mit einem modernen Wort wieder beim alten Konzept.
[Das Interview führten Danielle Fischer und Hella Schindel im April 2019 in Peter Zumthors Wohnhaus in Haldenstein.]TEC21, Fr., 2019.05.17
17. Mai 2019 Danielle Fischer, Hella Schindel