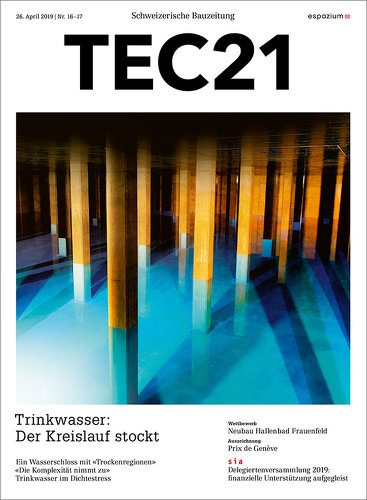Editorial
Wie viel Wasser verbraucht eine Schweizerin oder ein Schweizer jeden Tag? 160 Liter! Der Konsum sinkt seit Jahren leicht, in Haushalten und im Gewerbe. Das Bevölkerungswachstum wird die künftige Nachfrage trotzdem steigern.
Um wie viel höher ist die Umweltbelastung von Mineralwasser, verglichen mit sauberem Trinkwasser? Um den Faktor 500!
Wie viel Geld spart die öffentliche Hand, weil für die Gewinnung von Trinkwasser natürlich gereinigtes Grundwasser zur Verfügung steht? Mindestens 10 Millionen Franken jährlich würde es mehr kosten, müsste der Grossteil des Wassers technisch aufbereitet werden, Investitionen nicht eingerechnet.
Wie viele Trinkwasserfassungen hat der Kanton Bern in den letzten Jahren geschlossen? Über 300! Vornehmlich, weil die unmittelbare Nachbarschaft derart überbaut ist, dass das Risiko einer Verschmutzung zu gross geworden ist.
Was macht der Klimawandel mit den Grundwasserressourcen? Hydrologen gehen von einer Reduktion regionaler Volumen um bis 20 % aus.
Wie lang braucht ein Grundwasserpegel, um sich von einem Trockenjahr zu erholen? Bis zu neun Jahre – bei normalen Niederschlagsverhältnissen.
Es ist Zeit, dass man bei der Schweizer Trinkwasserversorgung über die Bücher geht. Davon handelt diese Ausgabe.
Paul Knüsel
Inhalt
03 EDITORIAL
07 WETTBEWERB
Ausschreibungen/Preise | Leichte Brise
10 AUSZEICHNUNG
«Das Experimentieren hat sich in den Designprozess der Architektur verlagert»
12 WEITERBILDUNG
2000-Watt-Areale
13 VITRINE
Hochwasserschutz
14 ESPAZIUM
Aus unserem Verlag
15 STELLENMARKT
16 SIA
Finanzielle Unterstützung aufgegleist
19 AGENDA
20 TRINKWASSER: DER KREISLAUF STOCKT
20 EIN WASSERSCHLOSS MIT «TROCKENREGIONEN»
Paul Knüsel
Der Klimawandel und eine teilweise isolierte Wasserinfrastruktur gefährden die Versorgungssicherheit.
23 «DIE KOMPLEXITÄT NIMMT ZU»
Judit Solt
Fachleute aus Verwaltung, Praxis und Forschung erörtern die künftigen Herausforderungen im öffentlichen Wassermanagement.
27 TRINKWASSER IM DICHTESTRESS
Paul Knüsel
Grund- und Quellwasserfassungen benötigen einen räumlichen Schutz. Doch viele Gemeinden passen zu wenig darauf auf. Der Kanton Solothurn geht bei der Bereinigung mit gutem Beispiel voran.
30 STELLENMARKT
37 IMPRESSUM
38 UNVORHERGESEHENES
«Die Komplexität nimmt zu»
Grundwasser wird als Trink- und Brauchwasser und als Energiequelle zum Heizen oder Kühlen genutzt. In dicht besiedelten Gebieten ist die Bewirtschaftung deshalb anspruchsvoll. Welche Herausforderungen sind künftig zu bewältigen? Ein Gespräch mit Exponenten aus Verwaltung, Industrie, Planung und Forschung.
TEC21: Das Projekt «Sichere Wasserversorgung 2025» des Bundesamts für Umwelt zeigt, dass in der Schweiz trotz Klimawandel in Zukunft genügend Wasser vorhanden sein wird, um den Bedarf an Trink-, Brauch- und Löschwasser zu decken. Voraussetzungen sind eine nachhaltige Nutzung und umsichtige Verteilung des Wassers sowie die Erhöhung der Versorgungssicherheit – ein kluges Management also. Doch die Schweiz ist kleinräumig organisiert; es gibt über 2500 Trinkwasserversorgungen, vielerorts fehlen redundante Systeme ebenso wie geomorphologische und hydrologische Inventare. Was gibt es da zu tun?
Max Maurer: Die Nachteile der kleinräumigen Organisation sind offensichtlich. Die föderalistische Schweiz delegiert viele Aufgaben nach unten, was bei übergeordneten Themen schwierig ist. Die Planung von Schutzzonen beispielsweise tangiert Gemeindekompetenzen. Und die Fragmentierung führt oft dazu, dass Akteure, die primär strategische Entscheide fällen sollten, stattdessen operative Aufgaben im Infrastrukturmanagement übernehmen. Gleichzeitig fehlt ihnen die Kompetenz dafür. Trotzdem hat die Kleinräumigkeit auch Vorteile: Sie bietet eine starke Identifikation, und die Wasserversorgung ist dank Freiwilligenarbeit und lokal angepassten Lösungen teilweise sehr günstig.
Felix Finardi: Ein weiterer Vorteil ist, dass Pannen überschaubar bleiben. Wenn es irgendwo hapert, kann man die wenigen Betroffenen notfalls via Tankwagen versorgen. Und wenn Betriebe die Planung und den Unterhalt ihrer Infrastrukturen vernachlässigen, wenn ein Brunnen versandet oder eine Leitung bricht, dann lässt sich der Schaden beheben. Das ist teuer, aber möglich.
Wo liegen dann die Herausforderungen?
Finardi: Das wirkliche Problem sind die Schutzzonen. Wenn Gemeinden ihre Schutzzonen aufheben, die Böden versiegelt werden und das Wasser nicht mehr versickert, ist die Trinkwasserfassung gefährdet. Land ist eine knappe Ressource. Es braucht dringend Gesetze, die den Gemeinden «top down» verordnen, die für ihre Trinkwasserversorgung nötigen Gebiete zu schützen. Grundwasserschutzzonen, die überbaut wurden, sind für immer verloren.
Maurer: Die gesetzlichen Grundlagen sind da. Der Schutz des Grundwassers geniesst in der Schweiz einen hohen Stellenwert. Das Problem ist die Umsetzung: Hier beginnt eine Grauzone, in der es zu Güterabwägungen kommt. Um die Ressource Grundwasser zu schützen, kann man praktisch jede Massnahme juristisch begründen, aber bei radikalen Eingriffen wie Enteignungen ist man zurückhaltend.
Mit wachsender Bevölkerung steigt auch der Nutzungsdruck: Es gibt Zielkonflikte zwischen Siedlungspolitik, Naturschutz, Landwirtschaft und Industrie. Und verschärft nicht auch der Klimawandel die Verknappung der Ressource Wasser?
Matthias Nabholz: Trotz Klimawandel ist nicht das Wasser, sondern das Land in der Schweiz die knappe Ressource. Im Kanton Basel-Stadt ist das Problem besonders akut: Auf nur gerade 37 km² gilt es, Trinkwasser für die Menschen und Brauchwasser für die Industrie bereitzustellen. Der steigende Nutzungsdruck erfordert weiter reichende Konzepte, zum Beispiel für die Nutzung des Grundwassers. Bisher hat man recht unbekümmert unbefristete Rechte vergeben; nun erstellt der Kanton ein Nutzungskonzept. Das Grundwasser gehört gewissermassen allen, aber die Rechte sind nicht abschliessend geregelt. Das führt zu Nutzungskonflikten.
Nach welchen Kriterien lösen Sie solche Konflikte?
Nabholz: Ein Patentrezept haben wir nicht. Wir gehen interdisziplinär vor und eruieren, wie sich die Bedürfnisse entwickeln. Bei der Vergabe von Nutzungsrechten braucht es langfristige Szenarien und genug Flexibilität, um auf zukünftige Bedürfnisse zu reagieren. Trotzdem müssen Nutzungsrechte eine gewisse Laufzeit haben, damit der Investitionsschutz gewährleistet ist.
Michel Walker: Die interdisziplinäre Betrachtung ist zweifellos richtig. Doch die grosse Anzahl von Beteiligten macht Planern zu schaffen. Nur schon im Amt für Umwelt gibt es Spezialisten für Gewässer, Grundwasserschutz oder Abwasser, die unterschiedliche Ansprüche haben. Klare Vorgaben für die Planung gibt es nicht; wir machen einen ersten Entwurf, den die Behörden im Rahmen einer Güterabwägung diskutieren. Daraus ergibt sich der Handlungsspielraum, in dem wir bei der Überarbeitung des Projekts agieren können. Diesen Prozess zu planen ist nicht möglich.
Finardi: Schwierig ist es auch, wenn sich die Randbedingungen unerwartet ändern. Ein Beispiel: Vor 14 Jahren hat die Novartis entschieden, ein Werksareal mit dem Wasserverbrauch einer Kleinstadt in einen Campus für Entwicklung und Forschung zu verwandeln. Man hat 2 Mrd. Franken in die Umnutzung investiert und für die Neubauten ein Wassernutzungskonzept entwickelt. Trinkwasser wurde möglichst nur im Hygiene- und Pharmabereich eingesetzt; damit wurde der Verbrauch halbiert. Die technischen Kreisläufe sollten mit Fabrikwasser betrieben werden, das dem Rhein entnommen wurde und etwa bei der direkten Kühlung und in Hybridtürmen bei der indirekten Kühlung zum Einsatz kam. Das ermöglichte enorme Energieeinsparungen, weil Laborbauten und industriell genutzte Gebäude während der warmen Jahreszeit gekühlt werden. Das Fabrikwasser wurde durch Energieentzug auch zum Heizen mit Wärmepumpen eingesetzt; wenn die Temperatur des Rheins für den Betrieb der Wärmepumpen zu tief war, durften wir in Absprache mit dem Kanton auf Trinkwasser zurückgreifen. Fünf Jahre wurden die Neubauten nach diesem Konzept erstellt. Dann kam ein Hitzesommer, der Rhein war thermisch bis zum Grenzwert belastet, und man durfte von Gesetzes wegen kein Wasser mehr entnehmen. Die folgenden Bauten mussten anders konzipiert werden. Innerhalb eines Projekts haben sich die Randbedingungen komplett geändert.
Das Gewässerschutzgesetz ist nicht neu, es gilt seit 1991. Was hat sich tatsächlich geändert?
Nabholz: In den letzten Jahrzehnten ist die Wassertemperatur im Rhein nicht nur wegen des Klimawandels, sondern vor allem wegen der Nutzung gestiegen: Jedes Atomkraftwerk erwärmt ihn um rund 1 Grad. Wenn die Temperatur eines Gewässers 25 Grad Celsius übersteigt, darf kein Nutzwasser mehr entnommen werden. Das trifft zwar nur selten auf den Rhein zu, in heissen Sommern einige Stunden im Jahr, aber wenn die Industrie deswegen die Produktion abstellen muss, sind die Folgen natürlich massiv. Wir haben uns an den Bund gewandt, damit eine Änderung eingeführt wird und die kantonalen Behörden kurzfristig Ausnahmebewilligungen erteilen können. Die 25-Grad-Grenze ist für die meisten Fliessgewässer sinnvoll, insbesondere für kleine. Aber ein Fluss wie der Rhein führt auch an Hitzetagen genug Wasser. Kein Gesetz kann alle Fälle abdecken, deshalb braucht es für die Umsetzung Ermessensspielraum.
Finardi: Es muss Opportunitäten geben, und es muss möglich sein, über die nachhaltige Nutzung von Ressourcen zu verhandeln. Gemäss Energiestrategie 2050 wollen wir weg von fossilen Energiequellen, und im Wasser steckt Energie, die man zum Heizen oder Kühlen nutzen kann. Ich habe das Campus-Beispiel nicht als Vorwurf erwähnt, die Kooperation mit den Behörden ist gut. Nicht unser Wille zur Zusammenarbeit oder die Kompetenz der Beteiligten setzt Grenzen, sondern dass heute mehr Anforderungen an die Nutzung des Wassers gestellt werden als vor einigen Jahrzehnten. Deshalb ist der Schutz der Ressourcen wichtiger denn je.
Ausnahmebewilligungen mögen schwierige Situationen überbrücken, langfristig braucht es aber Systeme, die auf neue Nutzungsansprüche und die Folgen des Klimawandels reagieren können. Was ist zu tun?
Walker: Veränderte gesetzliche Grundlagen, der Klimawandel und der Nutzungsdruck sind Faktoren, die unsere Arbeit komplexer machen; aber letztlich sind es auch nur Randbedingungen, die wir respektieren müssen. Veränderungen können auch neue Synergien ermöglichen. Das Grundwasser zum Beispiel wird durch die Bauten, die in den Untergrund ragen, und durch die Nutzung als Kühlwasser erwärmt. Stellenweise ist es in Basel-Stadt 16 statt 12 °C warm. Man könnte die Differenz nutzen, um Energie zu gewinnen, und das Wasser dabei wieder auf die natürliche Temperatur abkühlen. Was es dazu braucht, ist eine Diversifizierung der Nutzungen und eine intelligente Koordination – und die bereits erwähnte interdisziplinäre Betrachtung, was die Komplexität erhöht, die Arbeit aber auch interessant macht.
Werden die Aufgaben komplexer, verändert sich auch das Berufsbild der Ingenieurinnen und Ingenieure: Sie sollen nicht nur klar umrissene technische Probleme lösen, sondern in interdisziplinären Prozessen mit einer Vielzahl von Akteuren ganzheitliche Ansätze entwickeln. Werden sie dazu ausgebildet?
Maurer: Ja. Darauf legen wir Wert, in der Ausbildung und in der Forschung. Früher haben Ingenieure ihre Projekte aufgrund von Prognosen gerechnet und gehofft, das Ergebnis würde 30 Jahre funktionieren. Das war schon damals falsch, aber man konnte es ignorieren. Heute ist offensichtlich, dass Flexibilität unabdingbar ist. Es braucht Fachleute, die nicht nur Werte aus einer Tabelle herauslesen und Richtlinien anwenden, sondern in einem komplexen Umfeld mit vielen Faktoren gute Ergebnisse erzielen können. Sie müssen über den eigenen Tellerrand hinausschauen, die Systemgrenze erweitern, Prozesse verstehen und konzeptuell denken. Sie müssen lernen, mit Unsicherheiten umzugehen, mit Szenarien zu arbeiten und zu kommunizieren. Mit diesem Rüstzeug kann sie keine zukünftige Aufgabe abschrecken. Das ist nicht neu, aber wichtiger denn je.
Walker: Ich fühle mich als junger Umweltingenieur bestens gerüstet. Problematisch ist aber, dass viele Entscheidungsträger es nicht sind: Gerade in kleinen Gemeinden haben die beteiligten Akteure nicht immer die nötige Kompetenz, um alle Faktoren zu überblicken und eine qualifizierte Güterabwägung zu machen. Die Gemeinde müsste jemanden anstellen oder mandatieren, um das Dossier aufzubereiten, doch das würde das Budget sprengen.
Womit wir wieder bei der Kleinräumigkeit der Schweiz wären.
Walker: Als Planer habe ich oft die Aufgabe, eine Situation in aller Komplexität darzustellen, aber doch so, dass das Gegenüber versteht, worauf es ankommt. Das ist ziemlich schwierig …
Maurer: … und äusserst wichtig! Leider ist in der Schweiz noch zu wenig anerkannt, dass das Denken eine Leistung ist, die entlohnt werden muss. Ingenieurleistungen nur am Umsatzvolumen zu messen, wie es die heutige Honorarpraxis tut, setzt falsche Anreize. Die Aufgaben sind komplexer geworden; wenn man die Ingenieure nicht für die verbauten Kubikmeter Beton belohnen würde, sondern für flexible und nachhaltige Lösungen, könnte man viel Geld sparen. Das Denken ist wertvoll. Es sollte uns auch etwas wert sein.
Walker: Die Randbedingungen sind so komplex, dass man grössere Projekte nicht im normalen Rahmen eines Auftrags abwickeln kann. Die Beteiligung des Kantons ist unerlässlich, etwa um Daten zu erheben und Projekte zu koordinieren. Ein Wassermanagement auf regionaler Stufe hilft, Redundanzen zu schaffen und die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Die Kantone sollten auch die Gemeinden stärker mit Know-how unterstützen, wie es zum Beispiel Solothurn tut, damit nicht jeder eigene Arbeitswerkzeuge entwickeln muss und die Datenmodelle kompatibel sind. Die Aufgaben sind auch ohne technische Hindernisse anspruchsvoll genug.
[Der Text wurde erstmals im Geschäftsbericht 2018 der Rapp Gruppe veröffentlicht.]TEC21, Fr., 2019.04.26
26. April 2019 Judit Solt