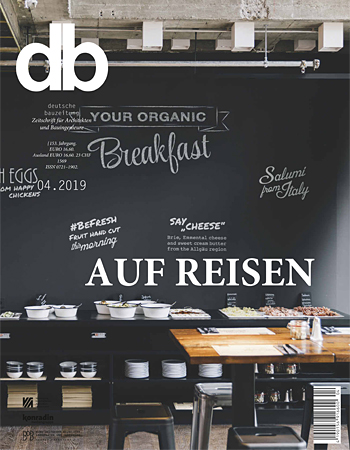Editorial
Ganz im urgermanischen Wortsinne bedeutet der Aufbruch zu einer Reise zunächst einmal die Anstrengung, sich zu erheben, aufzustehen. Weite Fußwege, unkomfortable Verkehrsmittel, mangelhafte Versorgung u. v. m. kosten den Reisenden Energie und Nervenkraft. Entsprechend erwarten wir, dass die Mühen des Wegs dann auch auf verschiedene Weise entlohnt werden und zumindest die Zwischenstationen und Unterkünfte vielerlei Annehmlichkeiten bieten. Auf viele trifft das inzwischen zu, zumal sie sich im bisweilen engen Konkurrenzumfeld keine Nachlässigkeiten leisten können.
Vermochten Hotels einst, mit palastartiger Ausstattung und allerlei Dienstleistungen Begehrlichkeiten zu wecken und Gäste anzulocken, sind heutzutage unterschiedliche Konzepte gefragt – die auf den jeweiligen Ort abgestimmt sind und in der Großstadt mitunter grundlegend anders ausfallen als in den Bergen, an der Küste oder im kleinstädtischen Rahmen.
Wie Architekten und Innenarchitekten auf die jeweilige Umgebung, aber auch auf aktuelle Trends und Gästewünsche reagieren, untersuchen wir in dieser Ausgabe anhand von charismatischen Beispielen, von Low Budget bis Luxus, und erlauben uns auch einen Seitenblick auf die anspruchsvolle Architektur einer Autobahnraststätte. | Achim Geissinger
Ganz schön bunt
(SUBTITLE) The Student Hotel in Dresden
The Student Hotel, eine junge Hotelkette mit außergewöhnlichem Geschäftsmodell und auffällig farbenfrohem Corporate Design spricht gezielt eine junge, studentische Klientel an. Die erste Dependance in Deutschland nutzt einen geschichtsträchtigen Standort – das einstige Interhotel Lilienstein an der Prager Straße in Dresden – und punktet mit erschwinglichen Semesterzimmern und Coworking Spaces in familiärer Atmosphäre.
Die Prager Straße gehört, auch wenn sie nicht gerade als touristisches Highlight gilt, zu den prominenten Adressen der sächsischen Hauptstadt. Das hat sowohl mit ihrer Lage im Stadtgefüge als Verbindung zwischen historischem Zentrum und Hauptbahnhof zu tun als auch mit ihrer bewegten Geschichte: Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt, entwickelte sie sich bald zur wichtigsten Einkaufs- und Vergnügungsstraße Dresdens. Von der gründerzeitlichen Pracht blieb nach dem Bomberangriff vom Februar 1945 kaum mehr als die Erinnerung. Durch die 50er Jahre erstreckten sich beiderseits der Prager Straße riesige Brachflächen.
Städtebauliche Modellanlage
Erst Anfang der 60er Jahre begann die Wiederaufbauplanung. Im Geist der internationalen Nachkriegsmoderne und nach dem Vorbild der »Lijnbaan« in Rotterdam sollte hier die erste Fußgängerzone Ostdeutschlands entstehen, flankiert von Wohnbauten, Geschäften, gastronomischen Einrichtungen und Hotels. Das Herzstück des im Wesentlichen 1965-78 erbauten Ensembles, das als Modell des sozialistischen Städtebaus propagiert wurde, bildete ein zwölfgeschossiges, 250 m langes Wohnhaus, das die Ostseite der Prager Straße einnahm und ein gegenüber platzierter, dreiteiliger Hotelkomplex »in Kammstellung zur Straße«, wie es in einem bauzeitlichen Bericht heißt. Komplementiert wurde das zu DDR-Zeiten unvollendet gebliebene Gebiet durch ein weiteres Hotel, ein Großrestaurant, ein Rundkino sowie ein Zentrum-Warenhaus.
Während sich die Straße in den 70er und 80er Jahren als Flanierboulevard großer Beliebtheit erfreute, wurde das Stadtgebiet nach der Wende aus vielfältigen Gründen sowohl in der Fachwelt als auch in der Öffentlichkeit kritisch bewertet und unter allgemeiner Geringschätzung der Nachkriegsmoderne und der gestalterischen Qualität im Detail v. a. durch die Verengung des Straßenraums nach dem Vorbild der »alten europäischen Stadt« mit austauschbaren Um- und Neubauten stark verändert. Der städtebauliche Kern – die in Plattenbauweise errichteten Hotelbauten und das Wohnhaus »Prager Zeile« – blieb hingegen, wenn auch in veränderter Form, erhalten.
Der 1969 eröffnete Hotel- und Gaststättenkomplex »Interhotel Prager Straße«, der in seinen drei gleichartig gestalteten Bettenhochhäusern (die nach berühmten Felsen im nahegelegenen Elbsandsteingebirge Bastei, Königstein und Lilienstein getauft wurden) insgesamt 918 Zimmer anbot, wird seit 1992 von der Hotelkette Ibis weiter betrieben. Von einer Neumöblierung der Zimmer, einer Modernisierung der Sanitäranlagen und einer 2005 erfolgten Instandsetzung der Fassaden abgesehen, hat sich am Hotelkomplex über die Jahre hin erstaunlich wenig verändert.
Nach mehrfachem Besitzerwechsel aber wurde das Haus Lilienstein 2016 allerdings geschlossen. 2017 ist es von der niederländischen Hotel-Gruppe erworben, dann umgebaut und als »The Student Hotel« neu eröffnet worden – als erstes Haus dieser expandierenden Kette in Deutschland. Die Standortwahl überzeugt durch die Nähe zu Altstadt, Bahnhof und Technischer Universität noch weiter südlich. Von außen betrachtet erscheint das ehemalige Haus Lilienstein – von der auf Betreiben der Denkmalbehörde recht dezenten neuen Beschriftung einmal abgesehen – wenig verändert. Im Innern aber geht es jetzt umso bunter zu.
Neuartiges Geschäftsmodell
»Boutique Hotel trifft Studentenwohnheim« so charakterisiert Charlie MacGregor, Gründer und CEO von The Student Hotel, das grundlegende Konzept der jungen Hotelkette, die 2016 in Amsterdam ihr erstes Haus eröffnete. Was sich als Geschäftsmodell zunächst merkwürdig anhören mag, gewinnt bei näherem Hinsehen an Plausibilität. Die Idee, eine zeitgemäße Unterkunft für Studierende zu schaffen und diese mit einem trendigen Business Hotel zu verbinden, basiert auf der Annahme, dass beide Seiten etwas davon haben.
Das Hotel profitiert vom Flair des studentischen Lebensgefühls, das Studentenwohnheim von den Annehmlichkeiten, die ein Business Hotel heutzutage bieten muss. So lassen sich zentrale Infrastrukturen doppelt nutzen und die höheren Margen des Hotels auf den Gesamtbetrieb umlegen, zumal die Studierenden über Angehörige und Freunde weitere Frequenz bringen.
Als Standorte wählt The Student Hotel, wo immer möglich, gut gelegene Bestandsbauten in angesagten europäischen Großstädten, die mit relativ überschaubarem Aufwand nach Bedürfnissen der Kette umgestaltet werden können. In diesen Städten ist der Immobilienmarkt meist angespannt und hochpreisig – ein denkbar schlechtes Pflaster für Studierende, v. a. für Erstsemester, Austauschstudenten und Ausländer, die die Sprache nicht gut beherrschen, die lokalen Spielregeln nicht kennen und auf kein Netzwerk zurückgreifen können. Für diese seit Jahren wachsende Gruppe hat The Student Hotel ein attraktives Angebot geschnürt: Ein modern und niveauvoll möbliertes Zimmer, gut ausgestattete Gemeinschaftsküche, freien WLAN-Zugang, hauseigenes Fitnessstudio, Waschsalon, ruhige Studierräume, großzügige Loungebereiche, das Versprechen von Community und Sicherheit – ein Faktor, der für die zahlenden, insgeheim besorgten Eltern ins Gewicht fallen dürfte. In Dresden, wo die Wohnungspreise noch recht moderat sind, werden dafür im Monat rund 450 Euro fällig, wobei die Dauer des Aufenthalts, wie in allen Student Hotels, auf zwei Semester begrenzt ist. Die normalen Hotelzimmer sind, je nach Nachfrage, ab 64 Euro zu haben. Um die ökonomische Basis des Hauses zu stärken wurden im 1. OG ein Coworking Space und separat mietbare Seminarräume eingerichtet. Ein Angebot, das in Dresden gut angenommen wird und nebenbei die lokale Verflechtung des Hauses fördern soll.
Bunt und retro
Auf das Branding der Marke und die innenarchitektonische Gestaltung der Häuser hat man bei The Student Hotel von Anfang an größten Wert gelegt. Für beide Aufgaben engagierte man anfangs die Amsterdamer Design-Agentur »...,staat«. Das von ihr erarbeitete Gestaltungskonzept wird mittlerweile von einer hauseigenen Design-Abteilung umgesetzt und weiterentwickelt. Die Marke will jung, frisch und unkonventionell wirken, dabei aber Professionalität und Seriosität ausstrahlen und die Grundpfeiler des Konzepts – »comfort, convenience & community« – auf allen Ebenen transportieren. Angesichts eines begrenzten Budgets setzt man konsequent auf preiswerte, aber effektvolle Gestaltungsmittel. So spielt Farbe sowohl im Erscheinungsbild des Hotels als auch im Interieur, wo sie großflächig und in meist kräftigen Tönen zum Einsatz kommt, eine zentrale Rolle. Die Frische und Lebenslust, die sie transportiert, entspricht dem Selbstverständnis des Hauses und trägt zum informellen Charakter des Ambientes bei. Das vielgestaltige Design des Student Hotels, das deutliche Anleihen bei der Jugendkultur macht, ist als Collage angelegt, als Patchwork aus neu und alt, High und Low, gediegen und improvisiert. Die Möblierung bewegt sich stilistisch, qualitativ und preislich auf gehobenem Ikea-Niveau. Aufgewertet aber wird das Ganze durch die Integration von ausgewähltem Vintage-Design, das einen dezidierten Retro-Charme verbreitet.
Vergebene und genutzte Chancen
Bei der Umgestaltung des Dresdner Hauses ließ man die Zellenstruktur der Zimmergeschosse unangetastet. Eher klein erscheinen daher aus heutiger Perspektive die Zimmer. Aus der Ibis-Ära des Hotels übernahm man die Bäder und die Einbauschränke, wobei letztere durch neue Oberflächen aufgewertet wurden. Das ist, schon aus Gründen der Nachhaltigkeit, verständlich und begrüßenswert. Im EG und im Keller, wo die gemeinschaftlich genutzten Räume liegen, hat man das Haus hingegen bis auf die Tragstruktur entkleidet und grundlegend neu gestaltet. Die größte Herausforderung für die Innenarchitekten bestand darin, das umfangreiche Raumprogramm – Café-Bistro, Rezeption, Lobby-Lounge, Frühstücksraum und Gemeinschaftsküche für die Dauermieter – in den schmalen, langgezogenen Grundriss des Gebäudes einzupassen. Das gelang zwar leidlich, aber da und dort wirken die Räumlichkeiten doch etwas beengt und vollgestopft.
Bei der Gestaltung des Interieurs ließ sich die Design-Abteilung des Hotels nach eigenen Aussagen vom Dresdner Kraftwerk Mitte inspirieren, einem 1994 stillgelegten Kraftwerk, das mittlerweile zum Kulturzentrum umgenutzt wurde. Das kommt recht plakativ in Wandverkleidungen der Lobby zum Ausdruck, die großen Schalttafeln bzw. Kontrollpaneelen nachempfunden wurden. Von einer über ein derartiges Styling hinausgehenden Beschäftigung mit dem Genius loci, der besonderen Geschichte des Standorts oder mit der 60er Jahre-Gestaltung des ehemaligen Interhotels ist nichts zu spüren – vielleicht eine vertane Chance. Erkannt aber haben die Planer von The Student Hotel das Potenzial der Dachterrasse, die anders als bei den baugleichen Nachbarhotels, ab diesem Frühjahr gastronomisch genutzt werden soll. Herrlich und wirklich cool ist der Blick, der sich von dort oben über Dresden und das Umland bietet.db, Do., 2019.04.04
04. April 2019 Mathias Remmele
Verschlankter Luxus
(SUBTITLE) Das Hotelkonzept Ruby u. a. in Hamburg und München
Die Hotelkette Ruby steuert mit ihrer Lean-Luxury-Philosophie auf Erfolgskurs: Sie nutzt dazu zentral gelegene Bestandsbauten und ermöglicht durch Konzentration auf das Wesentliche – ohne Restaurant- und Wellnessangebote – mit flächeneffizienter Raumnutzung, schlanker Organisation, aber hochwertiger Ausstattung eine bezahlbare Form von Luxus für kosten- und stilbewusste Kunden.
Wer im Ruby Lotti absteigt, dem liegt Hamburg buchstäblich zu Füßen. Die Lage könnte kaum besser sein: In unmittelbarer Nachbarschaft finden sich beliebte Gaststätten, aber auch die Einkaufsmeile rund um den Jungfernstieg und die Elbphilharmonie sind bequem per pedes zu erreichen. Seinen Betrieb nahm das Hotel im Herbst 2018 auf. Zuvor hatte das 1993-95 von gmp errichtete Bürogebäude, das sich an den Bleichenfleet anschmiegt und deshalb »Fleetbogen« hieß, als Bürohaus für das Deutsch Japanische Zentrum gedient. Seine Bruttogrundfläche von 10 215 m², verteilt auf sieben Geschosse, bietet Raum für 290 Hotelzimmer – damit ist Ruby Lotti das bislang größte Haus der Ruby-Gruppe.
Gründer und Kopf des Unternehmens ist der Münchener Michael Struck, der 1973 als Kind deutscher Eltern in den USA zur Welt kam, Betriebswirtschaft studierte und in leitenden Funktionen für diverse Hotelgruppen tätig war, bevor er 2013 die Ruby Hotels & Resorts ins Leben rief. Gleich mit dem ersten Hotel, 2014 in Wien eröffnet, bewies Struck einen guten Riecher bei der Wahl des Standorts: Das Ruby Sofie liegt im Seitenflügel der renovierten Sofiensäle, jenes Ende des 19. Jahrhunderts im secessionistischen Stil überformten Veranstaltungszentrums, in dem vor dem verheerenden Brand im Jahre 2001 Popstars von Johann Strauss bis Falco aufgetreten waren. Es folgten mit Ruby Marie im ehemaligen Kaufhaus Stafa und Ruby Lissi in einem denkmalgeschützten Klostergebäude zwei weitere Hotels in Wien. 2017 eröffnete das Ruby Lilly in München, wo auch die Verwaltungszentrale des Unternehmens ansässig ist; 2018 kamen das Ruby Coco nahe der Düsseldorfer Kö und das Hamburger Ruby Lotti hinzu.
In München und Hamburg bietet Ruby zudem Räumlichkeiten fürs Coworking an, die nicht nur von Hotelgästen, sondern auch von Freelancern oder Projektteams vor Ort angemietet werden können. Zehn weitere Hotelprojekte u. a. in Köln, Frankfurt, London, Zürich und Helsinki sind im Bau oder in Bauvorbereitung. Bei der Expansion stehen dem Unternehmen kapitalstarke Partner zur Seite; die österreichische Soravia Gruppe, ein Private-Equity Fonds, der Unternehmer Michael Hehn, ein deutsches Family Office sowie Michael Struck halten gemeinsam die Firmenanteile.
Modular in den Bestand
Statt neue Hotels zu bauen, setzt die Ruby-Gruppe auch weiterhin auf die Umnutzung bestehender Gebäude, wobei die innerstädtische Lage inzwischen zum bestimmenden Kriterium für die Auswahl der Immobilien geworden ist. Man fokussiert sich nicht mehr ausschließlich auf architekturhistorisch interessante Objekte wie in den Anfangsjahren in Wien, sondern investiert auch in mittelprächtige Bürogebäude, sofern sie nur in der Nähe großstädtischer Hotspots liegen.
»Mein Team und ich haben ein modulares Architekturinstrumentarium entwickelt, mit dem wir fast unabhängig von den Grundgegebenheiten eines Gebäudes zu einer sehr flächeneffizienten Nutzung kommen«, erläutert Michael Struck. »Beispielsweise haben wir mehr als 100 verschiedene Zimmergeometrien entwickelt – schlank und lang genauso wie kurz und breit, dreieckig oder L-förmig. Damit können wir die maximale Zahl von Zimmern in den meist feststehenden Grundflächenformen unserer Gebäude unterbringen.« Dank dieser Flächeneffizienz könne man »fast doppelt so viel Umsatz pro Quadratmeter erlösen wie ein konventionelles Hotel«. Zur flächeneffizienten Raumorganisation gehört die Unterbringung der Badfunktionen im Zimmer selbst: Weil man Waschplatz, Duschkabine und WC-Box in den Schlafraum integriert, müssen raumgreifende Nasszellen bei der Grundrissplanung nicht berücksichtigt werden.
Lean Luxury
Die Klugheit, die das Unternehmen bei der Auswahl und beim Ausbau seiner Häuser walten lässt, bildet eine wichtige Voraussetzung für den ökonomischen Erfolg, aber natürlich kommen imagebildende Faktoren hinzu. Zusammenfassen lassen sie sich in dem Markenversprechen »Lean Luxury«, mit der die Ruby-Gruppe ihre Gäste umwirbt. Unter schlankem Luxus versteht Michael Struck »eine Lage im Herzen der Stadt, top Design sowie eine hochwertige Ausstattung in wesentlichen Bereichen – und das zu bezahlbaren Preisen.« Das funktioniere, weil man in den Ruby-Hotels den Luxus nach dem Vorbild moderner Yachten auf relativ kleiner Fläche unterbringe und Unwesentliches einfach weglasse.
Keine Suiten, keine weitläufigen Zimmer mit Minibar und riesigem Bad, keine Tagungsräume, kein Restaurant, kein Spa-Bereich, kein Roomservice – dafür hervorragende Matratzen und Duschen, hochwertiges Mobiliar und ein exzellentes Frühstück in einer coolen Lobby: Dieses, Aufwertung und Verschlankung geschickt kombinierende Konzept hat Michael Struck keineswegs erfunden; bereits seit dem Jahr 2000 beweist etwa der Hotelier Dieter Müller mit seiner inzwischen 71 Häuser umfassenden Low-Budget-Hotelkette Motel One, welche geschäftlichen Potenziale die Strategie »Viel Design für wenig Geld« birgt.
Dennoch ist Ruby keine Kopie von Motel One. Allein das Umnutzungskonzept sorgt bei den Ruby-Häusern für mehr Varianz im Hinblick auf die Größe und Atmosphäre der Räumlichkeiten.
Hinzu kommt ein Interiordesign, das zwar ebenso wie die Konkurrenz auf standardisierte Einrichtungsmodule setzt, aber sehr viel Raum für individuelle Möblierung und Dekoration lässt. In den öffentlichen Bereichen beispielsweise bemüht man sich stets darum, mittels narrativer Gestaltungselemente ein themenbezogenes Lokalkolorit heraufzubeschwören. Wie das konkret aussehen kann, lässt sich beispielsweise im Münchner Ruby Lilly studieren.
Das in einem 1973-75 von Kurt Ackermann am Stiglmaierplatz erbauten ehemaligen Bürogebäude untergebrachte Hotel verfügt über eine doppelgeschossige Lobby mit Galerie. Wände, Decken, Regale sowie Empfangs- und Bartresen der weitläufigen Hotelhalle sind schwarz lackiert, Gitterstrukturen und Profile aus Metall setzen goldfarbene Akzente. Vintagesessel in verschiedenen Größen und Formen beleben das dunkel gehaltene Ambiente. Das übrige Mobiliar ist ein Mix aus klassischen Bistro-Tischen, robusten Holzstühlen, lederbezogenen Bänken und rustikalen Massivholztischen. Beim Dekor haben sich die Gestalter vom Topos der »Münchner Schickeria«, wie man sie aus den Fernsehserien »Monaco Franze« und »Kir Royal« von Helmut Dietl kennt, inspirieren lassen: Von der Decke hängt ein Leuchter aus goldenen Champagnerflaschen; in einem Regal sind Filmkassetten, alte Illustriertentitel und Sektkelche arrangiert; am Eingang steht eine Skulptur aus Röhrenfernsehern, über deren Bildschirme »Monaco Franze« in Endlosschleife flimmert. Nach einer Figur aus dieser Kult-Serie ist denn auch das Hotel benannt: Lilly ist die kurvige Brünette (Michaela May), die der Serienheld (Helmut Fischer) im Fasching anschmachtet.
Vom Nachtschwarz der Lobby und der übrigen öffentlichen Räume heben sich die hellen Hotelzimmer deutlich ab. Dunkel sind hier nur die halbhohen Kirschholzvertäfelungen, ansonsten dominieren lichtgraue Flächen das Ambiente. Zur Standardausstattung gehören lasierte Dielenböden, Textilvorhänge und weiß bezogene Luxusbetten mit 30 cm hohen Taschenfederkernmatratzen. Viele der insgesamt 174 Zimmer bieten dank bodentiefer Fensterfronten einen weiten Panoramablick über München. Zur Auswahl stehen Räume verschiedener Kategorien von »Nest Rooms« (14-15 m²) über »Cosy Rooms« (15-18 m²) und »Lovely Rooms« (18-19 m²) bis hin zu »Wow Rooms« (19-22 m²).
Wenn der Ruby-CEO fordert, die Ausstattung in einem Stadthotel müsse sich auf das Wesentliche fokussieren, so meint er dreierlei: »Schlafen, Duschen und Multimedia.« In punkto Medien haben die Ruby Hotels tatsächlich einiges zu bieten: Jedes Zimmer ist mit einem 42’’ HD-Fernsehgerät, einem Tablet-PC und einem Smartphone ausgestattet. Letzteres können die Hotelgäste während ihres Aufenthalts auch unterwegs kostenlos nutzen und verfügen dabei über ein unbegrenztes Daten- und Gesprächsguthaben. Damit nicht genug: Auf jedem Zimmer stehen kleine Marshall-Verstärker für spontane Jam Sessions bereit, die E-Gitarren dazu kann man sich kostenfrei am Empfang ausleihen. Nicht der schlechteste Grund, einmal eine Nacht in einem Ruby-Hotel zu verbringen – für ca. 90 Euro aufwärts.db, Do., 2019.04.04
04. April 2019 Klaus Meyer
Zwischenstand
(SUBTITLE) Hotel Kitz in Metzingen
Das unauflösbare Spannungsfeld zwischen Altstadtflair und Outletlandschaft, zwischen Platzmangel und Verwertungsdruck wurde zum zentralen Thema des kleinen Boutique-Hotels erhoben. Die Bauformen schaffen sowohl Ausgleich als auch individuellen Ausdruck – an einem Ort, der mit vielerlei Unentschiedenheiten und Spannungen zu kämpfen hat.
Wer will denn in Metzingen übernachten? Eine legitime Frage insofern als Metzingen, wie ungezählte andere schwäbische Klein- und Mittelstädte auch, keine wirklichen Attraktionen zu bieten hat. Zudem hat der Ort das Pech, bei jeglicher Betrachtung immer zwischen den Polen zu stehen: Zwischen Landeshauptstadt und Schwäbischer Alb gelegen darf es sich nicht mehr zur Region Stuttgart zählen, kann aber auch noch nicht mit direktem Naturerlebnis punkten. Er rangiert zwischen wirtschaftlich stark und protestantisch bescheiden, wirkt herausgeputzt, bisweilen aber auch bedauernswert banal.
Aber: Metzingen hat Tradition in der Textilfabrikation und entwickelte sich in den letzten Dekaden zu einem der bekanntesten Outletstandorte in Deutschland. Derzeit werden jährlich etwa 4 Mio. Besucher gezählt – man rechnet künftig mit 7, sobald das neue, in Bau befindliche Outletcenter des örtlichen Platzhirschs Hugo Boss eröffnet sein wird.
Die Schnäppchenjäger strömen über Tag aus allen Richtungen, reisen nach getanem Waidwerk allerdings sofort wieder ab. Für die wenigen, die dennoch ihr müdes Haupt im Ort betten wollen, v. a. aber für Mitarbeiter und Geschäftspartner der ansässigen Textil- und Maschinenbaufirmen hat der Gastronom Angelo Procopio zunächst sein Restaurant »Achtender« um sieben Fremdenzimmer erweitern lassen. Seine Geschäftsidee trug Früchte und mündete schließlich in den Bau eines kleinen Hotels garni wenige Gehminuten entfernt.
Die Bauaufgabe hatte es in sich: Das Grundstück – der rückwärtig gelegene Restflecken eines größeren Areals, das ein Outletbetreiber nur entlang der hochfrequentierten Hauptstraße bebaute – ist eigentlich zu klein und für einen klaren Baukörper zu unregelmäßig geschnitten.
Das nähere Umfeld in einer vom Trubel abgewandten Altstadtgasse will mit seiner ungleichmäßigen, in Teilen schäbigen Bebauung nicht so recht zu einem frischen Boutique-Hotel passen; die gesammelte Gegensätzlichkeit von glitzerndem Outletgetöse und hausbackenem Altstadtflair scheint unauflösbar. Doch statt in einer lauten Architekturgeste die Befreiung aus diversen Restriktionen und Spannungen zu suchen, nahm das Gespann aus Bauherr und Architekten alle Linien auf und erarbeitete einen Beitrag, der sich ebenfalls klar positioniert – aber eben: dazwischen.
Balancefindung
Der Gebäudekubatur ist schon ein wenig anzumerken, wie stark sie vom Willen zur maximalen Grundstücksausnutzung geprägt ist. Die mächtig aufragenden Dachgauben verleihen der Straßenansicht etwas Hochgeschlossenes und drängen das ortstypische Element, die geneigte Ziegeldachfläche, in den Hintergrund. Die Höhenentwicklung nagt am Ermessensspielraum des Baurechtsamts und setzt schon einmal eine Marke für zukünftige Neubauten in der Nachbarschaft.
Trotz der Baumasse und dem strengen Fassadenraster, das sich über dem schaufensterhaften EG erhebt, ergibt sich aus der Farbe der Lärchenholzläden ein auffallender Bezug zum verklinkerten Nachbargebäude aus dem 19. Jahrhundert. Die Grüntöne der Fassade erscheinen zunächst gewagt, sind aber in der Tat dem Bestand entlehnt; die überstrichenen Klinkerriemchen im EG lassen einen inzwischen verschwundenen Sockel von gegenüber farblich weiterleben.
Letztlich verweist die Farbigkeit aber auf das gastronomische Konzept des Betreibers, der mit allerlei Waldassoziationen spielt und auf sein Stammhaus »Achtender« nun diesen Ableger als »Kitz« folgen ließ.
Formal übt sich das junge Ding in Reduktion: Dachüberstände wollte man sich zugunsten der klaren Geometrie verkneifen. Die tragenden Wände über dem Ortbeton-Keller bestehen aus Hohlwandelementen, dazu Elementdecken mit Aufbeton, die im Innern allesamt sichtbar belassen wurden. Ihren farblichen und konstruktiven Eigenschaften traute man in Bezug auf die Außenansicht dann aber doch nicht über den Weg und entschied sich für konstruktiv weniger Aufwendiges: WDVS.
Im Innern folgt die Ästhetik dem Gedanken des veredelten Rohbaus und zeugt damit von der pragmatischen Vorgehensweise der Architekten: was nicht gebraucht wird wegzulassen. In den scharfen Kontrast aus sauber gearbeiteten Holztüren und Beton-Fertigteilen lassen sich schwäbische Eigenheiten wie der Hang zum Hochwertigen bei gleichzeitiger Verweigerung von Luxus hineinlesen. Freudlos geht es gleichwohl nicht zu. Die seidigen Betonoberflächen verleiten nicht nur Architekten zum Anfassen. Ein riesenhaftes Panoramafenster im Treppenhaus holt den Himmel herein. Durch den Verzicht auf abgehängte Decken bleibt das konstruktive Raster erlebbar und im obersten Geschoss die Dachform spürbar.
Pragmatisch auch die Entscheidung, die Zimmer nicht im dunklen Lärche-Ton der bereits bestellten Türen, Fenster und Klappläden auszustatten, sondern alle Wände aus Sperrholz mit heller Birkenoberfläche zu bekleiden und lieber das Nebeneinander zweier Holzfarben auszuhalten als die ohnehin äußerst knapp bemessenen Räume in schwerer Holzoptik ertrinken zu lassen.
Die 23 Zimmer (zwei davon barrierefrei, vier davon Suiten unterm Dach mit Ausziehcouch und somit bis zu vier Schlafplätzen) haben mit ihren schallharten Oberflächen ohne Teppich oder plüschige Möbel eine eigentümliche, dabei aber keineswegs unangenehme Hörsamkeit. Zwischen Fertigteildecke und geschliffenem Zementestrich wirken sie, nicht zuletzt wegen der ausgeprägten Schattenfugen, wie in den Rohbau eingestellte Boxen – im Grunde sind sie das ja auch; alle Trenn- sind Trockenbauwände.
Viel Stauraum gibt es nicht, schmale Einbauschränke links und rechts der Bettnische müssen reichen – dazu als Kleiderhaken einzelne Holzrundstäbe in den Wänden und ein aus der Wand auszuklappendes Tischchen.
Gute Stube
Was an Platz und Aufenthaltsmöglichkeiten in den Zimmern fehlt, macht der weitläufige, über die gesamte Gebäudebreite reichende Gemeinschaftsraum im EG wett. Als Herz des Hauses vereint er die Funktionen von Rezeption, Lobby, Frühstücksbereich, Bar und Lounge. Die Innenarchitektin Monika Hesprich hat ihn mit stark farbigen Kelims und unterschiedlich hohen Tischen mehrfach in Wohn- und Essbereiche unterteilt und sich bei der Farb- und Formenauswahl subtil von Heimatklischees der 50er Jahre leiten lassen – und das Motiv der Waldidylle und Jägernostalgie glücklicherweise ebenso wenig überstrapaziert wie die Architekten.
Der deutlichste Auswuchs davon ist ein wandhohes Textilbild mit Blattwerk und Waldtieren, das Wohnzimmeratmosphäre schafft. Dazu tragen auch die voluminösen, unterschiedlich getönten Kristallgasleuchten in geometrischen Grundformen bei, deren Unregelmäßigkeiten im Material ihre handwerkliche Herstellung erkennen lassen – ein Prinzip, das sich durch das ganze Haus zieht: eine gewisse Ablesbarkeit und Wertschätzung der handwerklichen Prozesse.
Weniger deutlich fällt die Assoziationskette aus, die von den Absturzsicherungen vor den französischen Fenstern zur Badgestaltung führt: Das diagonal eingefügte Gitter lässt an den Drahtzaun eines Wildgeheges denken. Diagonal verlegt sind folglich die Akustikdämmplatten der Lobby-Untersicht, die tannengrünen Fliesen am und hinter dem Bartresen, die Badfliesen und selbst der Pflasterbelag im Außenbereich.
Die Architekten sind froh, dass verschiedene Einsparungen im Roh- und Ausbau nicht vom Bauherrn einbehalten, sondern in die Qualität der Einrichtung gesteckt wurden. Aufseiten der Technik hat man sich einiges verkniffen – so ist allein der Gemeinschaftsraum zusätzlich zur Fußbodenheizung (per Gastherme und Solarthermie) mit temperierter Belüftung ausgestattet, die Zimmerbäder werden ohne Wärmerückgewinnung entlüftet (Hersteller ästhetisch ansprechender Fensterfalzlüfter mögen sich bitte beim Architekten melden!).
Fahrt aufnehmen
Durch den stetigen Zuzug weiterer Outlets erlebt Metzingen immer wieder neue Entwicklungsschübe. Die etablierten Outletquartiere, die sich auf ehemaligen Industriearealen ausgebreitet haben, punkten inzwischen mit städtischen Plätzen und kurzen autofreien Straßenzügen. Die Stadt versucht mit einer aufgehübschten, für kleinere Läden des täglichen Bedarfs interessant gemachten Fußgängerzone, dem etwas entgegenzusetzen. Doch die parallel verlaufende Pfleghofstraße wirkt von der Hotellobby aus immer noch so, als würden abends die Bürgersteige hochgeklappt.
Es ist dem Ort nicht zu wünschen, dass seine Bebauung neue Höhenmarken erklimmt oder zum Träger architektonischer Duftmarken verkommt – was an einzelnen Stellen schon zu lautstarken Störungen im Stadtbild geführt hat. Mut machen aber ein paar wenige architektonische Glanzstücke, die mit Einfühlung und ohne Anbiederung die richtige Richtung weisen. Wenn man also Bauherren und Architekten gewinnt, die im gemeinsamen Aushandeln die örtlichen Gegebenheiten zu nutzen und zu transformieren verstehen, dann kann aus dem ärmlichen Weinbauerndorf ein schmuckes Städtchen werden. Ein kleiner Baustein dazu ist das »Kitz«, dessen Betreiber mit seinen Architekten schräg gegenüber schon das nächste Projekt plant.db, Do., 2019.04.04
04. April 2019 Achim Geissinger