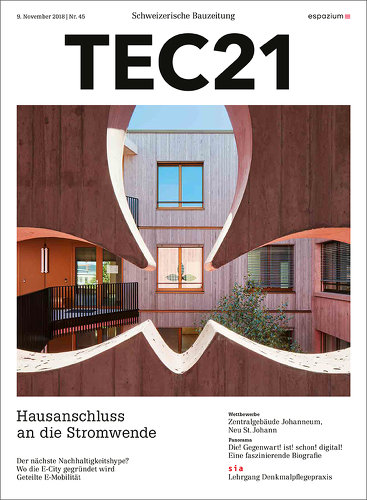Editorial
Nein, es ist nicht der Schweinebauchinserate wegen. So nannte man früher die grossen und bunten Anzeigen der Detailhändler, die die Leserschaft aller Tages- und Wochenzeitungen auf die Wochenaktionen aufmerksam machten. Inzwischen sind diese Werbeseiten aus dem Blätterwald fast verschwunden; einzig die Autobranche sichert mit grosszügiger Werbung die Budgets vieler Printverlage. Wäre der Versuch also nicht auch für eine Bauzeitung lohnenswert, sich deren lukrative Inserate anzulachen? Doch nein, das ist nicht der Grund, weshalb diese Ausgabe die Elektromobilität thematisiert.
Es geht vielmehr um Chancen und Risiken einer klimafreundlichen, dezentralen Energiezukunft. An Häuser mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach oder an der Fassade hat man sich gewöhnt. Auch daran, dass der eigene Strom möglichst für Wärmepumpe, Beleuchtung, Backofen oder Computer vor Ort konsumiert werden soll. Neu ist hingegen, dass das Elektroauto als eine Puffer- und Speichervariante frei Haus geliefert wird: Die Batterie gleicht Lücken zwischen Produktion und Verbrauch aus.
In der Planung energieproduzierender Areale wird die interne Vernetzung also wichtiger: So eng wie nie zuvor müssen der Betrieb einer Immobilie und derjenige eines mobilen Vehikels aneinandergekoppelt werden.
Es sind Eigenverbrauchsgemeinschaften, die solche Modelle erproben. Diese werden seit Anfang Jahr vom Bund gefördert. Es geht also auch um Aktualität.
Paul Knüsel
Inhalt
AKTUELL
07 WETTBEWERBE
Ausschreibungen/Preis | Offen, nicht ausgestellt
12 PANORAMA
Die! Gegenwart! ist! schon! digital! | Eine faszinierende Biografie
15 ESPAZIUM – AUS UNSERERM VERLAG
Stadt aus Holz
16 VITRINE
Aktuelles aus der Baubranche
18 SIA
Lehrgang Denkmalpflegepraxis | Die Zukunft heisst BIM
21 VERANSTALTUNGEN
THEMA
22 HAUSANSCHLUSS AN DIE STROMWENDE
22 DER NÄCHSTE NACHHALTIGKEITSHYPE?
Paul Knüsel
Eigenverbrauchsmodelle als Schritt zu dezentralen Energiesystemen im Siedlungsraum: Chancen und Risiken.
24 WO DIE E-CITY GEGRÜNDET WIRD
Daniela Hochradl, Paul Knüsel
Zwei Eigenverbrauchsgemeinschaften in Basel und Zürich im Porträt.
27
GETEILTE E-MOBILITÄT
Daniela Dietsche
Batterien von Elektrofahrzeugen mit dem Energiemanagementsystem eines Areals verknüpfen: ein Pilotprojekt.
AUSKLANG
32 STELLENINSERATE
37 IMPRESSUM
38 UNVORHERGESEHENES
Wo die E-City gegründet wird
Wer bislang einfach Häuser bauen liess, kann sich nun auch um die Infrastruktur für die dezentrale Stromversorgung kümmern. Verdrängen Immobilieninvestoren die Energieversorger? Oder tauchen neue Intermediäre auf?
Im Basler Neubauquartier Erlenmatt Ost formiert sich die bislang grösste Solarstrom-Eigenverbrauchsgemeinschaft der Schweiz. Im Endausbau, in drei bis vier Jahren, sollen rund 630 Bewohner einen grossen Teil ihres Energiebedarfs direkt von den eigenen Dächern beziehen. Auf insgesamt zwölf Mehrfamilienhäusern, die verschiedenen Stiftungen, Genossenschaften und Hausgemeinschaften gehören (vgl. «Energie- und Soziallabor Erlenmatt Ost»), erzeugen Photovoltaikanlagen den dafür erforderlichen Solarstrom. Letzten Sommer begann der Bezug des östlichen Erlenmatt-Areals; inzwischen ist ein Drittel des Gesamtvolumens realisiert.
Im Gleichschritt wird die interne Energieversorgung auf maximale Leistung (750 kWp) und auf künftige Jahreserträge von etwa 750 000 kWh Strom ausgebaut. Über ein Jahr bilanziert soll die Produktionsmenge etwa 40 % des Bedarfs vor Ort abdecken; möglichst viel des eigenen Ertrags ist selbst zu konsumieren, ohne Lieferumweg über das öffentliche Stromnetz (vgl. «ZEV: Eigenverbrauch oder Selbstversorgung?», Kasten unten).
Bisher lassen sich Produktion und Konsum von Solarstrom in Erlenmatt Ost zeitlich gut aufeinander abstimmen: Aktuell werden nur knapp 20 % exportiert; mit dem weiteren Ausbau der Überbauung und der Solaranlagen wird sich dieser Exportanteil aber wohl verdoppeln. Das ist die Krux für viele Eigenverbrauchsgemeinschaften: Allein mit der Erhöhung des selbst erzeugten Stromertrags schwindet der Anteil des Selbstkonsums, ausser man ergänzt das lokale Versorgungssystem mit einem Speicher, entweder in einzelnen Gebäuden oder durch ein Andocken an die Elektromobilität (vgl. «Geteilte E-Mobilität»).
Bei PV-Anlagen in Einfamilienhäusern, die tagsüber wenig Strom verbrauchen, lassen sich in der Regel Eigenverbrauchsquoten unter 30 % erreichen. Wird zusätzlich eine Wärmepumpe als Heizsystem betrieben, lässt sich dieser Anteil auf etwa 50 % steigern. Zur weitergehenden Optimierung sind Batteriespeicher erforderlich, die den Tagesertrag für den Konsum am Abend und in der Nacht verfügbar machen.
Netztechnisch und wirtschaftlich sinnvoller wäre aber eine zeitgleiche Stromlieferung an Nachbarn, die allenfalls derselben ZEV-Gemeinschaft angeschlossen sind. In gemischt genutzten Arealen lässt sich die Eigenverbrauchsquote durchaus auf 100 % erhöhen, wenn Wohnsiedlungen mit Gewerbebetrieben energetisch zusammengeschlossen sind. Deren jeweilige Verbrauchsprofile sollten sich dabei zeitlich ergänzen. Ideal sind Abnehmer in unmittelbarer Nachbarschaft, die die selbst erzeugte Energie jeweils in der Überschussperiode verbrauchen können.
Erproben von Komponenten und Systemen
Sowohl die angewandte Energie- und Bauforschung als auch Energieversorger haben in Pilot- und Demonstrationsprojekten begonnen, die dafür benötigten Komponenten, Technologien und Systeme auf der Ebene einzelner Gebäude oder Quartiere zu erproben. Absehbar ist auch, dass neue Marktteilnehmer auftreten und sich neue Wertschöpfungsketten um solche Energiehubs bilden werden. Sie fordern das bisherige Businessmodell der zentral organisierten Energieversorger heraus.
Erkennbar wird dies auch an der Organisation des Eigenverbrauchsmodells in Erlenmatt Ost: Anstelle des städtischen Energieversorgers beliefert eine externe Energiegenossenschaft die Erlenmatt-Bewohner mit Strom. Sie realisiert und betreibt die Solaranlage auf eigenes unternehmerisches Risiko; zudem ist sie auch der lokale Wärmeproduzent, der das gesamte Ostareal mit Energie für die Gebäudeheizung und das Warmwasser versorgt. Daher fliesst der Grossteil des vor Ort erzeugten Solarstroms in deren Wärmezentrale, damit dort die Wärmepumpen angetrieben werden. Die Stromüberschüsse werden an die Bewohner und die Gewerbemieter der Basler Arealüberbauung zu einem günstigen Preis verkauft.
Das Eigenverbrauchsmodell beruht auf einem Gegengeschäft: Weil die Arealgemeinschaft für den Eigenstrom nicht mehr oder sogar weniger bezahlt als für importierten Netzstrom, steht dem Anbieter eine Anschlusspflicht zu. In Erlenmatt Ost lauten die Zahlen: Die Stromlieferantin, die ADEV-Energiegenossenschaft, verrechnete der Eigenverbrauchsgemeinschaft anfangs rund 18 Rp./kWh, was dem Haushaltstarif in der Stadt Basel entspricht. Aber bereits für das laufende Jahr hat der Intermediär den Tarif gesenkt. Um wie viel, kann er erst nach Ablauf des Produktionsjahrs 2018 sagen. Doch die aktuelle Benchmark für dezentral erzeugten Solarstrom liegt schweizweit bei rund 15 Rp./kWh (vgl. «Der nächste Nachhaltigkeitshype?»). Die Bewohner von Erlenmatt Ost konsumieren daher nicht nur klimafreundlichere, sondern auch preisgünstigere Energie als der Durchschnitt der Schweizer Bevölkerung.
Eigenverbrauch bei 100 %
Im Zürcher Stadtkreis 6, beim Schaffhauserplatz, ist eine vergleichbare, etwas kleinere Solarzelle aktiv. Das vom Architekturbüro Viridén + Partner sanierte Mehrfamilienhaus (vgl. «Es blinkt in alle vier Himmelsrichtungen», TEC21 48/2017) ist ebenfalls eine Eigenverbrauchsgemeinschaft. Der eigene Strom wird auf dem Dach und an den vier Gebäudefassaden produziert. Der Anlagenbetreiber ist hier gleichzeitig der Immobilieninvestor.
Das städtische Elektrizitätswerk begleitet dieses Demonstrationsprojekt mit Fokus auf Technik und Netzstabilität. Zu untersuchen ist, wie sich Ertrags- und Einspeiseschwankungen sowie Leistungsspitzen auf die Spannung im Stromnetz des Quartiers auswirken werden. Die Hypothese lautet: Lassen sich die lokalen Einspeise-Peaks im dezentralen Energiesystem optimal steuern, kann auf einen Ausbau der Anschlusskapazitäten verzichtet werden. Die gebäudeintegrierte PV-Anlage im Zürcher Wohnhaus ist für solche Analysen besonders interessant: Die Leistungsgrösse ist im städtischen Umfeld bisher einmalig.
Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) will weitere Erfahrungen sammeln; für die Betriebsperiode 2017/2018 liegt bereits eine Zwischenbilanz vor: Seit Anfang Jahr wird ein 150-kWh-Akkumulator eingesetzt; das Vorjahr liefert die Vergleichswerte ohne Batterie. Dank dem Speicher wurde im Sommer eine Eigenverbrauchsquote von fast 100 % erreicht; im Herbst sank sie auf etwa 60 %. Mit dem Speicher lässt sich der Stromkonsum auf die Nachtstunden für die Warmwasseraufbereitung verschieben. Als Jahresdurchschnitt prognostiziert das ewz etwa 70 %.
Eine weitere Erkenntnis ist: Der Produktionsverlauf am Zürcher Sonnenkraftwerk unterscheidet sich von Gebäuden, die nur auf dem Dach mit Solaranlagen versehen sind. Im Vergleich zur ausschliesslichen Produktion auf dem Dach verschiebt sich die Stromproduktion dank der PV-Fassade um 5 bis 7 % ins Winterhalbjahr. Dies kann den Eigenverbrauch erhöhen. Aber ebenso wäre dann ein Einspeisen der Energie in lokale Verteilnetze interessant. In der kalten Saison wird generell Strom in die Schweiz importiert.
Auch anderenorts führen regionale und kommunale Stromversorger Tests mit Speichersystemen (vgl. TEC21 14–15/2017 «Elektrische Energie speichern») in unterschiedlichen Grössenordnungen durch. Batterien können einem einzelnen Gebäude zugeordnet werden oder einer kleineren Einheit im öffentlichen Verteilnetz, einer ZEV-Gemeinschaft oder einem Quartier. Eine andere Skala hat das Elektrizitätswerk des Kantons Zürich gewählt. Ein 18-MW-Speicher, die grösste Batterie der Schweiz, stabilisiert die Netzspannung und könnte zwei sparsame Haushalte ein Jahr lang mit Strom beliefern.
Eine interessante Speichervariante ist die Kopplung von Gebäude und Elektromobilität (vgl. «Geteilte E-Mobilität»). Sie wird auch im Basler ZEV-Verbund erprobt. Ein Forschungsprojekt, gemeinsam mit Hochschulen, soll zeigen, inwieweit der in Autobatterien gespeicherte Solarstrom nicht nur zum Fahren am Tag eingesetzt werden, sondern auch den Eigenverbrauch der Siedlung abends und in der Nacht erhöhen kann.TEC21, Fr., 2018.11.09
09. November 2018 Daniela Hochradl, Paul Knüsel
Geteilte E-Mobilität
Carsharing, Elektromobilität, Energiemanagement: Im Basler Areal Erlenmatt Ost soll in einem Pilotprojekt alles kombiniert werden. Während der Umsetzungsphase 2019 wird das Projekt wissenschaftlich begleitet, um reale Daten zum Nutzerverhalten oder zur Arealoptimierung zu erhalten.
Heute funktioniert das Laden eines Elektroautos meist noch nach dem einfachen Prinzip: Stecker in die Dose, Ladevorgang startet. Grundsätzlich eignen sich E-Fahrzeuge bzw. deren Batterien aber auch dafür, erneuerbaren Strom aus Photovoltaik oder Windkraft zwischenzuspeichern. Beim sogenannten bidirektionalen Laden wird das Elektroauto durch eine Steuerung intelligent geladen und bei Bedarf entladen (vgl. Abb.). Dadurch könnten Schwankungen im Stromnetz z. B. eines Gebäudes oder Areals ausgeglichen werden.
Hinter dem Projekt OKEE steckt genau dieser Gedanke: die Vernetzung und Optimierung der Bereiche Elektrizität, Wärmeversorgung und Verkehr, eine sogenannte Sektorkopplung zwischen den Sektoren Gebäude und Mobilität. Das Institut für Nachhaltige Entwicklung (INE) der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und novatlantis haben das Projekt auf dem Areal Erlenmatt Ost in Basel initiiert und setzen es in einem Projektkonsortium gemeinsam um. Als Partner beteiligen sich die ADEV-Energiegenossenschaft und die Stiftung Habitat. Sie alle sind an der praktischen Erprobung von Lade- und Eigenverbrauchslösungen für und mit Elektromobilität in grösseren Arealen interessiert, sodass erstmals in der Schweiz ein komplexes Vehicle-to-Home-Pilotprojekt (V2H) mit einem Carsharing-Konzept kombiniert wird.
Derzeit gibt es noch viele technische und organisatorische Hindernisse bei der Umsetzung eines solchen Konzepts. Überhaupt ein geeignetes Areal zu finden war für die Projektverantwortlichen von OKEE eine grosse Herausforderung. Viele Anfragen scheiterten zum Beispiel an unterschiedlichen Planungshorizonten oder an fehlender Innovationsbereitschaft.
Glaubwürdiges Pilotprojekt
Nach intensiver Suche ergab sich der Kontakt zu den Verantwortlichen des Areals Erlenmatt Ost. Es zeigte sich, dass das Areal technisch für die Umsetzung der Sektorkopplung geeignet ist und die Schlüsselpersonen der ADEV-Energiegenossenschaft und der Stiftung Habitat grosses Interesse an diesem Pilotprojekt und der Zusammenarbeit haben. Das Areal Erlenmatt Ost wurde nach den Zielsetzungen der 2000-Watt-Gesellschaft entwickelt. Viele Gebäude entsprechen dem Standard Minergie-P-Eco, und alle sind mit PV-Anlagen auf den Dächern ausgestattet. So wird ein Grossteil des benötigten Stroms vor Ort produziert. Alle Gebäude bilden bereits heute eine Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG) mit ca. 400 Kunden (vgl. «Energie- und Soziallabor Erlenmatt Ost»).
Die Bewohner und Bewohnerinnen verpflichten sich via Mietvertrag zur EVG. Hier gibt es klare Kriterien bezüglich Wohnfläche, Energieverbrauch und Mobilität. Das Quartier ist autoarm, entsprechend rar sind Parkplätze auf dem Gelände oder in der Tiefgarage. Konkret heisst das, pro zehn Wohnungen gibt es einen Parkplatz. Eine gute Ausgangslage, um mit der geteilten E-Mobilität den Nutzern einen Mehrwert anzubieten.
Seit Oktober 2018 steht ein Nissan Leaf in der Tiefgarage auf einem speziell ausgewiesenen Parkplatz und wird über eine bidirektionale Ladesäule mit arealeigenem Strom versorgt. Als eines der wenigen Elektrofahrzeuge beherrscht dieses Auto die Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G). Das heisst, die Batterie, ein 40-kWh-Lithium-Ionen-Akku, kann auch wieder Strom ins Netz einspeisen. Sollte die Stromeigenproduktion auf dem Areal einmal nicht ausreichen, um das Fahrzeug zu laden, wird es vom übergeordneten Netz versorgt. Der Strom in Basel-Stadt stammt ausschliesslich aus erneuerbaren Energien, was für die Glaubwürdigkeit des Pilotprojekts und die Nutzung eines E-Autos zentral ist.
Im Gegensatz zu öffentlichen Carsharing-Modellen können ausschliesslich Personen, die auf dem Areal wohnen oder arbeiten, das Fahrzeug nutzen. Das Auto zu laden ist nicht komplizierter als Kraftstoff zu tanken. Ansonsten gelten die üblichen Regeln im Umgang mit Carsharing. Selbstverständlich muss das Auto rechtzeitig – mit Zeitpuffer zum Aufladen – zurückgebracht und an der Ladestation geparkt werden. Wenn die Batterie «ganz leer» ist, dauert das Laden sechs bis acht Stunden.
Bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von ca. 40 km pro Tag dürften Ladezeiten zwischen drei und vier Stunden täglich ausreichen. Abgerechnet wird nach Mietdauer und gefahrenen Kilometern. Ein bestehendes Buchungs- und Abrechnungssystem wurde an die speziellen Rahmenbedingungen angepasst, sodass die Berechtigten via App oder Homepage das Auto buchen können.
Ab Anfang 2019 können die Bewohner zusätzlich auf einen Siebensitzer bzw. Transporter, einen Nissan Evalia, zurückgreifen, der als zweites Fahrzeug in das Projekt aufgenommen wird. Welches Fahrzeug für die Bewohnerinnen den meisten Nutzen bringen würde, wurde mithilfe einer Online-Umfrage eruiert.
Richtiger Anschluss, passender Stecker?
Bisher sind keine Standardprodukte vorhanden. «Aus ähnlichen Pilotprojekten in anderen Ländern sind keine Standardprodukte hervorgegangen», sagt Anna Roschewitz, Geschäftsführerin von novatlantis und Projektleiterin von OKEE. So exisierten auch immer noch unterschiedliche Systeme bei Steckern und Ladestationen. Bei Neu- und Umbauten empfiehlt es sich daher, an geeigneten Standorten Leerrohre und Fundamente und für allfällige Änderungen genügend Platzreserven einzuplanen. Für eine eventuelle grössere Fahrzeugflotte könnte die Tiefgarage auf dem Areal Erlenmatt Ost mit weiteren bidirektionalen Ladestationen ausgestattet werden.
Daten aus dem Alltag
Das Pilotprojekt wird für ein Jahr wissenschaftlich begleitet. Die realen Pilotdaten stellen – anders als Daten auf Basis von Annahmen – einen Datenschatz dar, um zahlreiche technische und organisatorische Fragen zu beantworten. Offene Fragen haben die Projektpartner viele: Welche Erfahrungen ergeben sich aus der Zusammenarbeit der Beteiligten? Wie sieht das Mobilitätsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer aus? Wann stehen die mobilen Speicher für die Arealoptimierung zur Verfügung? Wie funktioniert die technische Einbindung der beiden bidirektionalen Elektroautos in das Energiemanagementsystem der Überbauung? Wie kann durch eine smarte Ladeplanung und die Beeinflussung des Nutzerverhaltens durch ein Tarifsystem der Eigenverbrauchsanteil erhöht werden? Lassen sich durch die Integration von Elektroautos in das Energiemanagementsystem des Areals neue Geschäftsmodelle identifizieren? Und können diese Erkenntnisse auf andere Areale oder Gemeinden übertragen werden? Welchen übergeordneten Beitrag leistet das Pilotprojekt für weitere Anwendungen in Basel und der Schweiz?
Um die Daten breiter abzustützen und festzustellen, ob und wie sie auf andere Überbauungen übertragbar sind, suchen die Verantwortlichen weitere Areale, in denen das Konzept angewendet werden kann. «Wenn jemand Interesse hat, sind wir gern zu einem Informationsgespräch bereit», betont Anna Roschewitz. Für Arealbetreiber und Eigenverbrauchsgemeinschaften, aber auch schon für Mehrfamilienhäuser könnte die geteilte E-Mobilität durchaus ein interessantes Modell sein.
Eine Übersicht, wie sich elektrische Energie speichern lässt, findet sich in TEC21 14–15/2017.TEC21, Fr., 2018.11.09
09. November 2018 Daniela Dietsche