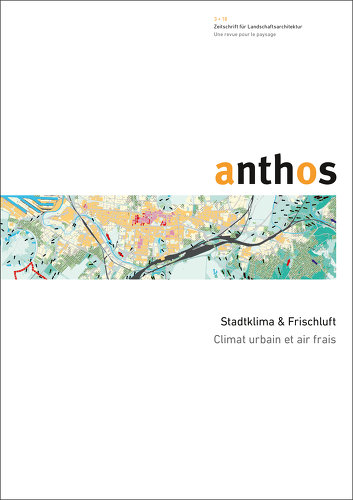Editorial
Anfang der 1980er tauchte, für weite Teile der Bevölkerung unvermittelt, ein Schreckgespenst auf: das Waldsterben. «Saurer Regen», das Schadbild «Storchennest» und Abbildungen devastierter Hänge dominierten die Schlagzeilen über Jahre hinweg. Über Nacht war unser Waldbestand in Gefahr und die Wälder in naher Zukunft grossflächig vom Absterben bedroht.
«In Westdeutschlands Wäldern, warnen Forstexperten, ‹tickt eine Zeitbombe›: Ein großflächiges Tannen- und Fichtensterben ist, wie Fachleute befürchten, erstes Vorzeichen einer weltweiten ‹Umweltkatastrophe von unvorstellbarem Ausmaß›. Denn der Auslöser des stillen Wald-Untergangs, saure Niederschläge aus den Schloten von Kraftwerken und Raffinerien, bedroht nicht nur Flora und Fauna, sondern auch die menschliche Gesundheit», schrieb der Spiegel Ende 1981. In der Folge wurden politische Massnahmen ergriffen, die bis heute in Kraft sind und eine deutliche Verringerung der Emissionen bewirkten.
Vor allem in der Nordschweiz, in Westdeutschland und Österreich hatte die Debatte erhebliche politische, industriepolitische und gesellschaftliche Auswirkungen und gilt als einer der Gründe für den Aufstieg der grünen Parteien. Das Waldsterben war auch nach innen äusserst wirksam: Wir sitzen alle in einem Boot und können uns nur gemeinsam helfen. Quer durch Gesellschaft und Parteienlandschaft gab es einen seltenen Konsens über Dringlichkeit und Relevanz des Themas.
Die Wirkkraft war beachtlich, denn es gelang, andere Themen wie eine bis dato unbekannt hohe Arbeitslosigkeit auf den Spitzenpositionen öffentlicher Aufmerksamkeit abzulösen.
Nehmen wir den heissen Sommer 2018 zum Anlass, erneut ein Umweltthema zuvorderst in unsere Agenden zu setzen: den Klimaschutz. Mit den Schlagworten Stadtklima, urbane Hitzeinseln, Frischluft, Dach- und Fassadenbegrünung, Biodiversität. In den Mittelpunkt stellen wir die Gesundheit des Menschen – das geht uns schliesslich erneut alle an –, als Expert:innen in Diskussion und Umsetzung empfehlen wir LandschaftsarchitektInnen und Stadtklimatolog:innen. Bei der Gründung einer neuen Partei, welche die Ziele umweltpolitisch umsetzt, stehen die Verbände BSLA, BSA und SIA beratend zur Seite. Oder stellen zusammen die neue Partei. Es wäre zum Wohle aller. Und es würde anderen, derzeit dominierenden und polemisch aufgeheizten Diskussionen den Wind aus den Segeln nehmen. Manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn sich Geschichte wiederholt. Und ein kühler Kopf hat auch noch nicht geschadet.
Hinweis: Wir haben eine neue Rubrik! Im heraustrennbaren «Stadtportrait» empfehlen LandschaftsarchitektInnen und Regionalgruppen des BSLA die landschaftsarchitektonischen Höhepunkte für einen Besuch in ihrer Stadt.
Sabine Wolf