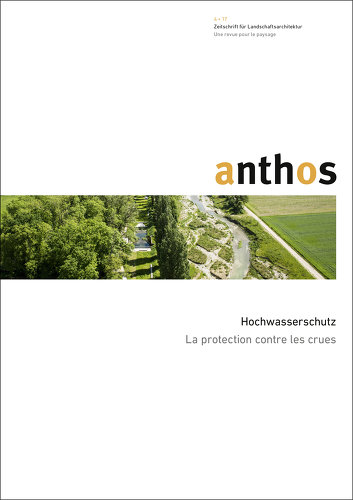Editorial
Manchmal muss Staunen erlaubt sein, auch wenn es vor allem auf Unwissen basiert: Wie die Regentropfen entlang der Wasserscheiden ihren Weg in die Flüsse finden. Wie ein Fliessgewässer Hunderte von Kilometern zurücklegt, um in ein Meer oder in einen See zu münden. Wie Seen und Flüsse ihre Farben wechseln, als hätten sie Charaktere und Stimmungen. Wie Gewässer ober- und auch unterirdisch Kantons- und Landesgrenzen überwinden, unabhängig von der jeweiligen Gesetzgebung.
Und darob, dass es jahrzehnte-, wenn nicht jahrhundertelang dem Fortschritts- und Technikglauben geschuldet blieb, jeden freien Flecken entlang der immer eingeschnürter laufenden Fliessgewässer zu überbauen, das Land zu domestizieren und die Gewässer einzudolen. Und – langsam – die Erkenntnis Allgemeingut wird, dass es anders womöglich einfacher, günstiger, langfristiger und nachhaltiger gegangen wäre und es bei den Flüssen so ist, wie bei den Regentropfen: Das hat mit Physik zu tun, nicht mit Hexerei.
Anfang Oktober wurde der Nobelpreis in Physik an drei US-amerikanische Forscher für die Entdeckung der Gravitationswellen vergeben. Damit sind wir in der Lage, Milliarden von Jahren zurück in die Vergangenheit des Universums zu reisen. Während im Hochwasserschutz mancherorts noch immer erst dann in plumpe Abwehranlagen investiert wird, wenn das Wasser wieder im Anmarsch ist, als wäre es nicht voraussehbar gewesen.
Seit ein paar Jahren, immerhin, ist ein Paradigmenwechsel in Sicht; vom technischen zum integralen Hochwasserschutz. In dessen Zuge entstehen sie doch, die herausragenden grossmassstäblichen und kleineren alltäglichen Projekte. Infrastrukturanlagen, die sich in die Landschaft einbetten und sie neben ihrem technischen Nutzen mit Identität bereichern. Binationale Projekte, die neben Schutz- auch Erholungsziele verfolgen.
Forschungen und Simulationsmodelle an Hochschulen, die mit hoher Präzision Vorhersagen treffen und so auch Menschenleben retten können. Pionierprojekte, die sich geschickt die Erfordernisse und Vorgaben des seit 2011 novellierten Schweizer Gewässerschutzgesetzes zunutze machen – bei dem Experten nach gut sechs Jahren verschiedene verbesserungswürdige Punkte konstatieren – und das Erforderliche mit neuen Möglichkeiten der Finanzierung verknüpfen. Und Projekte, die statt auf künstliche Verbauten auf natürliche Hangsicherung und Massnahmen setzen, die auch ökologisch wirksam sind und teilweise zudem im Rahmen von Umweltbildungsangeboten gemeinschaftlich realisiert werden können.
Das Staunen ist trotzdem noch nicht ganz gewichen.
Sabine Wolf
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
Thomas Weibel: Aqua Viva fordert sinnvollen und ökologischen Hochwasserschutz
Élise Riedo, Marie Sagnières: Hochwasser als Chance für die Landschaft
André Seippel, Silvio Moser, Jörn Heilig: Hochwasserrückhaltebecken Wohlen
Rosmarie Zimmermann, Roger Dürrenmatt: Mehr Raum für die Emme
Laura Hofmann, Thomas Oesch: Gewässerentwicklung mit Ingenieurbiologie
Peter Theiler, Cornelia Bauer: Arbeitshilfe für die Gewässerraumfestlegung
Martin Rein-Cano: Bremen zeigt Kante
Dania Genini: Mehrwert für Bern
Jan Stadelmann: Hochwasserschutz gratis dazu
Markus Beitl, Andrea Cejka: Rhesi: Rhein – Erholung – Sicherheit
Groupement Superpositions: Der fliessende Garten
Florian Hinkelammert-Zens, Isabel Röber, Volker Weitbrecht: Hydraulische Modellversuche
Silke Schmeing: Geburtsstunde einer Insel
Hochwasser als Chance für die Landschaft
Hochwasserschutzmassnahmen bieten einzigartige Möglichkeiten, kohärente, integrative und iterative Landschaftsprojekte umzusetzen. Dafür müssen jedoch zwei Voraussetzungen erfüllt werden: überzeugte Akteure am Verhandlungstisch und Massnahmen, die sorgfältig und ganzheitlich ausgeführt und kommuniziert werden.
Das bis 1991 geltende Paradigma, nach dem konstruktive Hochwasserschutzmassnahmen Vorrang hatten, änderte sich mit dem neuen Bundesgesetz über den Wasserbau BGWB. Die Revision des Gewässerschutzgesetzes im Jahre 2011 zielte auf eine Re-Diversifizierung der Flussbettstrukturen, Ufer und Ufervegetation von Fliessgewässern ab. Eine Förderung durch den Bund erfolgt jedoch – über einen effizienten Hochwasserschutz hinaus – nur, wenn die Bedingungen an die Renaturierung erfüllt sind. Es kommt eher selten vor, dass Themen wie «Freizeit und Erholung» (sanfte Mobilität, Gestaltung des öffentlichen Raums) oder ein «harmonisches Landschaftsbild» in die Entscheidungsfindung über die Vergabe von Subventionen einbezogen werden. Daher sind eine starke Unterstützung und eine hohe Motivation der Bauherren notwendig, um – aus landschaftlicher Sicht – qualitative, ganzheitliche und kohärente Hochwasserschutzprojekte durchzuführen.
Hochwasserschutzprogramme verursachen Folgekosten sowohl aufgrund der Erstellung von komplexen technischen Studien als auch bei der Umsetzung. Solche Projekte «sieht man nicht», sie tragen nicht notwendigerweise zum Ruhm der Planer bei und sie werden überhaupt nur von Eingeweihten wahrgenommen. Die Veranschlagung des Budgetrahmens für die Gemeinden stellt einen wichtigen Meilenstein dar. Dabei sind Projekte zu den Themen der sanften Mobilität und der Gestaltung der Uferlandschaften – beides bei der Vergabe von Subventionen vernachlässigte Stiefkinder – paradoxerweise oft Auslöser und Motivation.
Wie aus notwendigen Projekten Chancen entstehen Es ist von wesentlicher Bedeutung, durch echte Zusammenarbeit aus einem klassischen «notwendigen» Projekt eines zu machen, das durch die Integration der Themen Stadtplanung, Landschaftsplanung und der verschiedenen Formen der sanften Mobilität weitere Möglichkeiten eröffnet. Durch die Bündelung dieser Kompetenzen und der Anwendungsgebiete können die Auflagen für den Hochwasserschutz neu definiert werden. Daraus kann eine gemeinschaftliche und sensible Zusammenarbeit der lokalen Bevölkerung entstehen, mit dem Ziel, die Wasserläufe zu zähmen und dabei die verschiedenen Interessen zu berücksichtigen.
Beispiel Delsberg
In der Stadt Delsberg wurde aufgrund einer Vielzahl von Überschwemmungsrisiken ein Hochwasserschutzprojekt ins Leben gerufen (Masterplan Sorne, 2011). Die Einheitlichkeit des Landschaftskonzepts wird unter anderem durch ein sich wiederholendes Motiv entlang des gesamten Flusslaufs der Sorne gewährleistet, die die Stadt von der einen zur anderen Seite durchfliesst. Eine kleine Wasserkraftanlage wurde bereits in das richtungsweisende Konzept integriert. Anfang 2018 werden neue Fussgängerbrücken und ein Stadtpark, der teilweise überschwemmt werden kann, für die Öffentlichkeit eröffnet.
Durch die maximale Hochwasserlinie ergab sich die Möglichkeit, diesen Park zu entwerfen. Der bei der Verbreiterung des Flussbetts abgetragene Aushub konnte für die Gestaltung des Parks optimal weiterverwendet werden. Sowohl die Kosten als auch die Verschiebung des Materials hielten sich in überschaubaren Grenzen. An verschiedenen Stellen wird übrigens auf die Entstehungsgeschichte des Parks hingewiesen: Grosse, spielerisch gestaltete Behälter mit Kieseln verbessern die Granulatstruktur der Gewässersohle. Ferner wurde als Erinnerung an die Ufervegetation aus den Pflanzen der Gewässersohle eine Wiese angelegt. Auch symbolisieren einige Schwimmbadbecken-Leitern die «potenzielle» Bademöglichkeit im Überschwemmungsfall.
Dieser Masterplan konkretisiert sich von Flussabschnitt zu Flussabschnitt mittlerweile immer weiter und schafft einen echten Mehrwert für die Landschaft, die Lebensräume, den öffentlichen Raum und das Mobilitätsangebot der Gemeinde. Er hat gleichermassen die Techniker, Entscheidungsträger und Nutzer überzeugt, gewährleistet er doch die Sicherheit von Gütern und Personen im Hochwasserfall.
Beispiel Saint-Ursanne
Die Schutzmassnahmen der Stadt Saint-Ursanne gegen Überschwemmungen durch Hochwasser des Flusses Doubs (Masterplan Doubs, 2017) boten ebenfalls die Gelegenheit zur Gestaltung eines Landschaftsparks, der die mittelalterliche Stadt und den Zugang zum Fluss aufwertet. Ein mehrere Kilometer langer Rundwanderweg führt entlang der teilweise naturnah gehaltenen, teilweise landwirtschaftlich genutzten oder eher urbanen Uferbereiche. Dieser Rundweg konnte dank der Hochwasserschutzmassnahmen ermöglicht werden und hat kaum Mehrkosten verursacht.
Sichtbarmachen des Unsichtbaren
Aufgrund der Komplexität der technischen Pläne ist es schwierig, einem Laienpublikum die verschiedenen Aspekte des Projekts detailliert zu vermitteln. 3-D-Animationen, vereinfachte Querschnitte oder aussagekräftige Darstellungen des angestrebten Landschaftsbilds sind unter anderem dazu geeignet, die Vielfalt dieser Projekte zu illustrieren und sie tragen zum Erfolg ihrer verschiedenen Bestandteile bei. Der Ausbau und die partielle Aufweitung des Scheltenbachs im Mündungsbereich in die Birs bei Courroux (Jura) bot zum Beispiel die Gelegenheit, mit einem massstabgetreuen Modell und einem Kurzfilm über das Projekt zu experimentieren. Dessen Ausstrahlung in der Gemeinde und die Veröffentlichung im Internet haben zur Sensibilisierung der Bevölkerung beigetragen und zur Zustimmung des Rahmenkredits geführt.
Hinter dem aus dem Aushubmaterial erbauten Hochwasserschutzdamm befindet sich heute auf der Wiese eine potenziell überschwemmbare Fläche. Hier liegt genau die Herausforderung solcher Hochwasserschutzprojekte: An die nicht sichtbare Dimension überschwemmbarer Gebiete zu erinnern, um zu sensibilisieren, aufzurütteln und zu schützen.anthos, Di., 2017.11.21
21. November 2017 Élise Riedo, Marie Sagnières
Hochwasserrückhaltebecken Wohlen
Wasserrückhalt statt Durchleiten mit Vollausbau der Bünz im Siedlungsgebiet: Das 2017 fertiggestellte Bauwerk beeinflusst mit seiner Dimension das Erscheinungsbild, die Nutzungen und die Erlebbarkeit des sanft modellierten Landschaftsraums zwischen Waltenschwil und Wohlen.
Die Abflusskapazität der Bünz zwischen Wohlen und der Mündung in den Aabach in Wildegg war auf gut zehn Kilometern Fliessstrecke im Siedlungsgebiet ungenügend. So betrug das Schadenspotenzial bei einem hundertjährlichen Ereignis rund 30 Millionen Franken. Gegen 20 Brücken waren zu tief, 200 Hektaren Baugebiet lagen in Überflutungsflächen.
Im Evaluationsprozess für den umfassenden regionalen Hochwasserschutz im Bünztal wurden die drei generellen Prinzipien des Hochwasserschutzes – Durchleitung, Umleitung, Rückhalt – untersucht. Die Umleitung über einen Stollen ins Reusstal und die Durchleitung mit Vollausbau des Gerinnes für ein HQ 1001 in allen Gemeinden wurden aus Kostengründen, der Vollausbau aber auch wegen der grossen Auswirkungen auf die Ortsbilder, verworfen. So stand der Rückhalt als drittes Prinzip im Vordergrund. Insgesamt fünf Beckenstandorte wurden evaluiert und miteinander verglichen. Für die zwei favorisierten Standorte erfolgten im Anschluss vertiefte Studien. Die Wirksamkeit aufgrund der räumlichen Nähe zum grössten Schadenspotenzial und die geringere Überflutungshäufigkeit des Stauraums gaben den Ausschlag für das Becken vor Wohlen.
Grossbauwerk mit partizipativem Entscheid
Mit 590 000 Kubikmetern Stauvolumen ist das Hochwasserrückhaltebecken in der sanft fallenden Ebene zwischen Waltenschwil und Wohlen von grosser landschaftsgestalterischer Relevanz. Vor allem das Dammbauwerk tritt in Erscheinung. Dämme können Anfang und Endpunkt entweder in Hügelkuppen finden, oder sie laufen in sanft modellierten Ebenen langsam aus. In Wohlen liegt aufgrund des Mikroreliefs eine Kombination dieser Prinzipien auf der Hand. Das Variantenstudium zeigte unterschiedliche Dammführungen bei vorgegebenem Rückhaltevolumen auf. Gewählt wurde im Rahmen des partizipativen Verfahrens jene Variante, welche Bautechnik, Zerschnitt von Kulturland, Ästhetik, ökologisches Potenzial, Funktionalität, Potenzial für die Naherholung und Akzeptanz in ein Gleichgewicht brachte.
Die Dammlänge beträgt 850 Meter, die maximale Höhe 3,80 Meter. Der Längsdamm begleitet die Bünz auf der rechten Uferseite. Er steigt langsam an und geht am höchsten Punkt ins Regulierbauwerk über. Damm, Bünz und Ufergehölz vereinen sich in ein räumlich prägendes Landschaftselement. Der Querdamm spannt sich zwischen dem Regulierbauwerk und dem Hügelzug des Rössligutes auf. Sein Abknicken entwickelt sich aus dem Relief des Hügels und der technischen Einbindungsmöglichkeit heraus. Mit der Zuspitzung zum Siedlungsgebiet erscheint der Damm weniger wuchtig in der Ansicht. Wie ein Scharnier zwischen den beiden Dammteilen liegt das Regulierwerk über der Bünz. Das Bauwerk ist als funktionale, zwei Felder aufweisende Betonbaute mit rittlings aufgesetzter Betriebswarte gestaltet.
Damit die Dammhöhe möglichst gering gehalten werden konnte, wurde der Damm für den Überlastfall als vollständig überströmbar konzipiert. Dadurch liessen sich im Vergleich zu einem konventionellen Dammbauwerk mit Dammscharte gut 1,50 bis 2 Meter Höhe einsparen. Die Dammböschungen des Erddammes sind mit Neigungen von 1:4 und 1:3 flach gehalten. Auch die geringere Dammhöhe und die flachen Böschungen verbessern die landschaftliche Einbindung.
Der Einstau des Beckens erfolgt dank einer automatischen Steuerung erst ab einem circa 20-jährlichen Hochwasserereignis. Bis zu einem Volumen von 30,5 Kubikmetern pro Sekunde fliesst die Bünz sicher und ohne Dämpfung durchs Siedlungsgebiet. Dieses Regime ist von Bedeutung, liegt doch mit der Bünzaue in Möriken ein Auenlebensraum, der regelmässige Überflutungen benötigt. Das übersteigende Volumen bis zum HQ 100 von 45 Kubikmetern pro Sekunde wird zurückgehalten.
Chance für neue Lebensräume
Die Revitalisierung und Verbreiterung der Bünz auf 800 Metern Länge bereichern das Landschaftsgefüge. Dank Strukturierung mit punktuellen, strömungslenkenden Massnahmen entwickelte sich in kurzer Zeit ein vielgestaltiges Gerinne mit Breiten- und Tiefenvariabilität. Eine abgesenkte Flutmulde bietet Lebensraum für Feuchtwiesen und Laichgewässer. Sie wird begrenzt durch den Querdamm und ein revitalisiertes Meliorationsgewässer. Luftseitig des Querdamms entsteht eine Fromentalwiese, welche zum Spielen genutzt werden kann. Alle Dammflächen sind extensiv als Magerwiesen genutzt.
Erholungsraum Bünz
Vor den Toren von Wohlen gelegen ist der Beckenraum ein beliebtes Erholungsgebiet. Vor allem der flach ausgebildete Zugang zur Bachsohle mit Spiel- und Erlebnismöglichkeiten zieht viele Leute an. Der Dammkronenweg und der Flurweg entlang der Bünz laden zu Rundwanderungen ein. Auf dem Damm spazierend bietet sich ein prächtiger Ausblick in die Voralpen. Verschiedene Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein.
Miteinander – füreinander
Das partizipative Verfahren führte als Schlüssel zum Erfolg. Beim Variantenstudium waren alle betroffenen Gemeinden und die regionalen Planungsverbände in den Entscheidungsprozess involviert. Vor Ort erfolgte dann eine neue Zusammensetzung der Begleitgruppe mit Vertretungen aus Standortgemeinden, Landwirten und Naturschutz. Die Bevölkerung wurde laufend mit Projektvorstellungen, Flyern und Baustellenbegehungen informiert.
Bund, Kanton, nutzniessende Gemeinden und Versicherungen finanzierten das Bauwerk solidarisch. Die Gemeinden wurden im jeweiligen Verhältnis zum Nutzen hinsichtlich Reduktion der Hochwassergefährdung belastet.
Anmerkung:
In der Hydrologie bezeichnet «HQ» Hochwasser an Flüssen. «HQ100» ist ein statistisch gesehen alle 100 Jahre auftretendes Hochwasserereignis; ein Jahrhunderthochwasser.anthos, Di., 2017.11.21
21. November 2017 André Seippel, Silvio Moser, Jörn Heilig