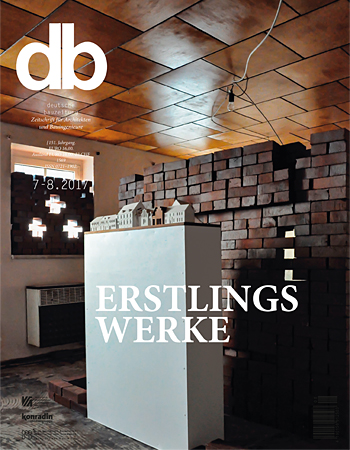Editorial
Aller Anfang ist schwer, sagt man. Dabei wohnt dem Beginnen der Reiz des Ausprobierens inne; das Fehlen von Erfahrungswerten ermutigt zum konsequenten Verfolgen von Entwurfsgedanken und Gestaltungslinien – ja, beinhaltet ein gewisses Maß an Narrenfreiheit und Raum für Flausen. Das Gefühl für die Realisierbarkeit bestimmter Ideen wächst dann beim Tun ebenso wie die Fähigkeit, den Planungsaufwand richtig einzuschätzen. Dazu braucht es zunächst Mut und Zuversicht – sowohl aufseiten der jungen Planer als auch aufseiten der Bauherrschaft. Dass es sich lohnt, zeigen die Beispiele in diesem Heft: Lauter Erstlingswerke, an denen sich die Architekten ausprobieren und ihre Fähigkeiten ausbauen konnten, die aber auch den Auftraggebern, mitunter sogar dem ganzen Umfeld einen ungeahnten Mehrwert einbrachten.
Besonders auffällig dabei: Die jungen Büros – von denen man gerne annähme, dass sie junge Wilde seien – sind ganz unauffällig zugange. Sie bauen in jeglicher Hinsicht anständig, vorsichtig, umsichtig ... und bisweilen einfach richtig gut! | Achim Geissinger
Konstruktive Gegensätze
(SUBTITLE) Haus in Riehen (CH)
Gleich bei ihrem Erstling durften die Architekten in die Vollen gehen. Schweizerisch klar und reduziert schufen sie mit edlen Oberflächen ein kontrastreiches Spiel von klassischen Architekturthemen: leicht und schwer, Tragen und Lasten, definiert und fließend. Präzise gesetzte Materialstöße und Raumkanten lassen bautechnische Fragen in den Hintergrund treten und überlassen die Bühne der Geometrie und der Hanglage mit Aussicht.
Oberhalb des historischen Dorfkerns von Riehen steht in der Nähe des Wenkenparks das Erstlingswerk der Baseler Architekten Lukas Raeber und Patrick Reuter. Das Einfamilienhaus ist Teil eines Wohngebiets, dessen heterogene Bebauung sich zwischen hohem Baumbestand weitläufig den Hang entlang ausbreitet. Neben traditionellen Holzhäusern mit Satteldach und Fensterläden stehen hier Flachdachbauten aus der frühen und späten Moderne, genauso wie standardisierte Investoren- und ikonische Autorenarchitektur aus den letzten Jahrzehnten.
Auf die Empfehlung eines Bekannten hin hatte das seit 2012 bestehende Büro Reuter Raeber den Auftrag erhalten, ein privates Wohnhaus für diese vielfältige und beschauliche Umgebung zu entwerfen. Die beiden jungen Architekten standen der Bauaufgabe ambivalent gegenüber: War das Einfamilienhaus in der Moderne noch ein Ort für Experimente, verbindet man heute damit die Zersiedelung der Vororte mit Kataloghäusern minderer Bauqualität.
In Riehen findet sich beides und die Architekten hatten zum Glück das Privileg mit einem Bauherrn zusammenzuarbeiten, der sich für ein Experiment – für eine anspruchsvolle Konstruktion und hochwertige Materialien – begeistern konnte. Eine optimale Ausgangslage für das erste Neubauprojekt. Nach einem guten Jahr Planungszeit und nur elf Monaten Bauzeit wurde das Haus 2016 fertiggestellt und erhielt sogleich den Schweizer Architektur-Award in der Kategorie »Der erste Bau«.
Lukas Raeber und Patrick Reuter, die beide an der ETH in Zürich Architektur studierten, arbeiteten während und nach dem Studium jeweils in unterschiedlichen international tätigen Architekturbüros: Raeber bei Gehry Partners in Los Angeles und Diller Scofidio + Renfro in New York, Reuter bei Ateliers Jean Nouvel in Paris, Richter Dahl Rocha Arquitectos in Buenos Aires und Christ & Gantenbein in Basel.
Vorstellung und Kontrolle
»Die größte Qualität selbstständig zu arbeiten, liegt darin Verantwortung zu übernehmen und zwar für alles,« beschreibt Patrick Reuter seine stärkste Motivation für die Gründung eines eigenen Architekturbüros. Diese Verantwortung umfasst den idealisierten selbstbestimmten Entwurfsprozess genauso wie die wenig zu kontrollierenden und zähen Prozesse bei der Akquise. Er fügt auch gleich relativierend hinzu: »Wer will schon immer Verantwortung übernehmen? Man kann dabei scheitern und darf nie wegschauen. Sich als junges Büro zu etablieren ist anspruchsvoll und schwierig.« Junge Architekturbüros sehen sich nicht nur in der Schweiz mit einem äußert kompetitiven Arbeitsumfeld konfrontiert. Das restriktive Wettbewerbswesen, die wenigen offenen Ausschreibungen mit Hunderten von Teilnehmern schränken den Zugang zu einer offiziellen Auftragsvergabe ein. So zählen zu den ersten Projekten junger Büros – wie auch beim Büro Reuter Raeber – neben Wettbewerben und Studien meist Sanierungen, Um- und Anbauten.
Um einen Zugang zum Hausprojekt in Riehen zu entwickeln, suchten Reuter Raeber zuerst die vielfältigen Referenzen in der Umgebung auf. Die Einfamilienhausarchitektur in dem Baseler Vorort stand nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur unter dem Einfluss nationaler Traditionen. Ansässige international agierende Kunstsammler und Kulturschaffende blickten in den 60er Jahren beispielweise auf Projekte wie die amerikanischen Case Study Houses und übertrugen die Konzepte auf ihre Wohnhäuser. Zum ersten Bezugspunkt des Projekts von Reuter Raeber wurde eines dieser Gebäude, das Haus Sponagel (1969) der Basler Architekten Max Rasser und Tibère Vadi; dessen auf einem Betonsockel liegende Stahlkonstruktion ist eine Hommage an die Wohnbauten des Internationalen Stils und war seinerzeit eine Neuheit in der Schweiz.
Reuter Raeber widmeten sich außerdem der Topografie und den Ausblicken des Grundstücks. Die mehrfach abgetreppte Betonbodenplatte folgt der leichten Neigung des steinigen Terrains, um im offen gehaltenen Wohnraum immer den direkten Bezug zum Außenraum zu wahren. Die Platte setzt sich bis in den Garten fort. Zwei parallel liegende Betonwände definieren das rechteckige EG in Längsrichtung.
Weitere ebenfalls geschosshohe Betonmauern begrenzen das Grundstück und bilden die Rückwände für das Außenschwimmbecken und die Sommerküche. Die gesamte Betonstruktur der EG-Zone ist von der Straße her kaum wahrnehmbar. Lediglich der dunkle Quader des OGs, der auf den beiden Betonscheiben aufliegt, ist gut zu sehen. Das Gebäudevolumen »duckt sich weg«, wie Patrick Reuter es beschreibt und ist nur auf der Gartenseite komplett zu erfassen.
Reuter Raeber nutzen in ihren Bauten oft Gegensatzpaare, die eine räumliche Spannung erzeugen. Beim Haus in Riehen differenzieren sie die Geschosse nicht nur farblich – durch den Kontrast von hellgrauem Ortbeton und geschwärzten Chromstahlplatten –, sondern viel entscheidender auch konstruktiv. Der Massivbauweise im EG steht im OG die Leichtbauweise mit Holz und Stahl gegenüber. Die Detailierung und Ausführung der aufwendigen Mischbauweise wurde zur größten Herausforderung.
Den Quader des OGs bilden vier Vollholzscheiben, die sich paarweise gegenüberstehen und weit über das EG auskragen. Die Zwischenräume sind als Fensterfläche genutzt, an den Längsseiten verlaufen die aussteifenden, sich diagonal kreuzenden Zugseile aus Stahl sichtbar vor den Glasscheiben. An den beiden, komplett verglasten Stirnseiten bilden querliegende Stahlträger jeweils die Oberkanten. An diesen hängt mit vertikalen Zugseilen die EG-Decke. Die verwendeten Holzaluminiumfenster sind schwarz pulverbeschichtet.
Aufgrund der reinen Verwendung der Materialien Beton, Holz und Stahl, des Verzichts auf unnötige Applikationen und der Zurschaustellung der Konstruktion tragen die jungen Architekten dazu bei, die Tradition der hochwertigen Schweizer Architektur fortzuführen. »Notwendigkeit und Echtheit« soll die Architektur vermitteln, »nur so wenig Wand wie nötig und das reine Material zum Einsatz kommen« beschreibt Lukas Raeber ihren Planungsansatz. Dass Reuter Raeber jedoch nicht nur auf minimale Strenge setzen, belegt die Betonskulptur im Innenraum.
Nachdem Bodenplatte und EG-Wände aus Beton errichtet waren, wurde zentral in den offenen Wohnbereich eine zweigeschossige Betonscheibe gestellt. In der oberen Hälfte kreuzt sie sich mit einer zweiten Scheibe. Darunter hängt schwer der rechteckige Kaminzug. Am Fuße der Scheibe schließt eine lange schmale horizontale Platte an, die als Feuerplatz, Ablage und Sitzbank dient. Oben wurde im weiteren Bauverlauf noch die Badewanne, ebenfalls aus Beton, angesetzt. Mit diesem starken formalen Element verschränken die Architekten zum einen die beiden Konstruktionsweisen, zum anderen ist das skulpturale Element ein Symbol für die Gegenüberstellung der Elemente Wasser und Feuer. Der zentrale Feuerplatz und die verschiedenen Ebenen im offenen Wohnraum stehen in der Tradition der Wohnhäuser Frank Lloyd Wrights und seiner zahlreichen modernen Nachfolger.
Auf vielfältige Weise finden Reuter Raeber formale und konstruktive Anknüpfungspunkte in der relativ kontextlosen Umgebung. »Um Bestand zu haben, muss Architektur auf die Nutzer und den Kontext eingehen und eine Idee vermitteln,« sagt Patrick Reuter. Er wagte den Schritt in die Selbstständigkeit, um »genau die Architektur zu machen, die ich mir vorstelle.« Beides ist ihnen unter privilegierten Voraussetzungen beim Haus in Riehen gelungen. »Wo mit viel Leidenschaft, Mut und Geduld ein Ziel verfolgt wird, eröffnen sich auch Möglichkeiten«, ergänzt Reuter überzeugt.db, Di., 2017.07.04
04. Juli 2017 Janna Lipsky
verknüpfte Bauwerke
Haus in Riehen
Weimar, Finsterwalde, Berlin
(SUBTITLE) Evangelisches Gemeindehaus in Finsterwalde
Lukas Bartke und Clemens Habermann begannen die Arbeit an ihrem Erstlingswerk noch während ihres Studiums. Konzeptionelle Strenge, hoher persönlicher Einsatz und intensive Überzeugungsarbeit ließen es schließlich Realität werden. Dem bestehenden Backsteinhaus nebenan steht nun ein ebenso starkes wie feines Gebäude zur Seite, das innen wie außen Atmosphäre schafft.
Die gemeinsame Reise zum Erstlingswerk der beiden jungen Architekten Clemens Habermann und Lukas Bartke beginnt Ende Mai in Berlin. Dort leben sie mittlerweile die meiste Zeit und setzen ihre gemeinsame Arbeit fort, die bereits 2012 mit ihrem Kennenlernen an der Bauhaus-Universität in Weimar begann. »Nach zehn Jahren in Weimar war es Zeit für einen Tapetenwechsel. Außerdem sind wir in einer Stunde in Finsterwalde, wo gerade unser neues Projekt, der Neubau der Stadthalle startet«, so begründet Habermann die Entscheidung für Berlin als Arbeitsort.
Als projektbasierte Zusammenarbeit bezeichnet Lukas Bartke ihre, ganz eigene Art der Kooperation. Sie hätten dabei den Status freier Mitarbeiter im Architekturbüro von Clemens’ Vater, Jürgen Habermann, und nutzten dessen langjährige Erfahrungen und Ressourcen wie auch die Ingenieurleistungen, die das Büro anbietet. Nach ihren Studienabschlüssen im Herbst 2014 und Frühling 2015 hätten sie ja auch noch gar kein eigenes Büro gründen können, fügt er lächelnd hinzu.
Stringenz und Kommunikation
Es war sicherlich eine glückliche Fügung, dass nahezu gleichzeitig mit ihrem Zusammentreffen im Weimarer Entwurfsseminar des deutsch-argentinischen Architekten José Gutierrez Marquez das Architekturbüro von Jürgen Habermann ob seiner Größe als lokaler Vertreter zum Gutachterverfahren für ein neues Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde im südbrandenburgischen Finsterwalde eingeladen wurde. Als Clemens bei seinem Vater nach einer Tätigkeit für die Semesterferien anfragte, hat dieser ihm die Wettbewerbsbearbeitung angeboten. Die von Marquez im Seminar vermittelte, konzeptionelle Strenge habe ihn und den mit ins Boot geholten Lukas Bartke bei der Wettbewerbsbearbeitung stark beeinflusst, fügt er hinzu. Auch das Seminarthema »Rote Spitzen« (die romanischen Ziegeltürme der Altenburger Marienkirche) passte perfekt zum Finsterwalder Entwurfsort. Dieser ist von zwei benachbarten, historischen Backsteinbauten, dem Pfarramt und dem alten Gemeindehaus sowie dem unmittelbar angrenzenden, ältesten Gebäude Finsterwaldes, der »Curdsburg«, geprägt. Es verwundert daher nicht, dass die beiden Studenten den Neubau des Gemeindehauses ebenfalls als Ziegelgebäude planten. »Der Backstein fügt sich einfach wunderbar in die Brandenburger Landschaft ein«, so beschreibt Bartke seine Eindrücke von den Ortsbesichtigungen. Clemens Habermann stimmt zu und fährt fort: »Außerdem wollten wir die Baugeschichte fortschreiben.« Erwartet habe die Kirchengemeinde allerdings etwas anderes, einen »modernen« Entwurf, der einen Kontrast zum Bestand bilde, schildert Bartke die Reaktionen bei ihrer Entwurfsvorstellung. Sie dagegen hätten den zeitgenössischen Zwilling zum Pfarramt bauen wollen. Habermann vermutet, dass sie ihren, mit einer Stimme Mehrheit denkbar knappen Sieg letztlich ihrem Enthusiasmus und dem anschaulichen Präsentationsmodell zu verdanken haben.
Einsatz und Kreativität
»Mit dem Ziegel konnten wir mehrere Entwurfsthemen auf einmal lösen«, so begründet Lukas Bartke ihre Entscheidung für die Konstruktion aus Opus Caementitium, massivem Gussmauerwerk, das sie nicht nur außen, sondern auch innen ziegelsichtig beließen.
Man habe dem Neubau mit dem sehr heterogenen Raumprogramm dadurch eine klare Identität und Struktur geben können. Außerdem garantiert die raue Ziegeloberfläche eine gute Akustik und die enorme Trägheit der Baumasse ein stabiles Raumklima.
»Durch die Verwendung des Ziegels als Basis für den gesamten Entwurf konnte an unserem Konzept im Nachhinein auch nichts groß verändert werden«, fügt er augenzwinkernd hinzu. Dennoch wäre die Ausführung fast an den hohen Kosten für den gewünschten, historischen Stein aus dem Ringbrandofen gescheitert. In Polen fand Habermann nach einiger Suche schließlich die Lösung mit einer Ziegelei, die die Steine zu einem Viertel des Preises in Deutschland anbot.
Auch danach mussten die beiden Berufsanfänger verschiedene Herausforderungen bei der Realisierung ihres Entwurfs bewältigen, u. a. eine sehr aufwendige Ausführungsplanung. »Als Arbeitsgrundlage für die Maurer habe ich Grundrisse für die Binder- und Läuferschichten sowie Wandabwicklungen aller Räume gezeichnet, weil die Ziegel Toleranzen von bis zu 1,5 cm aufwiesen und teilweise komplizierte Details gemauert werden mussten«, beschreibt Bartke den durch das Honorar nicht abgedeckten Aufwand, den man sich für das erste Haus aber leisten wollte. »Wir hätten es auch selbst mauern können, so gut kannten wir jedes Detail«, merkt Habermann lachend an.
Vermutlich war es dieser intensive, persönliche Einsatz, der zu ihrem »guten Draht« zu den Handwerkern führte. Geholfen hätte ihnen aber auch, dass Jürgen Habermann als offizieller Ansprechpartner vor Ort, ihnen den Rücken freigehalten hat. Außerdem konnten sie bei Fragen des Bauablaufs von seiner Erfahrung profitieren, auch wenn er oft mit dem Kopf geschüttelt habe, ob des immensen Planungsaufwands.
»Es war eine große Herausforderung, alle Beteiligten von unseren Ideen und Ansprüchen zu überzeugen«, so Bartke weiter. »Um die Menschen vor Ort mitzunehmen, sind wir behutsam vorgegangen«, ergänzt Habermann. So hat man z. B. für den nicht mehr zu rettenden Vorgängerbau einen Ausstand vor dem Abriss gegeben.
Klarheit und Vielfalt
Angekommen in Finsterwalde empfängt uns Jürgen Habermann, der weiterhin den beiden Entwurfsverfassern die Bühne überlässt. Auch ihm ist der Stolz auf das Geleistete anzumerken. »Anfangs sei ja viel Skepsis und Ungeduld bei der Kirchengemeinde da gewesen«, merkt er an. Doch spätestens jetzt, mehr als ein halbes Jahr später, seien alle froh, etwas Besonderes zu haben, alle nähmen die Kraft des Gebäudes wahr.
Zunächst besichtigen wir den mit viel Glas und Holz gestalteten und dennoch sehr konventionell wirkenden Gemeindesaal »Arche« aus den 2000er-Jahren. Dieser erhielt mit der Raumfolge Eingang, glasüberdecktes Atrium und Foyer im neuen Gemeindehaus einen barrierefreien Zugang sowie zusätzliche Nebenräume. Diese neuen Räume beeindrucken mit der kraftvollen, nahezu sakralen Präsenz der massiven Ziegelkonstruktion in Schottenbauweise und mit ihrer klaren Gliederung und Formensprache, bei der alle Installationen innerhalb der Wände verlegt sowie Nebenfunktionen, wie Garderoben und Lagerflächen, unsichtbar, in mit Holztüren abgeschlossenen Wandnischen integriert wurden. Außerdem gelang mit den wenigen, verwendeten Materialien Ziegel, Eichenholz, Beton, Estrich und Bronze eine Kombination von optisch wie haptisch großem Reiz.
Das neue Gemeindehaus überzeugt jedoch nicht nur durch Klarheit, sondern auch mit einer räumlichen Komplexität, die man ihm ob seiner geringen Ausmaße nicht zugetraut hätte. So besitzt es einen attraktiven, in das Gebäudevolumen hineingeschnittenen und von Oberlichtern erhellten Treppenraum, über den man vorbei am doppelgeschossigen Gemeindebüro, über das Zwischengeschoss mit Archiv und Besprechungszimmer in das OG gelangt. Dort rhythmisieren und gliedern die Ziegelschotten den Raum über die gesamte Hauslänge. Räumliche Vielfalt entsteht u. a. durch den sich in den verschiedenen Raumhöhen abzeichnenden Staffelgiebel. Der von oben belichtete, hohe Mittelgang verbindet Sitzungsraum und Musikzimmer, die zusammen oder auch, durch eine zweiflügelige Glastür mit Holzrahmen geteilt, separat genutzt werden können. Die Schotten links und rechts des Gangs teilen kleinere Sitz- und Arbeitsbereiche ab.
Details wie die in die Binderschicht integrierten Lichtschalter, die genau in das Ziegelraster eingepasste Möblierung oder das handgeschmiedete Bronzegeländer auf dem kleinen Straßenbalkon lassen staunen, ob der Qualität eines Projekts mit noch nicht einmal 1 Mio. Euro Baukosten.
Am Ende des Rundgangs, auf dem kleinen Straßenbalkon blicken wir dorthin, wo die Zukunft der beiden jungen Architekten liegt. Gegenüber, auf dem Gelände einer ehemaligen Tuchfabrik wird in den kommenden Jahren die neue Stadthalle von ihnen geplant und gebaut werden. Den Wettbewerb, zu dem das Büro Jürgen Habermanns abermals als wichtigster lokaler Vertreter eingeladen wurde, haben sie ebenfalls schon im Jahre 2012 im Namen des Büros gewonnen. Allerdings habe es erst im vergangenen Herbst die endgültige Zustimmung zum Projekt per Bürgerentscheid gegeben, erzählt Clemens Habermann. Bei ihrem neuen Projekt gingen sie zwar auch auf den Bestand ein, indem sie dessen additive Entwicklung aufgriffen, dennoch wollten sie mit einer stärker kontrastierenden Ästhetik die Neunutzung des Geländes ausdrücken, beschreibt Lukas Bartke ihr Entwurfskonzept. Wichtig seien ihnen dabei nicht schöne Bilder, sondern v. a. kraftvolle Räume, die von den Benutzern angenommen werden und funktionieren.
Das glaubt man ihnen sofort. Denn mit ihrem ersten, Maßstäbe setzenden Projekt ist ihnen das bereits überzeugend gelungen.
Ein eigenes Büro zu gründen oder PR zu betreiben, habe dagegen für sie im Moment keine Priorität, ergänzt Bartke. Lieber setzten sie sich weiterhin mit aller Kraft für ihre Architekturvorstellungen ein.db, Di., 2017.07.04
04. Juli 2017 Carsten Sauerbrei
verknüpfte Bauwerke
Evangelisches Gemeindehaus in Finsterwalde
Keine Angst vor Louis Kahn
(SUBTITLE) Haus in Hamburg
Mit einiger Entschlossenheit lässt sich von jungen Büros sogar auf der Ebene von Wettbewerben etwas reißen. Das in Berlin ansässige Duo Kim Nalleweg hat seine Haltung an verschiedenen Studien- und Arbeitsorten gestärkt und darf jetzt mehrere Siegerentwürfe zu gebauter Realität werden lassen. Die nötige Erfahrung mit den Härten des realen Bauens sammelten die beiden bei der Umsetzung ihrer architektonischen Vorstellungen für das elterliche Wohnhaus.
Der Erstling von Kyung-Ae Kim und Max Nalleweg ist zwar noch nicht ganz fertig. Trotzdem verabreden wir uns in Hamburg-Harburg, um einen Blick auf das Haus zu werfen. Etwas versteckt liegt es in zweiter Einfamilienhausreihe. Die Außenanlagen sind tatsächlich noch nicht gemacht und auch innen stehen noch einige Arbeiten aus, aber bewohnt sind die drei aneinandergefügten Quader aus dämmenden Leichtbetonsteinen bereits. Der erste Eindruck zeigt, da hat jemand Mut zu großer Form am kleinen Haus, mit Liebe zum Material und zum Zitat. Respekt! Hier atmet die Moderne vernehmlich. Unter der lichten Schlämme scheint die Textur der Steine durch. Die Fenster schneiden ein T-förmiges Muster in die Fassade, lassen die Architektur kraftvoll, vielleicht sogar ein wenig monumental wirken, und senden freundliche Grüße an Louis Kahn. Es gäbe schlechtere Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Zudem sind die Fenster ja nicht nur Zitat, sondern auch funktional sinnvoll. Sie sorgen für Sichtschutz gegenüber den Nachbarn bei gleichzeitig ungestörtem Blick in den Himmel. Im Innern zeigt sich das Haus für Max Nallewegs Mutter dann als wohnliche Holzkonstruktion. Dem jungen Architektenpaar gelingt es, aus dem kompakten Grundstück eine Menge räumlicher Qualitäten herauszuholen, die sich z. T. aus der Verschiebung der einzelnen Bauteile gegeneinander ergeben und sich in ganz unaufgeregten Dingen äußern. In den ersten beiden Quadern verbergen sich die ineinandergreifenden Räume von Entree, Küche, Galeriegeschoss und Wohnraum mit weißen Wänden und Holzdecken. Der dritte Quader entpuppt sich als Gartenmauer, die die (künftige) Terrasse an drei Seiten hofhausartig umschließt. Vom Kostendruck bis zur Zeitverzögerung aufgrund der Witterung hält der Erstling manches bereit, was zum Bauen dazugehört. Bis hin zu den Detailfragen, wo die Regenrinne nun entlangläuft und ob sie eher schlank (nein) oder markant (ja) sein soll. Ohnehin, die Bauausführung: Beim vier Jahre währenden Wettbewerbe-Zeichnen für Max Dudler spielte die Materialität in ihrer konkreten, konstruktiven Umsetzung eine eher untergeordnete Rolle. Das ist jetzt natürlich ganz anders. Und doch: »Die gedankliche Freiheit beim Entwerfen ist wichtig, um nicht zu schnell die Funktionalitätsschere im Kopf anzustellen.«
Hamburg, Schweiz, Berlin sind die wichtigsten Stationen, an denen die beiden Architekten bisher studiert und gearbeitet haben. Beide Mitte dreißig, haben sie vor anderthalb Jahren Räume in der Berliner Oranienstraße bezogen, fast um die Ecke von Max Dudlers Büro.
Inzwischen arbeiten sie hier zusammen mit dem Spanier César Trujillo Moya, mit dem sie in einer Arbeitsgemeinschaft den Wettbewerb für die Rosa-Luxemburg-Stiftung gewonnen haben, sowie acht Mitarbeitern. Immer mehr Schreibtische werden nötig, und während wir uns in der Fabriketage so offen wie klug und freundlich über Architektur unterhalten, schleppen die Mitarbeiter Materialproben herein, Ziegel, Riemchen. »Nur mit Bildern zu arbeiten reicht uns nicht, wir brauchen Modelle und die Materialien«, erzählt Kyung-Ae Kim. Da ist sie von ihrer kurzen Zeit bei Miller Maranta in Basel geprägt, von der intensiven Schweizer Art mit Materialien umzugehen, am Modell zu überlegen: Was hilft weiter, was kann beibehalten werden.
Die Beteiligung an Wettbewerben hat bei Kim Nalleweg früh eingesetzt. Als sie gerade zu Adolf Krischanitz an die Universität der Künste nach Berlin gewechselt waren, haben sie einen Wettbewerb gewonnen, der für Architekten bis 35 Jahre offenen war. Thema: die Neubebauung des City-Hof Areals in Hamburg. Die Idee von Krischanitz, mit einem Entwurf mehr anzubieten, die Umgebung des eigentlichen Perimeters mitzudenken, haben sie dabei beherzigt. Andererseits wurde ihnen erst später klar, was mit dem Wettbewerb auch beabsichtig war – inzwischen steht der City Hof vor dem Abriss. Hamburg eben (s. Kommentar in db 4/2015).
Für ihren nächsten Schritt, eine Ministeriumserweiterung, die das BBR ausgeschrieben hatte, gab es 2012 immerhin einen Ankauf. Zwar guckt bei dem klassisch ruhigen Entwurf nicht Louis Kahn um die Ecke, aber allemal die klassische Moderne mit ihren lang gestreckten Fensterbändern. Mit der Zuerkennung eines Preises im Ideenwettbewerb für das Lübecker Gründungsviertel (vgl. db 2/2015, S. 14) nahm der Erfolg von Kim Nalleweg endgültig Fahrt auf. Anstatt dafür ein Haus in drei Variationen zu zeichnen, haben die Architekten Lübeck genau angeschaut und mit der Aufgabe gespielt. So haben sie drei sehr eigenständige Häuser entwickelt: Das eine breit, mit barock geschweiftem Giebel, das andere schlank von expressionistischen Lisenen inspiriert. In die Mitte nehmen sie den dritten Baustein, der an Lübecker Speicher aus Ziegel erinnert und nun wirklich gebaut werden soll. Gleich nebenan liegt die Lübecker Einhäuschen Querstraße, für die sie im Frühjahr 2017 einen weiteren Wettbewerb gewonnen haben. Klar strukturiert aber mit spielerischen Elementen, wie den versetzten Ziegelfarben und der gläsernen Ecke blinzeln dem Betrachter neben sanft ironischer Brechung auch Schweizer Anregungen aus den Renderings entgegen. Mit dem zweiten Preis bei der Erweiterung des Wien-Museums 2015 – wiederum international ausgeschrieben – und dem ersten Preis für die Rosa-Luxemburg-Stiftung 2016 in Berlin, gemeinsam mit César Trujillo Moya, zeigt sich vielleicht nicht unbedingt eine eigene Handschrift, sehr wohl aber eine Haltung. Sie kennt keine Angst vor der großen Form und zeichnet sich durch Klarheit und Zeichenhaftigkeit aus. Auch in Wien und Berlin haben sich die Architekten herausgenommen, ein Mehr zu formulieren, »Themen anzubieten, die nicht gefordert waren«. In Wien war es der offene Durchgang unter dem geplanten neuen Museumsriegel, durch den ein überdachter Versammlungsplatz entsteht. In Berlin ist es ein Raum mit markanten tragenden X-Stützen, der in der weiteren Bearbeitung jetzt wohl zur Bibliothek werden wird. Dass sie beim M20, dem Museum des 20. Jahrhunderts am Berliner Kulturforum – wiederum in Arbeitsgemeinschaft mit César Trujillo Moya – in der ersten Wettbewerbsrunde »nur« auf Platz 14 kamen und daher nicht zu den Teilnehmern für die zweite Runde zählten, ärgert die Architekten. Schade, das Weiterdenken ihres Riegels entlang der Potsdamer Straße hätte bestimmt Spaß gemacht. »Die Idee, drei Platzräume zu schaffen, hätten wir klarer herausarbeiten müssen«, räumt Kyung-Ae Kim selbstkritisch ein. »Wichtig ist es, ein klares Projekt zu machen, für sich selbst aber auch für den Bauherrn.« Bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat das offenbar gut funktioniert.
Mit Mut und Überlegung
Zieht man eine erste Bilanz, zeigt sich, dass es die offenen Wettbewerbe waren, mit denen Kim Nalleweg einen Fuß in die Tür zum Bauen bekommen haben. Doch die Chance, die man dadurch erhält, gilt es auch zu nutzen. »Man muss bei allem aufpassen, wie man es macht«, unterstreicht Kyung-Ae Kim-Nalleweg den Lerneffekt. Jedes aus Zeitnot vor der Abgabe verrutschte Bild wird sofort zum K.o.-Kriterium. Wenn Präsentation und künstlerische Qualität des Entwurfs überzeugen, erscheint der weitere Weg jedoch geebnet.
Derzeit diskutieren die Architekten in Berlin mit ihren Bauherren. Da hilft es ihnen, dass der Entwurf für die Rosa-Luxemburg-Stiftung eine so starke Struktur besitzt, dass man nicht einfach hier oder dort etwas wegnehmen kann, um die Baukosten zu senken, weil das Haus dann nicht mehr funktionieren würde. Das klingt schon fast nach alten Hasen.
Mit Ratschlägen halten sich Kim, Nalleweg und Moya zurück. »Wir sind ja selbst noch mittendrin und wissen nicht, wo es langgeht.« Und wagen sich doch behutsam aus der Deckung: die Uni zu wechseln sei wichtig, um anderes kennenzulernen, ebenso in andere Länder zu gehen. So wird einerseits ein Rahmen aus Erfahrungen gesteckt. Andererseits arbeitet man sich auf der Suche nach dem Eigenen am Vorbild der Lehrer ab – im Positiven wie im Negativen. Was es aber heißt, selbstständig zu sein, verhandeln zu lernen oder Akquise zu betreiben, das erfährt man weder an der Uni noch als Angestellter in einem Büro. Warum wundert es mich nicht, dass Kim und Nalleweg zum Abschluss unseres langen Gesprächs an einem heißen Berliner Frühsommertag dann doch den ziemlich klugen Ratschlag für jüngere Kollegen parat haben, langfristig zu denken? Auch wenn es erst nach 10 oder 15 Jahren dazu kam, waren sie sich schon im Studium gewiss, später ein eigenes Büro zu gründen: »Man muss es wollen, auch wenn man noch nicht weiß, was es bedeutet.«db, Di., 2017.07.04
04. Juli 2017 Jürgen Tietz