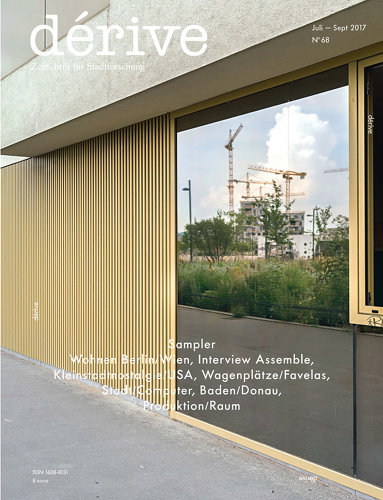Editorial
In unserer 17-jährigen Tätigkeit sind wir – höchst unverdienterweise – nicht gerade mit Preisen überhäuft worden, was möglicherweise auch daran liegt, dass wir uns nie um Auszeichnungen beworben haben. Heute dürfen wir uns aber endlich selbst gratulieren: Wir haben nämlich einen Preis gewonnen und zwar für das urbanize!-Festival. Für diesen haben wir uns freilich auch nicht beworben, ihn aber trotzdem bekommen – nämlich den Kleinen Staatspreis für ... nein falsch: den Förderungspreis der Stadt Wien für Architektur. Dieser Architekturpreis ging bisher ausschließlich an echte ArchitektInnen, aber wir fragen lieber nicht nach, sondern freuen uns über den Einzug eines erweiterten Architekturbegriffs, stellen schon mal den Champagner kalt und fühlen uns ein klein wenig wie das Architekturkollektiv Assemble, das 2015 den wichtigsten britischen Kunstpreis – den Turner-Preis – gewonnen hat und deren Werk gerade in einer Ausstellung im Architekturzentrum Wien zu sehen ist. Wir haben die Gelegenheit genutzt und mit Maria Lisogorskaya und Lewis Jones von Assemble ein Gespräch über ihre Arbeiten, Herangehensweisen und Ideen geführt, das ab S. 18 dieser Ausgabe zu lesen ist.
Damit wären wir nach dieser höchst eleganten Überleitung bei der vorliegenden Ausgabe gelandet: Sie ist ein Sampler, hat also keinen Schwerpunkt, sondern bietet eine Reihe unterschiedlicher urbaner Themen. Diese reichen – abgesehen vom Assemble-Interview – von der Wohnraumversorgung und der aktuellen Situation am Wohnungsmarkt in Wien und in Berlin über die antiurbanistische Main-Street-Nostalgie in den USA des Donald Trump, den immer beliebteren, aber nichts desto trotz falschen Vergleich von Städten mit Computern, Wagenplätze und informelle Siedlungen in Berlin bis zu – es ist Sommer! – einer kleinen Geschichte des Badens in der Donau bei Wien.
Sowohl die Wiener als auch die Berliner Bevölkerung ist in den letzten Jahren massiv gewachsen, die Nachfrage nach Wohnraum parallel dazu stark gestiegen. Andrej Holm für Berlin und Justin Kadi für Wien kommentieren die aktuelle Lage in den boomenden Hauptstädten. Holm sieht in Berlin einen »Mix aus demographischen Veränderungen, veränderten Investitionsstrategien und einem Kahlschlag der sozialen Wohnungspolitik« dafür verantwortlich, dass es »nicht nur zu drastischen Mietsteigerungen« gekommen ist, »sondern zu einer tatsächlichen Wohnungsnotlage mit einem Mangel an allem, was die Wohnungsversorgung einer Stadt braucht.«
Für Wien diagnostiziert Justin Kadi eine steigende Wohnkostenbelastung und eine zunehmende Verdrängung in periphere Lagen. Eine der Ursachen sieht er in der Deregulierung des Mietrechts im Jahr 1994, die sich aktuell besonders stark auswirkt.
Eine der Folgen der Wohnungsnot sind informelle Siedlungen. Niko Rollmann portraitiert die diesbezügliche Situation in Berlin. Diese ist einerseits von etablierten Orten – überwiegend Wagenplätzen – gekennzeichnet, die von den Behörden meist geduldet werden, und andererseits von wilden Lagern bzw. so genannten Spots, bei denen kein alternativer Lebensentwurf, sondern die nackte Not Grund für die informellen Wohnverhältnisse sind.
Frank Eckardt hat sich den US-amerikanischen Mythos der Main Street speziell unter den neuen politischen Verhält- nissen angesehen. Trumps WählerInnen sind überproportional oft außerhalb der Großstädte zu finden und lassen sich von ihrem Hero gerne erzählen, wie schrecklich kriminell und chaotisch es in den Inner Cities zugeht. Mit verklärtem Blick sehnen sie sich ins Zeitalter der kleinstädtischen Main Street zurück, in dem angeblich noch alles gut war. Währenddessen blicken Konzerne wie Alphabet (formerly known as Google) nicht in die Vergangenheit, sondern in eine gewinnträchtige Zukunft, wenn sie nach Lösungen für die von ihnen diagnostizierten städtischen Probleme suchen. Wobei sie eigentlich gar nicht suchen, denn sie meinen zu wissen, dass mit ausreichend Daten die Verkehrsproblematik ebenso zu bewältigen wie eine effiziente Verwaltung zu garantieren und obendrauf noch das Gesundheits- und Wohnungswesen auf Vordermann zu bringen sei. Shannon Mattern weist in ihrem Beitrag für diese Ausgabe nachdrücklich darauf hin, dass es ein Irrweg ist, die Stadt wie einen Computer zu denken, und zu meinen, mit automatisierter Informationsverarbeitung der urbanen Komplexität gerecht werden zu können.
Passend zur aktuellen Hitzewelle mit über 30°C erzählt Rafael Kopper in seinem Beitrag die Geschichte des öffentlichen Badens in der Donau bei Wien und zeigt wie sie vom »mitunter gefährlichen Nutzgewässer zum beliebten Freizeitziel« wurde. Er schreibt über frühe Aneignungsprozesse der Bevölkerung, den entsprechenden Reaktionen der Politik und der Institutionalisierung der Bedürfnisse der WienerInnen.
Quasi auf Auszeit hat sich auch Manfred Russo befunden, der nach einem guten Jahr Pause mit einer neuen Folge der Geschichte der Urbanität zurückkehrt und sich zum dritten Mal Henri Lefebvres Theorien zur Produktion des Raumes widmet. Das Kunstinsert stammt vom in Wien lebenden Künstler Aldo Giannotti, dessen wunderbare Zeichnung für dérive sich um das Thema Demolition dreht.
Und dann steht auch noch das bereits 8. urbanize! Festival vor der Tür: DEMOCRACitY – Demokratie und Stadt begibt sich von 6.10.–15.10.2017 auf Erkundungsreise durch Theorie und Praxis einer umfassenden (Re-)Demokratisierung der urbanen Gesellschaft: Vom Versuch Stadt gemeinsam zu entwickeln und den von Barcelona ausgehenden Impulsen eines neuen Munizipalismus, über die Verteilung von Rechten und Möglichkeiten mittels Urban Citizenship- und Spatial Justice- Ansätzen, bis zu Chancen und Gefahren für die demokratische Aushandlung durch die Digitalisierung. Wie immer als volle 10-Tages-Packung mit Vorträgen, Diskussionen, Filmen, Stadtspaziergängen, Workshops und Interventionen. Da hilft nur Kalender zücken und Zeit frei schaufeln: Programm-Details gibt es ab Mitte August 2017 auf www.urbanize.at.
Einen schönen Sommer wünschen Elke Rauth und Christoph Laimer