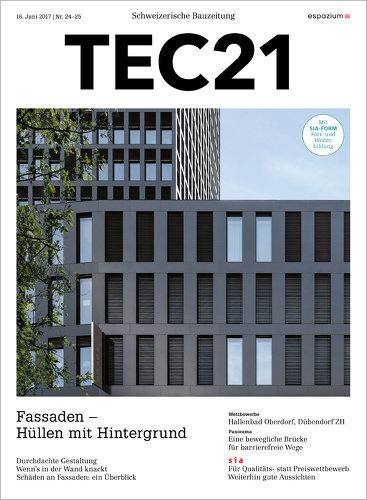Editorial
Fassaden sind mehr als einfach nur Gebäudehüllen. Heute müssen intelligente Systeme mit einer Vielfalt an Materialien und Technologien höchste ästhetische und funktionale Ansprüche erfüllen. Ein innovatives Beispiel ist das Projekt Grosspeter Tower in Basel, in dessen Fassade Architektur, Tragwerk und Solartechnik zu einem Gesamtkonzept abgestimmt sind.
Die Gebäudefassade übernimmt hier nicht nur statische, sondern auch funktionale Aufgaben. Auch bei der elektrischen Netzeinbindung wurden bislang unerschlossene Wege begangen.
Mit neuen Techniken entstehen aber auch neue Probleme. Die Bauteile der Fassadensysteme werden immer komplexer. Schwierigkeiten treten häufig am Übergang zwischen Aussen- und Innenraum auf. Ein Spezialfall dieses Schnittstellenproblems sind «knackende» Fassaden. Insbesondere die Bewohner von Wohnneubauten fühlen sich durch derartige Knackgeräusche irritiert, und Fachleute stehen bezüglich der Sanierung vor neuen Herausforderungen.
Zunehmend müssen sich Fassadenexperten mit Schadens- und Sanierungsproblematiken auseinandersetzen – kein Wunder bei jährlichen Bauschäden von 1.6 Mrd. Franken. Die Sanierung von Fassaden erweist sich dabei als besonders kostenintensiv. Um den Aufwand zu minimieren und die Schadensprävention anzuregen, gehen Fachleute daran, mögliche Ursachen aus der Praxis zusammenzutragen und zu systematisieren.
Dietlind Jacobs, Franziska Quandt
Inhalt
AKTUELL
07 WETTBEWERBE
Lange Bahnen
12 PANORAMA
Eine bewegliche Brücke für barrierefreie Wege | Soziales Wohnungsbauprogramm Äthiopien – universale Ansprüche vs. lokale Realität
18 VITRINE
Für drinnen und draussen
21 SIA
Für Qualitäts- statt Preiswettbewerb | Weiterhin gute Aussichten | Erster Gebäudetechnik Kongress im KKL Luzern | Wettbewerbspraxis in der Romandie | SIA-Form Fort- und Weiterbildung
27 VERANSTALTUNGEN
THEMA
28 FASSADEN – HÜLLEN MIT HINTERGRUND
28 DURCHDACHTE GESTALTUNG
Clementine Hegner-van Rooden
Bei der Fassade des Grosspeter Towers bedingen sich Nutzung, Solartechnik und Tragwerk gegenseitig.
33 WENN’S IN DER WAND KNACKT
Pascal Stefan Fleischer
Bauteile, die die Wärmedämmschicht durchdringen, sollen Auslöser von hörbaren Knackgeräuschen in Wohnungsneubauten sein.
36 SCHÄDEN AN FASSADEN – EIN ÜBERBLICK
Lorenzo Nägeli
Eine Systematik zu den Ursachen von Fassadenschäden will zur Vermeidung von Fehlern beitragen.
AUSKLANG
41 STELLENINSERATE
45 IMPRESSUM
46 UNVORHERGESEHENES
Durchdachte Gestaltung
(SUBTITLE) Grosspeter Tower, Basel
Die Fassade des neu gebauten Grosspeter Towers in Basel ist komplett mit Solarmodulen bestückt. Technoid wirkt die Fassade trotzdem nicht. Voraussetzung war die Abstimmung der Disziplinen Architektur, Tragwerk und Solartechnik zu einem Gesamtsystem, das die Nutzung mit einbezieht.
Der 22-geschossige Grosspeter Tower steht am südöstlichen Eingang Basels unmittelbar beim Autobahnanschluss A2/A3 und in der Nähe des Basler SBB-Bahnhofs. Mit 78 m Höhe überragt er alle umliegenden Bauten. Einem Wahrzeichen gleich steht das Hochhaus für die Verknüpfung von Architektur, Nutzung, Tragwerk, Fassadenplanung und Solartechnik zu einem Gesamtkonzept. Das Tragwerk ist entsprechend dem Kräftefluss abgestuft und spiegelt sich in den Riegeln und Stegen der Fassade wider. Der Rhythmus der Fassadenelemente korrespondiert wiederum mit der Geschossnutzung und gibt dem Gebäude sein typisches Erscheinungsbild. Die Fassadenpaneele mit flächendeckenden Solarmodulen sind gänzlich in die Fassadengestaltung integriert. Es ist ein Projekt, in dem die verschiedenen Disziplinen am Bau sich nicht nur ergänzen, sondern einander bedingen.
Das Hochhaus steht auf einer trapezförmigen Parzelle. Diese ist Teil des Grosspeter-Bebauungsplans und das östlichste der sechs Baufelder. Auf dem Areal sollte der Dienstleistungsbereich um den Bahnhof SBB sinnvoll erweitert werden. Das in einem mehrstufigen Wettbewerbsverfahren entwickelte Bebauungskonzept gewannen 2002 Miller & Maranta Architekten. Zu berücksichtigen waren Optionen für geplante Verkehrsbauten, das Nationalstrassen-Teilstück der A2 zwischen Bahnhof SBB und Gellert sowie ein fünftes Gleis der SBB. Im Osten sollte ein Hochhaus einen Akzent setzen, der stadtauswärts den Abschluss der Bebauung bildet. Die Projektierung dieses Hochhauses vergab die Bauherrschaft zunächst direkt dem Basler Büro Degelo Architekten. Nach dem Vorprojekt beauftragte die Bauherrschaft die Basler Architekten Burckhardt Partner. Zusammen mit den Basler Tragwerksplanern von ZPF Ingenieure und weiteren Fachplanern und Spezialisten sind sie für den Grosspeter Tower verantwortlich.
Tragstruktur widerspiegelt Nutzung
Das Gebäude mit Hotel- und Büronutzung setzt sich aus zwei ineinandergreifenden Volumen zusammen und hat von jeder Seite eine andere Form (Abb.). Im sechsgeschossigen Sockelbereich sind Büroflächen und das Hotel angeordnet, und im 25 × 24 m grossen, im Grundriss also fast quadratischen Hochhaus mit zusätzlichen 16 Geschossen werden bis Mitte Sommer dieses Jahres weitere 11 000 m² Büroflächen realisiert. Der Mieterausbau ist im «Core and Shell»-Prinzip individuell konzipiert worden. Dabei werden sämtliche Mietflächen vorerst nur in einem Grundausbau ausgeführt. Dieser umfasst die Gebäudehülle (shell = Schale) und die zentrale Erschliessung (core = Kern) wie Aufzüge, Treppenhäuser und Installationsschächte. Dadurch ermöglicht die Bauherrschaft unterschiedliche Mieteinheiten von 210 bis 880 m², die variabel ausgebaut, flexibel im Grundriss disponiert und über mehrere Geschosse zusammengelegt werden können.
Die Tragstruktur als Skelettbau mit Ortbetonflachdecken von 26 bis 30 cm Stärke ist die optimale Antwort auf diese Anforderungen. Beim Turm sind die Flachdecken mit einer Regelspannweite von bis zu 8 m auf einer Stahlrahmenkonstruktion (Vierendeelträger) in der Fassadenebene und auf tragenden Wänden im Kernbereich gelagert. Im Sockelbereich lagern die Flachdecken auf Stahlbetonwänden in der Fassadenebene, drei weiteren Kernen und Fertigbetonstützen im Geschossinnern. Zwei zusätzliche Stahlkernstützen leiten die hohen Lasten aus dem Turm im Gebäudeinnern ab. Das betonierte Untergeschoss wirkt als steifer Kasten, in dem die Kerne und aussteifende Wände eingespannt sind.
Oberhalb des ersten Obergeschosses kragt das Hochhaus um rund 8.8 m aus – eine Vorgabe aus dem Bebauungsplan. Statt es auf seinem kompletten Fuss stehen zu lassen, wurde dem Volumen ein beträchtlicher Teil seiner Standfläche genommen. Unter der Auskragung verlaufen die neue Erschliessungsstrasse und unmittelbar daneben die Gleise der SBB-Linie Basel–Zürich sowie ein Rad- und Fussweg (Abb.).
Die Ingenieure von ZPF aus Basel entwickelten ein Tragsystem, das diese statische Rahmenbedingung gezielt berücksichtigte und zugleich der architektonischen Intention des Basler Architekturbüros Burckhardt Partner entsprach. Die Architekten referenzieren das «Permanent Model» von Monadnock aus Rotterdam, wonach sich die in den unteren Geschossen noch als Lochfassade erscheinende Gebäudehülle mit steigender Gebäudehöhe zugunsten grösserer Fassadenöffnungen auflöst und oben im Turm zur leichten Pfosten-Riegel-Konstruktion wird. Ein nutzungsbezogenes Konzept, da die unteren Geschosse mit dem Hotel nach mehr Privatsphäre verlangen und in den Obergeschossen mit den Büros mehr Transparenz und Ausblick möglich ist.
Das Tragwerk ist ein Vierendeel-System aus Stahl in Form eines gebäudehohen Vierkantrohrs. Ohne störende Diagonalen leitet es die anfallenden vertikalen Lasten in den Baugrund ab. Seiner biegesteifen Rahmenkonstruktion entsprechend trägt es zudem horizontale Lasten ab und steift das Gebäude aus. Der zentrale Gebäudekern im Turm leistet dazu rechnerisch einen kleineren Beitrag, weil er für Installationen und Erschliessung perforiert ist.
Um den Innenraum im Hochhaus möglichst effizient und uneingeschränkt – das heisst stützenfrei – nutzen zu können, ist das Tragwerk in die Fassadenebene integriert. Die Planenden haben die Fassaden- und die Tragelemente entsprechend stark aufeinander abgestimmt. Die Fassadenelemente übernehmen die Abmessungen der Tragelemente, wodurch beide mit dem Kräftefluss korrespondieren und so gleichzeitig die Statik und das architektonische Konzept widerspiegeln.
Fassade integriert Solarmodule
In sämtliche Fassadenelemente sind flächendeckende Dünnfilm-Solarmodule integriert. Abgestimmt auf die Breite und Höhe der Fassadenpaneele wurden für alle Gebäudeseiten über 450 unterschiedliche PV-Fassadenelementtypen auf Mass angefertigt. Doch anders als bei Standardprojekten entstand hier zugleich ein Demonstrations- und im besten Fall auch ein Nachahmungsprojekt. Denn die Module sind unabhängig von ihrer Ausrichtung, ihrer lokalen Beschattungssituation und der Grösse des Fassadenelements rund um das Gebäude und in unterschiedlichen Abmessungen angebracht. Dies ist nur möglich dank der ausgeklügelten elektrotechnischen Verschaltung und der Massanfertigung der Dünnfilm-Solarmodule (vgl. «Massgeschneiderte Solartechnik», Kasten unten). Die unterschiedlich «ertragreichen» Fassadenseiten – ob Süd-, West-, Ost-, Nordseite oder auf dem Dach – konnten so miteinander verknüpft und ein einheitliches Fassadenbild erreicht werden. In der ausgeführten elektrotechnischen Anordnung lässt sich der Stromertrag unter den gegebenen Rahmenbedingungen optimieren.
Die rund 10 000 Fassaden-Solarmodule mit einer Leistung von 440 kWp generieren zusammen mit dem Dach-Solarkraftwerk (mit einer zusätzlichen Leistung von 100 kWp) eine erwartete Stromproduktion von rund 260 000 kWh/a; sie deckt einen grossen Teil des Grundstrombedarfs. Ein Erdwärmesondenfeld mit 52 Sonden, die 250 m in die Tiefe führen, versorgt zudem die Wärmepumpenheizung und die Kältemaschine mit geothermischer Energie. Während im Winter damit geheizt wird, kann gleichzeitig die Kälte zurückgeführt werden, um sie im Sommer zur Kühlung des Neubaus zu verwenden.
Technik folgt Architektur
Die Architekten haben die Solarmodule zusammen mit den Solarplanern des Zürcher «energiebüro» designt. Das Fassadenbild wird dadurch weniger von der Technik bestimmt, ohne dass energetische Ertragseinbussen hätten hingenommen werden müssen. Denn auch wenn die Dünnfilmzellen – im Gegensatz zu herkömmlichen kristallinen Solarzellen – ohne Siebdruck des Frontglases kaum als Solarmodule erkennbar sind, bleiben die fotoaktiven Solarpatches mit den typischen «Nadelstreifen» schwach sichtbar. Indem das Planerteam jeden einzelnen Solarmodultyp bewusst gestaltete, verhinderte es ein optisches Patchwork. Stattdessen ergab sich ein geordnetes Fassadenbild.
Die maximalen Abmessungen der Patches richten sich nach den produktionstechnischen Möglichkeiten. Da nur Solarmodule mit gleicher Spannung zu Strings verschaltet werden können (vgl. «Massgeschneiderte Solartechnik», Kasten unten), mussten die Zellabstände variieren. So kann die Spannung bei unterschiedlichen Modulgrössen ausgeglichen werden. Die Variation ist auf 10 % begrenzt, damit die Veränderung optisch nicht stört.
Gesamtsystem aus Technik, Architektur und Tragwerk
Vor allem aus elektrotechnischer Sicht wird deutlich, dass für ein solches rigoros durchdachtes Projekt neue planerische und produktspezifische Lösungen notwendig sind. Ein aufwendiger, aber aus architektonischen Gründen lohnenswerter Prozess. Denn durch die komplexe und projektspezifisch ausgearbeitete elektrotechnische Anlage und durch die gestalterisch hochwertige Integration der Solarmodule in die Gebäudefassade inklusive Tragwerk profitiert schliesslich das Gesamtkonzept aus Solartechnik, Architektur und Tragwerk. Durch statische und elektrotechnische Rahmenbedingungen ergibt sich aus der energetisch leistungsfähigen Fassade auch ein gestalterisch wirkungsvolles Erscheinungsbild: Ohne technoid zu wirken, sind die Solarmodule integraler Bestandteil des architektonischen und statischen Gesamtkonzepts.TEC21, Fr., 2017.06.16
16. Juni 2017 Clementine Hegner-van Rooden
Wenn’s in der Wand knackt
(SUBTITLE) Geräusche in Neubauten
Ein noch weithin unbekanntes Phänomen: Spickende Dorne verursachen laute Geräusche in zweischaligen Aussenwänden. Das Knacken ist rund um die Uhr zu hören, den SIA-Normen noch nicht zugrunde gelegt und kann den Totalersatz einer Verbindung erfordern. Erschütterungs- und Schallmessungen helfen die Ursache aufzuspüren.
Seit einigen Jahren treten in Wohnneubauten öfters Geräusche auf, die die Bewohner mit «Knistern», «Knacken» oder «Knallen» beschreiben. Während man sie in historischen Bauten noch wohlwollend wahrnimmt, ist man in Neubauten dadurch eher irritiert – insbesondere, wenn es sich nicht um Holzbauten handelt. Die Lautstärke der Geräusche lässt sich mit dem Brechen eines Asts oder dem Aufprall eines Gegenstands auf eine harte Oberfläche vergleichen. Die Reaktionen und das Empfinden der Anwohner auf die plötzlich auftretenden Geräusche fallen unterschiedlich aus. Innerhalb ein und derselben Liegenschaft melden Bewohner bei vergleichbaren Knackgeräuschen gleichzeitig «schlaflose Zustände» und «keine persönliche Registrierung» (weil unterhalb der persönlichen Reizschwelle).
Woher kommt das Knacken?
Die Anforderungen an die Energiekennzahlen sind in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Die Wärmedämmungen sind heute deutlich stärker. Die grossen Dämmstärken führen zu thermisch komplett unabhängigen inneren und äusseren Tragkonstruktionen. Wärmebrücken gilt es aus bauphysikalischen Gründen zu verhindern, daher werden Aussenhaut und Innenkonstruktion möglichst entkoppelt. Für die wenigen Tragelemente, die die thermische Gebäudehülle durchbrechen, werden oft Sonderanfertigungen wie Kragplattenanschlüsse und Dorne (Abb.) vorgesehen, die den bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden.
Infolge Temperaturschwankungen verändern Bauteile entsprechend ihrem Wärmekoeffizienten ihre Abmessungen. Weil alle aussen liegenden Bauteile den thermischen Einwirkungen wie Temperatur und Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, dehnen sie sich entsprechend aus oder ziehen sich zusammen. Die innen liegenden Bauteile sind hingegen an die mehr oder weniger konstante Raumtemperatur gekoppelt. Sie erfahren keine massgebenden thermischen Einwirkungen und entsprechend keine wesentlichen Verformungen.
Mit der unterschiedlichen Wärmeausdehnung verschieben sich die Bauteile differenziell zueinander, was die Ingenieure bei der Bemessung und bei der konstruktiven Ausbildung der Tragelemente und deren Verbindungen entsprechend mit beweglichen Konstruktionsdetails berücksichtigen müssen. Die Ingenieure setzen oft Dorne ein, die Vertikalkräfte zwischen Tragelementen übertragen und in horizontaler Richtung verschiebbar sind.
Diese Bewegungsfähigkeit ist jedoch eingeschränkt, dass heisst, der Dorn bewegt sich nur «ruckelnd» – es baut sich eine Zwängungskraft auf, die sich periodisch wieder «losreisst». Die dadurch entstehenden «Spickbewegungen» rufen die hörbaren Knackgeräusche hervor. Sie stellen im Allgemeinen aber kein Tragfähigkeitsproblem dar. Die einzelnen Spickvorgänge laufen im Hundertstelsekundenbereich ab, und die totalen Relativverschiebungen innen–aussen liegen im Bereich weniger Mikromillimeter.
Über die genaue Entstehung des Spickvorgangs und die massgebenden Einflussgrössen auf die störenden Schallpegelwerte ist bislang wenig bekannt. Als Ursachen vermutet werden: zu hohe Querkräfte, da- durch sehr hohe Haftreibung, unsachgemässer Einbau, leichte Schräglage der Dorne, Unstetigkeiten in der (Gleit-)Oberfläche und/oder fehlerhafte Dorne.
Messungen geben Aufschluss
Ausgewertete Schwingungs- und Schallmessungen in den betroffenen Gebäuden bestätigen, dass die Ursache für das Knallen unter anderem in Querkraftdornverbindungen liegt – meist knacken mehrere solcher Verbindungen. Gemessene Spickvorgänge werden mit gleichzeitig erfassten Schallereignissen korreliert. Zusätzliche Temperaturmessungen der Aussenluft und der Bauteile verdeutlichen die Zusammenhänge zwischen Temperatur, Knall und Konstruktion. Die Bewegungsrichtungen der Spickvorgänge sind am Nachmittag entgegengesetzt zur Richtung nachts.
Die Erwärmungen respektive die Abkühlungen und die daraus resultierenden thermischen Expansionen bzw. Kontraktionen können bei entsprechender Messinstrumentierung festgestellt werden (Abb.). Registrierte Maximalpegel LA,F – Schalldruckpegel gemessen mit Frequenzbewertung «A» (entspricht den Kurven gleicher Lautstärkepegel bei ca. 20 bis 40 phon) und der Zeitbewertung «fast» (engl. für schnell) – einzelner Knackgeräusche liegen im Mittel im Bereich bis 45 dBA, maximal im Bereich von über 70 dBA.
Knacken Tag und Nacht
Das Knistern, Knacken und Knallen ist praktisch 24 Stunden lang zu hören. Besonders während der Nacht, wenn die Schlafphase gestört wird, ist die Beeinträchtigung enorm. Oft bemerkt man die Geräusche zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden – verzögert zur Abkühlung der Aussenluft – sowie zwischen der Mittagszeit und dem Abend – verzögert zur Erwärmung der Aussenluft (Diagramm).
Mit den heute besser gegen potenzielle Lärmemissionen gedämmten Gebäuden dürfen Bewohner ausserdem davon ausgehen, dass sie in ihren Wohnungen in der Regel kaum etwas von den Nachbarn oder von aussen hören. Dieser gegenüber früher abgesenkte Ruhepegel bewirkt, dass bis anhin nicht wahrgenommene Quellen hörbar sind – und im schlechtesten Fall neu als störend empfunden werden. Schliesslich begünstigen moderne Grundrissgestaltung, glatte Oberflächen und wenig Stoff in der Raumgestaltung hohe Nachhallzeiten – Geräusche wie das Knacken werden dadurch ausgeprägter wahrgenommen.
Der Geräuschpegel nimmt ohne Massnahmen nicht ab. Die Ingenieure rechnen aber damit, dass sich die Belästigung dennoch verkleinert, vermutlich aber nicht, weil sich der Schalldruckpegel reduziert, sondern weil sich die Bewohner daran gewöhnen.
In den Normen nicht berücksichtigt
Um subjektive Wahrnehmung normativ zu erfassen, ziehen Ingenieure die aktuell gültigen Normen bei, auch wenn für die Immissionsart «Knacken» (knack- bis knallartige Geräusche infolge ruckartiger thermischer Relativbewegungen der Tragstruktur) in der Schweiz keine expliziten Vorgaben für zulässige Werte in Wohnräumen existieren.
Im Zusammenhang mit Schallschutz im Hochbau wird üblicherweise die Norm SIA 181:2006, «Schallschutz im Hochbau» beigezogen. Unter 3.2.3.9.6. steht, dass konstruktionsbedingte Geräusche, die beispielsweise aus plötzlicher Entlastung von Zwängungen entstehen können, sinngemäss wie Funktionsgeräusche zu beurteilen sind. Die registrierten Knackgeräusche überschreiten die Anforderungen «Geräusche haustechnischer Anlagen und fester Einrichtungen im Gebäude» dabei meistens (z. B. Anforderungswert bei Eigentumswohnungen resp. bei erhöhten Anforderungen und mittlerer Lärmempfindlichkeit: LH = 30 dBA) – ein Wert, der von Knackgeräuschen relativ rasch überschritten wird.
Die mit den Geräuschen gleichzeitig auftretenden Erschütterungen bemängeln die Bewohner selten, was auch messtechnisch nachvollziehbar ist, zumal die gemessenen Schwingungsamplituden meist deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenze und den Beurteilungswerten liegen (z. B. DIN-Norm Nr. 4150-2 «Erschütterungen im Bauwesen, Teil 2: Einwirkungen auf Menschen und Gebäude»). In den Tragwerksnormen werden bauphysikalische Fragestellungen dieser Art nicht behandelt; thermisch beanspruchte Elemente sind lediglich bezüglich Tragsicherheit und Ermüdungsfestigkeit zu überprüfen.
Schaden beheben und Wissen erweitern
Um das Problem zu beheben, reicht eine statische Analyse allein nicht aus. Vielmehr sind Anschlussdetails notwendig, die präzise, sachgemäss und sauber eingebaut und hergestellt werden müssen. Auch die möglichen ruckartigen Verschiebungen sind zu untersuchen. Entweder sind die Verschiebeebenen genügend gleitend auszubilden, oder sie sind zu verhindern. Das heisst, es sind nach Möglichkeit keine Verschiebungen zuzulassen, die Struktur auf Zwängungen zu bemessen und die vorhandenen Wärmebrücken entsprechend auszubilden.
Bei einem Schadenfall hilft meist nur der komplette Ersatz der betroffenen Dorne. Die Tragfunktion wird dabei durch Ersatzbauteile wie beispielsweise Konsolen mit Gleitlagern, zusätzliche Stützen, Schub- oder Gleitlaschen gewährleistet – ein enormer nachträglicher planerischer und kostenintensiver Aufwand, der sich gestalterisch negativ auswirken kann und den es vorab zu verhindern gilt.
Bei den untersuchten Schadenfällen war den Planenden die Problematik der Knackgeräusche vor Baubeginn nicht bekannt. Das Phänomen war ihnen mit ihrem üblichen und zu erwartenden Wissensstand und Fachwissen nicht bewusst, was grundsätzlich das Risiko einer Fehlkonstruktion birgt. In der Lehre wird diese Thematik nicht behandelt, und in der Forschung wurden erst in den jüngsten Jahren Untersuchungen hinsichtlich «Spickgeräuschen» injiziert.
Das Wissen um die Gefahr von Knackgeräuschen beschränkt sich zum heutigen Zeitpunkt auf wenige – meist durch einen Fall betroffene – Planende und Baufachleute. Es ist anzunehmen, dass Hersteller und Lieferanten von kraftübertragenden Anschlussteilen bereits ähnliche Fälle kennen, dieses Wissen von den Planenden jedoch aktiv eingeholt werden muss. Das Bewusstsein um knackende Bauteile vermindert längerfristig das Risiko eines Mangels oder eines Schadenfalls.TEC21, Fr., 2017.06.16
16. Juni 2017 Pascal Stefan Fleischer
Schäden an Fassaden: ein Überblick
(SUBTITLE) Gebäudehülle
Die Behebung von Baumängeln im Schweizer Wohnungsbau verursacht jährlich Kosten in Milliardenhöhe. Fassaden tragen dazu einen bedeutenden Anteil bei. Schäden vorzubeugen ist daher unerlässlich. Bei der Schadensprävention hilft es, mögliche Ursachen zu systematisieren.
Die Gebäudefassade übernimmt als gestalterisches Element nicht nur eine repräsentative Funktion, sondern bildet als Teil der Gebäudehülle die äussere Schutzschicht. Beschädigungen verkürzen die Lebensdauer der Bauteile, beeinträchtigen die Ästhetik und mindern den Wert des Gebäudes.
Sobald die Beschaffenheit vom vertraglich Vereinbarten abweicht, eine gewöhnliche Nutzung nicht möglich ist oder die zu erwartende Qualität nicht gegeben ist, spricht man von einem Mangel. Ein Bauschaden kann die Folge eines Mangels sein, aber auch die Folge einer nicht vorgesehenen Einwirkung. Wird ein bestimmter Grenzwert unterschritten, beeinträchtigt dies die normale Funktion der Fassade.
Baumängel bewirken Folgekosten von jährlich 1.6 Mrd. Fr. (entspricht 8 % der jährlichen Bauausgaben im Wohnungs-/Neubau). Die Fassade ist mit 25 % gegenüber anderen Gewerken auffallend stark von Mängeln betroffen (Abb.). Diese Informationen entstammen der Publikation «Mängel im Hochbau».[1]
Bauschäden resultieren oft aus Baumängeln, die nicht rechtzeitig erkannt oder behoben worden sind. Ein strukturierter Überblick über die möglichen Ursachen soll helfen, Überlegungen zur Schadensvermeidung anzuregen und zu verbessern (Abb.). Ein Praxisbeispiel veranschaulicht jeweils das Schema.
Schäden durch nicht vorgesehene Ausseneinwirkung
Ausseneinwirkungen wie z. B. Hagel können die Fassade direkt beschädigen (Abb.). Dünnwandige Bleche oder Anstriche und Lasuren halten einem stärkeren Hagelereignis oft nicht stand. Die heutige Bauweise mit kubischen Formen und fehlenden Dachüberständen sowie Aussenisolationen und dünnwandigen Blechen erhöht das Beschädigungsrisiko. Bei der Materialwahl und Fassadenausgestaltung müssen die zu erwartenden (realistischen) Ausseneinwirkungen definiert und berücksichtigt werden. Eine Fassade an einem Schulhaus ist anderen Beanspruchungen ausgesetzt als an einem Altersheim. Ist bei einem Gebäude mit hohem Güterumschlag zu rechnen, sollten Sockelzonen oder Eckkanten von Fassaden verstärkt werden.
Weil durch Hagelschäden immer höhere Kosten entstehen, stellen die kantonalen Gebäudeversicherungen zunehmend Vorgaben. Ein Hilfsmittel ist das Hagelschutzregister der Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen (VKF). Darin sind die Hagelwiderstandsklassen einzelner Materialien aufgelistet.
Schäden durch Material- und Produktionsfehler
Schäden durch Materialfehler werden selten dokumentiert. Denn in den Produktnormen sind Vorgaben definiert, welche Eigenschaften Baumaterialien aufweisen müssen. Ausserdem wird die Produktionsqualität meist gründlich überwacht. Dennoch treten vereinzelt Fehler bei der Herstellung auf. Beispielsweise können sich durch eine lückenhafte Oberflächenvorbehandlung Anstriche frühzeitig ablösen (Abb.).
Schäden durch Ausführungsfehler
Nichtbeachtung von Vorschriften
Die vielfältigsten und häufigsten Mängel treten bei der Erstellung der Gebäudefassade auf. Oft entstehen diese bei der Verarbeitung der Bauteile, wenn die geltenden Normen oder Verarbeitungsrichtlinien nicht eingehalten werden. Als Beispiel hat sich bei einer hinterlüfteten Fassade mit grossformatigen Eternitplatten gezeigt, dass sich die in die Holzlattung gesetzten Befestigungsmittel teilweise lösen. Die Gefahr besteht, dass die gesamte Platte abfällt. Nach Demontage der Platten stellte man fest, dass die Holzlattung und Wärmedämmung durchnässt waren (Abb.). Die Untersuchung ergab, dass die seitens der Lieferanten vorgegebenen EPDM-Bänder in den Fugenbereichen fehlten. Dadurch konnte Wasser über die Vertikalfugen direkt in die Wärmedämmebene eindringen.
Von entscheidender Bedeutung ist, die dem jeweiligen System zugeordneten Normen (wie z. B. SIA 232/2, 242, 243, 179) einzuhalten. Ebenso wichtig sind die Verarbeitungshinweise der Lieferanten. Diese sind auch zentral für Garantieleistungen, insbesondere wenn ganze Systemaufbauten verwendet werden.
Fehlende Genauigkeit
Eine unzureichende Ausführungsqualität oder Ungenauigkeiten können Schäden nach sich ziehen. Werden beispielsweise Wärmedämmplatten unsauber verlegt, können Lücken in der Dämmebene entstehen. Aufgrund eines erhöhten Wärmedurchgangs zeichnen sich bei verputzten Aussenwärmedämmungen Plattenstösse ab. Dies kann auch bei einer von der Norm abweichenden Verklebung der Dämmplatten vorkommen. Dabei verformen sich Platten stärker, und die Zwischenfugen werden grösser. Beides lässt sich durch Einhalten der Vorschriften und eine saubere Arbeitsweise vermeiden. Häufig sind Schichtstärken einzelner Lagen nicht gross genug oder variieren stark. Wird z. B. eine Netzarmierung ungenügend eingebettet und bleibt sichtbar, kann diese nicht richtig wirken (Abb.).
Bewegungen und Trennungen
Insbesondere bei Metallkonstruktionen oder Aussenwärmedämmungen mit geklebten Keramik- oder Natursteinriemen können nicht beachtete thermische Längenänderungen zu Beschädigungen führen. Diese Änderungen sind in der Planung zu berücksichtigen (Art der Befestigungen, Trennungen, Fugenraster) und bei der Ausführung zu überprüfen. Längenänderungen können Zugrisse hervorrufen oder Befestigungsmittel bzw. ganze Bekleidungsteile «absprengen» (Abb.). Ähnlich verhält es sich mit Tragwerks-Trennfugen, die bei Fassaden zu berücksichtigen sind.
Ungeeignete Produktkombinationen
Eine fehlerhafte Produktkombination ist meist ein Ausführungsfehler und kann besonders bei Systemaufbauten zu Schäden führen. Die Schichten sind aufeinander abgestimmt und entsprechend geprüft. Durch eine anderweitige Kombination kann der Aufbau als Ganzes versagen. Passen z. B. die Dampfdiffusionswerte der einzelnen Lagen einer verputzten Aussenwärmedämmung nicht zueinander, entstehen bauphysikalische Beeinträchtigungen, die sich zeitnah in Form von Blasenbildungen zeigen. Bereits ein Farbanstrich, der nicht auf die restlichen Aufbauten abgestimmt ist, kann Schäden provozieren. Dies gilt nicht nur für verputzte Systeme, sondern auch für andere nicht hinterlüftete Fassadensysteme. Die Industrie verweist bei Garantieansprüchen auf ihre Verarbeitungsrichtlinien. Bei Abweichungen kann die Garantie verwehrt werden.
Werden Materialien falsch kombiniert, kann dies zur Korrosionen führen oder den gewünschten Verbund beeinträchtigen. Problematisch ist beispielsweise die Kombination von nicht beschichtetem Aluminium und Kupfer. Weitere Beispiele sind Farb- und Schutzanstriche auf einem für das Produkt nicht vorgesehenen Untergrund (Abb.).
Schäden durch Planungsfehler
Zu wenig geplante Details und nicht beachtete Vorschriften
Die Nichtbeachtung von Normen und Vorschriften sowie die fehlende Auseinandersetzung mit Details und Schnittstellen stellen erhebliche Fehlerquellen dar. Häufig werden massgebende Übergänge nicht sorgfältig geplant. Das kann später zu Schäden führen, wenn während der Ausführung unter Zeitdruck der Übergang falsch gebaut wird. Werden beispielsweise Sockelzonen ungenügend geplant, können diese stärkeren Belastungen ausgesetzt sein. In einem mangelhaft konzipierten Detail schliesst die Asphaltfahrbahn direkt an die verputzte Aussenwärmedämmung an (Abb.). Schäden sind schon beim Verarbeiten des heissen Asphalts entstanden. Spritzwasser und die Ausdehnung des Fahrbahnbelags setzen der Sockelzone weiter zu.
Schäden durch benachbarte Bauteile (fehlende Abstimmung)
Werden nicht alle Bauteile der Gebäudehülle in Kombination geplant, ist das Ergebnis oft mangelhaft. Dies zeigt sich z. B. beim Übergang von der Fassade zum Dach. Problematisch wird es, wenn das Wasser vom Dach aufgrund der Dachrandform auf die Fassadenoberfläche gelangt (fehlender Dachüberstand sowie kaum sichtbare Dachabschlüsse). Bei Attikageschossen wird häufig ein abgetreppter Dachrand geplant. Bei diesem trifft Regenwasser auf die Blechteile und fliesst oft an der Fassade ab (Abb.). Ein erhöhter Feuchte- und Schmutzeintrag auf die Fassadenoberfläche führt zu frühzeitiger Pilz- und Algenbildung, insbesondere bei verputzten Aussenwärmedämmungen. Der Schmutz der Dachrandbleche wird direkt auf die Fassadenfläche abgetragen.
Grundsätzlich enthalten die SIA-Normen (insbesondere SIA-271:2007) klare Vorgaben: Dachränder sind zur Dachfläche hin zu entwässern. Allerdings wird der Form und der Maximierung der Raumhöhe oft der Vorzug gegeben. Vergleichbare Probleme können Bauteile der Entwässerung verursachen – z. B. Speier, die aufgrund einer ungünstigen Einbauhöhe Wasser aussen auf die Fassade leiten. Bauteile der Gebäudehülle sind in Kombination zu planen. Dabei ist das Entwässerungskonzept von zentraler Bedeutung.
Weitere Schadensarten
Eine Ursache von Schäden kann die natürliche Alterung der Fassade sein. Jedes Bauteil erreicht irgendwann das Ende seiner Lebensdauer. Vereinzelt entstehen auch Schäden infolge fehlerhaften Unterhalts. Teils reagieren Oberflächenbeschichtungen sensibel auf Reinigungsmittel, deren Einwirkzeit oder den Druck des Reinigungsgeräts (Abb.). Vor der Behandlung grosser Flächen sollten daher vorgängig kleinflächige Tests durchgeführt werden.
Rückschlüsse
Häufig liegt die direkte Ursache von Fassadenschäden nicht im Bereich der Fassade, sondern bei angrenzenden Bauteilen (z.B. Dachrand) oder in der Ausseneinwirkung, die nicht genügend berücksichtigt wurde. Die Fassade sollte nicht als einzelnes und unabhängiges Bauteil isoliert betrachtet werden, sondern muss integral als Teil der Gebäudehülle aufgefasst werden. Wie so oft stellen die Übergänge zwischen verschiedenen Bauteilen die Problemstellen dar. Die Fassade als Bauteil ist dabei der vollen Ausseneinwirkung ausgesetzt. Die zu erwartenden Einwirkungen müssen vorab definiert und die Fassade darauf abgestimmt werden.
Sind diese Grundvoraussetzungen erfüllt, die Fassade geplant und die Materialien dementsprechend ausgewählt, müssen Normen und Vorgaben der Produktlieferanten bei der Ausführung entsprechend umgesetzt werden. Der Kosten- und Termindruck auf der Baustelle ist heute hoch. Die Ausführung ist daher mit den grössten Risiken verbunden. Für Bauherren und Verarbeiter würde sich genügend Zeit in die Kontrolle der Ausführung zu investieren auszahlen.
Anmerkung:
[01] Sacha Menz, Oliver Kriebus: Mängel im Hochbau – Empfehlungen für Ausführende und Entscheidungsträger, 2013, ISBN 978-3-9524170-0-3TEC21, Fr., 2017.06.16
16. Juni 2017 Lorenzo Nägeli