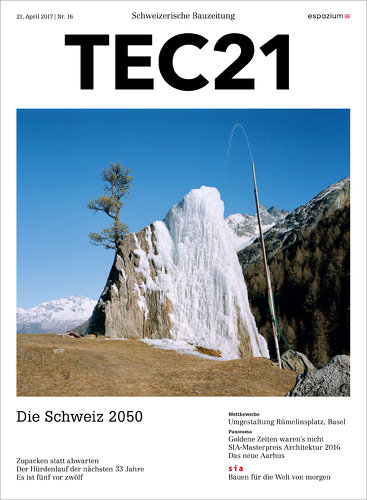Editorial
Vor zwei Jahren lancierte der SIA das Projekt «Die Schweiz 2050»: Akteure aller seiner Berufsgruppen sollen – gemeinsam mit weiteren Fachleuten und Partnern – eine ganzheitliche Entwicklungsstrategie für die Schweiz entwerfen. Laufen soll das Projekt bis 2020, es ist also nicht einmal Halbzeit; die Hauptarbeit bleibt zu tun. Warum jetzt darüber berichten?
Da ist zum einen die politische Aktualität: Am 21. Mai 2017 entscheidet das Stimmvolk über das revidierte Energiegesetz. Wie auch immer das Ergebnis ausfällt, es wird einschneidende Folgen für unseren gebauten Lebensraum haben. Denn Hochbauten und Infrastruktur – Energieanlagen, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Verkehrsnetze – bedingen sich gegenseitig. Und gerade die Infrastruktur ist eine wichtige Basis unseres Wohlstands. Ihr Wiederbeschaffungswert beträgt ca. 2500 Milliarden, die jährlichen Investitionen über 60 Milliarden Franken. Wenn sie für eine wachsende Bevölkerung ausgebaut werden soll, lohnt es sich, frühzeitig übergeordnete Ziele zu formulieren. Genau das ist Sinn und Zweck des SIA-Projekts.
Zum anderen darf bei dieser Selbstreflexion, und sei sie noch so visionär, nicht vergessen gehen, dass die Schweiz ein sehr kleines Land in einer sehr bewegten Welt ist. Globale Entwicklungen wie die Bevölkerungsexplosion oder der Klimawandel prägen das Land schon heute. Die Schweiz kann solche Realitäten nicht aufhalten, aber vielleicht als privilegiertes «Labor» neue Ideen für eine nachhaltigere Welt testen. Auf jeden Fall muss sie, wenn sie ihre Zukunft plant, den Rest der Menschheit berücksichtigen.
Um darüber nachzudenken, ist es nie zu früh.
Judit Solt, Paul Knüsel
Inhalt
AKTUELL
07 WETTBEWERBE
Mehr Platz
12 PANORAMA
Goldene Zeiten waren’s nicht | SIA-Masterpreis Architektur: Verunsicherung und neue Balance | Das neue Aarhus | Iran und seine Architektur
20 VITRINE
Salone del Mobile 2017
22 SIA
«Ich möchte, dass die Schweiz in der Energiefrage zu den Vorreitern gehört» | Bauen für die Welt von morgen
27 VERANSTALTUNGEN
THEMA
28 DIE SCHWEIZ 2050
28 ZUPACKEN STATT ABWARTEN
Judit Solt
Der SIA erarbeitet eine Zukunftsvision für einen qualitätsvollen Lebensraum. Das Projekt ist aussergewöhnlich.
31 DER HÜRDENLAUF DER NÄCHSTEN 33 JAHRE
Paul Knüsel
Verdichten oder Abwandern? Mehr Verkehr, weniger Energie? Fachleute debattieren über die Zukunft der Schweiz.
35 ES IST FÜNF VOR ZWÖLF
Franz Josef Radermacher
Die globale Zukunft scheint düster: Zweiklassengesellschaft und ökologischer Kollaps sind wahrscheinlicher als eine nachhaltige Entwicklung. Was kann die Schweiz tun?
AUSKLANG
39 STELLENINSERATE
45 IMPRESSUM
46 UNVORHERGESEHENES
Zupacken statt abwarten
Mit dem Projekt «Die Schweiz 2050» erarbeitet der SIA eine Vision für einen qualitätsvollen Lebensraum. Der interdisziplinäre Ansatz ist ebenso aussergewöhnlich wie der aufgeschlossene Geist hinter dem Projekt: Die Zukunft ist nicht etwas, das in Prognosen angekündigt wird, sondern ein Ziel, das Planerinnen und Planer gestalten können – und sollen.
Vor zwei Jahren lancierte der SIA das Projekt «Die Schweiz 2050» mit dem Ziel, eine Vision für die Schweiz zu entwerfen und sich dafür einzusetzen, dass sie auch realisiert wird. Dafür hat er Eigenschaften definiert, die er für den zukünftigen Lebensraum Schweiz als wünschenswert erachtet. Neu sind diese nicht: eine hohe Lebensqualität, die nachhaltige Nutzung und Gestaltung der Landschaft und des Gebauten, Umweltschutz, effektive Energieversorgung und Mobilität. Dennoch ist das Projekt etwas Besonderes, sowohl in Bezug auf die Methode als auch auf die Grundhaltung, auf der es basiert.
Ganzheitlich und optimistisch
«Die Schweiz 2050» ist interdisziplinär angelegt und verfolgt einen integrierenden Ansatz. Es geht also nicht um die Lösung von einzelnen Aufgaben der Landschafts-, Infrastruktur-, Verkehrs-, Siedlungs- und Stadtplanung, sondern darum, die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Faktoren und Akteuren zu nutzen. Das bedingt ganzheitliches statt sektorielles Denken – in einer Zeit der Spezialisierung ein geradezu extravaganter Anspruch. Anstatt komplexe Themen in isolierte Teilfragen zu zergliedern und an Spezialisten zu verteilen, die unabhängig voneinander arbeiten und schwer kompatible Ergebnisse produzieren, soll vorerst eine gemeinsame Vision entwickelt werden. Erst dann, mit diesem verbindenden Ziel, sollen sich die verschiedenen Disziplinen an die Lösung ihrer spezifischen Aufgaben machen. Dies betrifft die ganze Bandbreite des Planens und Bauens, gefordert sind aber auch die Geistes- und Sozialwissenschaften.
Vor allem aber hebt sich der Vorsatz, eine Vision zu entwickeln, erfrischend vom Vorgehen der Zukunftsforschung ab. Eine Vision kann sich komplett von der Realität lösen; Prognosen dagegen, wie sie die Zukunftsforschung liefert, leiten sich von einem realen Ausgangspunkt ab. Die Zukunftsforschung analysiert in erster Linie die Vergangenheit und die Gegenwart, um bestehende Entwicklungen zu identifizieren; anschliessend extrapoliert sie diese mit diversen Rechenmodellen, um vorhersagen zu können, welche Folgen zu erwarten sind. In anderen Worten: Die Zukunftsforschung untersucht bereits angebahnte Wege, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wohin sie führen. Sie eruiert die Wahrscheinlichkeit verschiedener Szenarien, auf die sich die Menschen bestmöglich einstellen sollen. Dahinter steckt die etwas resignative, fatalistische Überzeugung, man könne zwar auf die Zukunft reagieren, sie aber kaum aktiv gestalten.
Das Projekt «Die Schweiz 2050» dagegen atmet einen anderen, optimistischeren Geist – und geht genau umgekehrt vor: Man will gemeinsam ein Idealbild des Lebensraums entwerfen und erst dann untersuchen, wie aktuelle Entwicklungen gesteuert werden können, um es zu verwirklichen. Die Zukunft soll nicht hingenommen, sondern lustvoll entworfen und aktiv gestaltet werden. Oder, um die Analogie wieder aufzugreifen: Man legt ein Ziel fest und sucht anschliessend nach geeigneten Wegen, um es zu erreichen.
Planungsfachleute erheben die Stimme
Den Auftrag für dieses Projekt hat sich der SIA selbst erteilt. Dahinter steckt die Überzeugung, dass er als interdisziplinärer, normengebender Verband von Baufachleuten die Kompetenz, die Verantwortung und die zivilgesellschaftliche Verpflichtung hat, eine öffentliche Diskussion über die Zukunft der Schweiz anzuregen (vgl. «Bauen für die Welt von morgen»). In letzter Konsequenz ist das ein Aufruf an alle Baufachleute, jenseits des Berufsalltags und der konkreten Aufträge darüber nachzudenken, welchem übergeordneten Ziel die eigene Tätigkeit zu dienen habe.
Wie der Lebensraum Schweiz im Jahr 2050 tatsächlich beschaffen sein wird, können wir nur bedingt beeinflussen. Globale Entwicklungen wie der Klimawandel oder die Bevölkerungsexplosion werden viel tiefer greifende Konsequenzen haben als lokale Planungen (vgl. «Es ist fünf vor zwölf»). Umso wichtiger ist, dass die Schweiz ihre privilegierte Lage nutzt, um ihren – wenn auch bescheidenen – Handlungsspielraum optimal zu nutzen. Denn die Schweiz kann es sich leisten, nachhaltige Planungsansätze zu erproben und umzusetzen, woraus sich wiederum neue Perspektiven in einem viel grösseren Massstab ergeben könnten.
Den Papiertiger zum Leben erwecken
Noch steckt dieses mutige, für die besonnene Schweiz untypische Projekt in den Anfängen. Doch dass es überhaupt in dieser Art konzipiert wird, deutet darauf hin, dass die Planerbranche sich eine neue Freiheit des Denkens und eine stärkere politische Präsenz erkämpfen will. Das ist eine gute Nachricht.
Nun gilt es, die Absichtserklärung in Taten umzusetzen. Erste Ergebnisse aus der Initialphase liegen vor und wurden teilweise publiziert (vgl. Kasten unten). Gespräche mit Fachstellen und Behörden haben stattgefunden und sollen in wechselnden Konstellationen weitergeführt werden (vgl. «Der Hürdenlauf der nächsten 33 Jahre»). Weitere Partner werden ins Projekt einbezogen. Wünschenswert wären aber auch offene Calls for Ideas, Hearings in verschiedenen Regionen und Workshops mit lokalen Entscheidungsträgern.
Vor allem aber braucht es eine breit abgestützte, offene Diskussion – unter Planungsfachleuten und in weiten Teilen der Gesellschaft. Denn wenn die erarbeitete Vision nicht wie Tausende früherer Ideen, Gutachten, Testplanungen und Expertenberichte in einer Schublade verschwinden, sondern die Planungspolitik der Schweiz verändern soll, dann muss sich die Öffentlichkeit damit identifizieren können. Die Vision muss gesellschaftliche Relevanz bekommen und jene politische Reife erreichen, die es braucht, damit das Stimmvolk darüber befindet. Erst dann wird es gelingen, die Kompetenz der SIA-Fachleute und der Projektpartner in der Realpolitik zu verankern.TEC21, Fr., 2017.04.21
21. April 2017 Judit Solt
Der Hürdenlauf der nächsten 33 Jahre
Verdichten oder Abwandern? Stadt der kurzen Wege oder monotone Wohnquartiere? Mehr Verkehr, aber weniger Energie? Fachleute aus Planung, Verwaltung und Forschung haben sich an einer Klausur über die erwünschte und mögliche Zukunft der Schweiz unterhalten.
Was geht ab in der Schweiz im Jahr 2050? Mindestens 9.4 Mio. Menschen leben dannzumal im Land, eine Million mehr als heute. Die Zuwanderung lässt die Bevölkerung weiter wachsen, die Geburtenrate dagegen stockt. Gemeinsam steigern In- und Ausländer das Bruttosozialprodukt: In 33 Jahren erwirtschaftet die Schweiz einen Fünftel mehr als letztes Jahr, nämlich 800 Mrd. Franken. Die Löhne legen sogar um 25 % zu.
Und weil (fast) alle auf ein Dach über dem Kopf zum Wohnen und Arbeiten angewiesen sind, dehnt sich auch der Siedlungsraum weiter aus. Das hat zur Folge, dass sich die Energiebezugsfläche von momentan 500 Mio. m2 bis Mitte Jahrhundert auf 666 Mio. m2 erhöht. Dichter werden auch die mobilen Wechselbeziehungen: Angetrieben von zusätzlichem Gütertransport auf Strasse und Schiene nimmt der Gesamtverkehr um 40 % zu. Was also geht ab in der Schweiz im Jahr 2050? Die kurze Antwort darauf: das Gleiche wie bisher. Das Wachstum setzt sich fort, der Wohlstand steigt, und der Konsum legt ebenfalls zu.
Spätestens hier folgt nun aber die Zusatzfrage, wie nachhaltig diese Entwicklung wird: Lassen sich Ressourcenbedarf und Energieverbrauch vom Wirtschaftswachstum entkoppeln? In wenigen Wochen wird über die Energiestrategie 2050 abgestimmt. Ein Ja könnte die Trendumkehr bedeuten: Der Stromkonsum würde nicht um 15 % steigen, sondern in den kommenden drei Jahrzehnten 10 % geringer werden. Und der Verbrauch aller Energieträger könnte sogar bis auf 50 %, im Vergleich zum Stand heute, sinken.
Die genannten Prognosen beschreiben die Schweiz der nächsten Generationen; die Zahlen sind seriös und stammen aus staatlichen Quellen. Trotzdem sind die Annahmen mit Vorbehalt zu geniessen. Denn wie man lebt, wohnt, arbeitet, konsumiert und welchen Preis die Natur dafür verlangt, bleibt unbekannt. Die Zukunftsfrage hat auch eine qualitative Dimension. Wie sich die Schweiz entwickelt, ist nicht zuletzt das Resultat politischer Bemühungen.
Müssen beispielsweise noch effizientere Technologien, Fahrzeuge und Häuser als heute erforscht werden? Oder entdecken die Nutzerinnen und Nutzer den suffizienten Konsumverzicht? Und wie gross wäre das nachhaltige Wohnflächenmass? Sachpolitische, ökonomische, technische und gesellschaftliche Grundsatzfragen sind die Hürden im Lauf in die Zukunft. Deshalb wollte die SIA-Spitze von Vertretern aus Planung, Privatwirtschaft und Verwaltung wissen, wie hoch diese sind und durch welche Qualitäten sich die «Schweiz 2050» auszeichnen wird.
Im letzten Herbst fand eine Klausurtagung statt, an der sich zwei Dutzend Fachleute beteiligten. Die Runde aus Chefbeamten des Bundes und der Kantone, Vertretern von Unternehmen, Wissenschaft und Verbänden versammelte sich auf dem Monte Verità oberhalb Locarno und tauschte sich informell über Themen aus, die die aktuelle und absehbare Agenda bestimmen und zur Gestaltung eines nachhaltigen Lebensraums Schweiz beitragen können. Es zeigte sich, wie herausfordernd der technische Fortschritt, die ökonomische Entwicklung, aber auch der demokratische Prozess für die Zukunftsgestaltung sind.
Stellvertretend tauchten weitere Fragen auf: Welche Ansprüche hat die Gesellschaft an Raum und Siedlung? Wer sind die treibenden Akteure? Und welche Eigentumskonflikte ergeben sich bei der weiteren Verknappung des öffentlichen Raums? Um vorschnelle Antworten war man weniger bemüht. Hingegen wies man wiederholt daraufhin, dass eine gesellschaftliche Wertediskussion unabdingbar ist: Wie dicht darf eine Zehn-Millionen-Schweiz sein? Wird weiter in die Fläche oder nun eher in die Höhe gebaut?
Wird Infrastruktur zur Privatsache?
Die Rolle des Staats wurde grundsätzlich diskutiert: Welche Zukunft hat der Föderalismus? In der Raumplanung und bei der Organisation des Service public wird immer häufiger beklagt, wie gross die Kluft zwischen staatlicher Hoheitsstruktur und funktional wahrgenommenen Räumen bereits geworden ist. Helfen virtuelle Servicewelten, diesen Graben wieder zu schliessen? Selbst für Betriebe, die einen Teil der öffentlichen Grundversorgung garantieren, sind hybride Geschäftsmodelle mittlerweile opportun. Der physische Zugang wird zunehmend elektronisch programmiert, sodass die dezentrale Versorgung lückenhaft wird. Solche Bedenken wurden an der Klausur wiederholt formuliert. Denn die Vielfalt sei zu erhalten, als unerlässliches Gut für das kulturelle, räumlich-funktionale und urbanisierte Verständnis der Schweiz.
Eine weitere, bisher selbstverständliche Aufgabe der öffentlichen Hand ist die Infrastrukturplanung. Auch hierzu kann die künftige Rolle anders interpretiert werden: Behält der Staat die alleinige Verantwortung, oder sollen private Institutionen am Ausbau beteiligt werden? Ein Fallbeispiel dafür stellt die künftige Organisation des Güterverkehrs dar, wobei hier tief greifende Veränderungen für die räumliche Entwicklung von Agglomerationen und Städten absehbar sind.
Gütermarkt als primärer Profiteur
Die Diskussion über ein neuartiges unterirdisches Logistiksystem, das den Warenverkehr in der Schweiz straffen und bündeln soll, zeigt, wie der Hürdenlauf ins Jahr 2050 aussehen kann. Am Anfang steht eine kühne Privatidee inklusive Businessplan: Cargo Sous Terrain CST ist ein Tunnelnetz mit 900 km Länge, das für etwa 30 Mrd. Franken in den Boden der Schweiz gebohrt werden soll, um die Städte direkter und schneller zu verbinden. Der wachsende Markt im Paket- und Kurierdienst und die Online-Kundschaft wären die primären Nutzniesser: Kleingüter werden über lange Distanzen im Untergrund transportiert. Sammelstellen an den Stadträndern dienen der Feinverteilung, die durch eine City-Logistik koordiniert erfolgt.
Unabhängig davon, ob ein solches Unternehmen realisierbar ist, benennt es zentrale Anliegen: Der motorisierte Stadtverkehr, ob von Pendlern oder Waren verursacht, dürfte den Platz verknappen. Demgegenüber benötigen die zusätzlichen Stadtbewohner mehr öffentlichen Raum. Das Verkehrsaufkommen in Innenstädten steht daher der Entwicklung nach innen und der Aufwertung der Wohnstädte entgegen. Auch das Ruhebedürfnis und der Verkehrslärm bleiben ein konfliktreicher Dauerbrenner. Insofern lassen neue Technologien und Systeme hoffen, dass die physische Mobilität weniger Fläche beanspruchen soll. Dazu beitragen könnte die Verlagerung der Warentransporte in den Untergrund oder in die Luft (Drohne). Und das fahrerlose Kleinauto verspricht, auf Dauerparkplätze im Stadtzentrum verzichten zu können.
Zusätzliche Räume für den Verkehr
Allerdings bleibt der Pneu unersetzbar: Tendenziell fährt der öffentliche Nahverkehr eher auf der Strasse als auf der Schiene (aus Effizienzgründen ohne Chauffeur, wie der Postauto-Testbetrieb in Sitten demonstriert). Und dank der Elektromobilität könnte auch die Zukunft des individuellen Personenverkehrs gesichert sein. Für den Gütertransport wird der Strommotor hingegen keine ernsthafte Ersatzoption darstellen.
Zusätzliche Räume, Flächen und Finanzen benötigt der Verkehr aber weiterhin, sowohl für die Hardware (zum Unterhalt der Strassen und zum Ausbau der Engpässe) als auch für die Telematik-Software. Intelligente Lenkungssysteme sollen die Effizienz auf bestehenden und künftigen Verkehrsflächen verbessern. Allerdings ist ein Verteilkampf absehbar, weil die Prioritäten für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer und Transportmittel auszuhandeln sind. Der inländische Alptransit-Korridor wird, analog zum Stadtverkehr, zum gewichteten Abwägungsfall: Wer erhält Vortritt bei begrenzten Strassen- oder Trassenkapazitäten? Und wie sind die Ansprüche zwischen Regionalverkehr und internationalem Güter- respektive Personenverkehr zu regulieren?
Räume entwickeln sich polyzentrisch
Was an der Zukunftsklausur ebenfalls erörtert wurde: Aktuell tendiert die Raum- und Siedlungsentwicklung zur Konzentration auf Zentren und Abwanderung aus Bergregionen. Beim Zoom auf die Wachstumsorte taucht jedoch eine erstaunliche Binnendifferenzierung auf. In den Siedlungsgürteln wurde zuletzt mehr gebaut als in den gewachsenen, oft geschützten Zentren. Der Auszug von Firmen führt zur Entmischung der Wohn- und Arbeitswelten. Die Stadt der kurzen Wege scheint eine gute Absicht; in der Realität urbanisieren sich jedoch die Agglomerationen. Um die Lebensqualität im Siedlungsraum sicherzustellen, soll das Quartier als fassbare Raumeinheit gefördert werden. Hier lassen sich Identität und bauliche Verdichtung kombinieren. Zudem mischen sich in diesem sozial überblickbaren Planungsformat private und öffentliche Nutzungsbedürfnisse.
Und ein weitere ökonomische Kraft zerrt an der nachhaltigen Raumplanung: Alles will in die Stadt. Den Kontrast zu dieser Strömung bilden polyzentrisch entwickelte Räume und eine Peripherie mit mehr qualitativem Gewicht. Daher müssen die aktuellen Tendenzen weiterverfolgt werden, Baugebiete entlang von Verkehrskorridoren zu verdichten und die relativen Wohnflächen zu reduzieren. Aber dass die Dezentralisierung nicht die nächste Zersiedelungswelle verursacht, ist eine zentrale Herausforderung an die Raumplanung.
Eine künftige Spezialaufgabe wird auch der Umgang mit den zunehmenden Gebäudeleerständen an peripheren Lagen sein. Für die Inwertsetzung von Brachen, die inzwischen vor allem ausserhalb der Siedlungs-Hotspots liegen, sind robuste Konzepte gesucht. Vielfalt und Flexibilität sind die Zutaten einer resilienten Raumentwicklung. Für Abwanderungsregionen ist der Grat allerdings schmal: Benötigen die betroffenen Täler und Dörfer eine Reanimation, oder ist das Schrumpfen aktiv zu begleiten? Und es stellt sich die politische Frage, ob die Entwicklung von Randregionen, falls neue Verkehrsachsen gebaut werden, zulasten bestehender Wachstumsoptionen andernorts gehen darf?
Wie die Verkehrszukunft ist auch die Raumplanung auf angemessene finanzielle Mittel angewiesen. Weil die meisten Menschen in kleinen und mittelgrossen Gemeinden mit Verdichtungsreserven leben, erhöht sich der raumplanerische Steuerungsbedarf. Es braucht folglich mehr Ressourcen, damit die Planungsmiliz auf professionelle Verfahren zurückgreifen kann.
Reichtum auf kleiner Fläche
Wie wohnt und arbeitet die Schweiz 2050? Die Klausurteilnehmer wollten und konnten weder ein stimmiges Bild zeichnen noch eine konsensfähige Vision vermitteln. Aber als zentrales Qualitätskriterium wurde die Diversität bestimmt, die als identitätsstiftende, aber bedrohte Ressource der Schweiz wahrgenommen wird. Damit sind kulturelle Eigenheiten sowie Landschaftsqualitäten gemeint, die durch einen unglaublichen Reichtum auf kleiner Fläche charakterisiert sind. Daher braucht es Konzepte, diese Vielgestaltigkeit vor dem masslosen Zubauen zu bewahren. Ausserdem sind Ideen für strukturschwache Räume gefragt. Diese Diskussion über Werte und Visionen soll aber nicht nur im engen Kreis der Ämter und Fachgremien, sondern darüber hinaus weitergeführt werden – darin war man sich einig.TEC21, Fr., 2017.04.21
21. April 2017 Paul Knüsel
Es ist fünf vor zwölf
Die Menschheit wächst exponentiell und betreibt Raubbau an ihrem Planeten. Forscher sehen drei Möglichkeiten für die Zukunft: einen ökologischen Kollaps, eine weltweite Zweiklassengesellschaft oder, wenn die Vernunft siegt, eine nachhaltige globale Entwicklung. Leider scheinen die Schreckensvisionen am wahrscheinlichsten. Was bedeutet das für die Schweiz?
Die Zukunft bewegt viele Menschen, entsprechend zahlreich sind die Zukunftsvisionen. Das bleibt nicht ohne Folgen: Bereits in der heutigen Welt sind die globalen Verknüpfungen eng und die gegenseitigen Abhängigkeiten komplex. Wer seine Zukunft plant, kommt nicht darum herum, auch jene der anderen zu berücksichtigen – und insbesondere auch Teile der Welt im Fokus zu behalten, die heute wenig beachtet werden. Die Afrikanische Union zum Beispiel veröffentlichte 2013, zum 50-Jahr-Jubiläum ihrer Gründung, den Bericht «Agenda 2063: The Africa We Want» mit ihren Zielen für die nächsten 50 Jahre. Dazu gehören unter anderem eine kontinental enge wirtschaftliche Zusammenarbeit und ein hoher Wohlstand. Aktuelle Arbeiten des Club of Rome und des deutschen Senats der Wirtschaft, die an einem Marshallplan mit Afrika arbeiten, zielen in eine vergleichbare Richtung.[1]
Globaler Kollaps als echtes Risiko
Die Frage ist, ob und wie solche Hoffnungen in Wirklichkeit umgesetzt werden können. Der Club of Rome hat bereits 1972 mit dem Buch «Die Grenzen des Wachstums»[2] auf die Gefahren der damaligen Entwicklung hingewiesen: Wenn die Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhielten, wären die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde innert hundert Jahren erreicht. Sollten zu diesem Zeitpunkt die Umwelt irreparabel beschädigt und die Rohstoffe aufgebraucht sein, würden die industrielle Kapazität und die Bevölkerungszahl dramatisch einbrechen.
Das Buch wurde zum Bestseller und löste heftige politische Debatten aus. Die Situation hat sich seit seinem Erscheinen indes nicht wesentlich verbessert. Im Gegenteil: 2004 veröffentlichten seine Autoren eine Studie über die Entwicklung von 1972 bis 2002 und zeigten, dass das soziale Gefälle grösser geworden sei (20 % der Erdbevölkerung verfügten über 85 % des globalen BIP), die Bodenqualität sich verschlechtert habe (40 % der Ackerflächen würden übernutzt) und die Meere überfischt seien (75 % der Fischbestände seien bereits weg). Die Kapazität der Erde, Rohstoffe zur Verfügung zu stellen und Schadstoffe zu absorbieren, sei bereits 1980 überschritten worden und werde weiterhin überschritten – im Jahr 2004 schon um ca. 20 %.
2008 präsentierte Graham Turner von der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation CSIRO eine Untersuchung, in der er die 1970 bis 2000 erfassten Daten mit den Vorhersagen in «Die Grenzen des Wachstums» verglich. Er fand eine grosse Übereinstimmung mit dem Standardszenario, das einen globalen Kollaps in der Mitte des 21. Jahrhunderts enthält.[3] 2014 schliesslich veröffentlichte Jørgen Randers, einer der Co-Autoren des Bestsellers von 1972, das Buch «2052 – Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre».[4] Auch er sieht viele der ursprünglichen Befürchtungen bestätigt und ortet wenig Hoffnung für eine positive Entwicklung.
Ähnliche Szenarien hatte der Autor dieses Artikels kurz zuvor in zwei Studien vorgelegt, die beide auf das Jahr 2050 abzielten.[5] Sie identifizieren drei mögliche Richtungen, in die sich die Zukunft entwickeln könnte: zu einer nachhaltigen Welt, einer Weltzweiklassengesellschaft oder einem ökologischen Kollaps. Die nachhaltige Welt erscheint dabei als der unwahrscheinlichere Fall; Randers hält sie sogar für extrem unwahrscheinlich.
Wohlstand hat System
Und die Schweiz? Worauf kann und soll sie sich gefasst machen als winziger Teil einer Welt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine unerfreuliche Zukunft zusteuert? Das Land hat heute 8,3 Millionen Einwohner, bis 2050 könnten es 10 Millionen[6] sein (vgl. «Der Hürdenlauf der nächsten 33 Jahre»). Rundherum in die Europäische Union eingebettet, ist die Schweiz eines der reichsten und erfolgreichsten Länder der Welt. Sie zeichnet sich durch eine bürgernahe Demokratie, häufige Volksabstimmungen und ein Miteinander vieler kultureller Traditionen und Sprachen aus. Hinzu kommt ein Konsensregime bezüglich der Regierungsbildung, wobei der Konsens und die Toleranz auf der Ebene der Parteien zunehmend erodieren.
Die Schweiz ist politisch neutral und blickt auf viele Jahrzehnte Frieden zurück, in denen sie systematisch ein funktionierendes Gemeinwesen und einen Wohlstand aufgebaut hat, die ihresgleichen suchen. Von aussen betrachtet wird die Schweiz mit Sicherheit assoziiert: Hier sind Geld und Leben sicher, hier kann man sich auf hohem Niveau zurückziehen; hier funktionieren die Gerichte, die Verwaltung, die Governance. Die Schweiz ist eine sichere Oase in einer deutlich weniger sicheren Welt. Wird es ihr gelingen, diese Position auch 2050 zu halten?
Fragt man nach den Voraussetzungen für den Wohlstand von Staaten, stösst man in erster Linie auf systemische Einflussgrössen.[7] Dabei wird deutlich: Die Eckpfeiler des Wohlstands liegen in den Punkten Governance, Ausbildungsniveau, Qualität des Kapitalstocks, Qualität der Infrastruktur, Finanzsystem, Innovationssystem, Zugriff auf benötigte Ressourcen und Einbettung in internationale Wertschöpfungsketten. Staaten, bei denen diese Elemente gut entwickelt sind, sind reich; von jenen Staaten, in denen auch nur eine dieser Komponenten ausfällt, ist kein einziger als reich einzustufen – ausser Länder mit relativ kleiner Bevölkerung, die zum Beispiel als Steuerparadiese oder weil sie auf einer Ölquelle sitzen am Reichtum anderer partizipieren.
Die Gehälter, die für einzelne Tätigkeiten gezahlt werden, hängen entscheidend von der Leistungsfähigkeit des jeweiligen Systems ab, mehr als von der konkreten Tätigkeit selbst. Deshalb spielt es für die Lebenssituation von Menschen eine grosse Rolle, in welchem Land sie leben. Die Schweiz hat in Bezug auf die Eckpfeiler des Wohlstands eine lange Tradition. Aus diesem Grund steht sie so gut da, und aus diesem Grund wollen viele Menschen in der Schweiz leben.
Verlierer der Globalisierung
Der Wohlstand der Schweiz hängt aber auch von der Stabilität ihres direkten geografischen Umfelds und der Welt als Ganzer ab. Auch sie ist von jenen unangenehmen Trends betroffen, die sich zurzeit weltweit beschleunigen und mit Nachhaltigkeit nicht kompatibel sind: Wir verbrauchen immer mehr Ressourcen, eine Klimakatastrophe baut sich auf, und die Weltbevölkerung wächst weiterhin exponentiell.
Insbesondere die explodierende Bevölkerung in Afrika, die in 2050 schon jenseits von 2 Milliarden Menschen und in 2100 jenseits von 4 Milliarden liegen könnte,[8] sowie die sich verschärfenden Klimaprobleme, gerade auch in armen Ländern des Südens, können für unsere Zukunft sehr negative Auswirkungen haben. Angesichts der weltweiten Armut und der ungenügenden oder falsch strukturierten finanziellen Hilfe der reicheren an die ärmeren Länder sind weitere Probleme zu erwarten, vor allem in Bezug auf die Migration: «Wenn ihr unsere Probleme nicht zu lösen helft, kommen die Probleme zu euch, und zwar auf zwei Beinen.»
In der forcierten Migration der letzten zwei Jahre nach Europa haben wir gesehen, was es bedeuten kann, wenn auch nur eine Million Menschen «plötzlich» in Europa als Migranten auftauchen. Eine solche Situation kann unser gesamtes politisches System, kann Europa destabilisieren. Ähnliche Entwicklungen sind auch in den USA zu beobachten.
Hinzu kommt, dass sich die ökonomische Schere in vielen Ländern – vor allem weltweit, aber auch in Europa – zunehmend öffnet.[9] Daraus resultieren sehr viel Armut und Unzufriedenheit. Die OECD spricht von «record-high levels of inequality in many countries». Der Brexit ist eine unmittelbare Folge dieses Trends. Ähnliches gilt für die USA, dort festzumachen an der Wahl des neuen Präsidenten. Die Konsequenzen sind Re-Nationalisierungstendenzen in vielen Ländern, auch in Europa und in den USA. Letztlich ist auch der Zusammenhalt der EU bedroht.
Die Verlierer der Globalisierung machen sich in den reichen Ländern zunehmend bemerkbar. Sie sind aus nachvollziehbaren Gründen unzufrieden mit dem Status quo. Sie reiben sich an den Gewinnern der Globalisierung, insbesondere auch daran, dass sich diese oft weitgehend der Besteuerung entziehen. Sie argumentieren deshalb gegen den freien Handel und oft auch gegen den freien Kapitalverkehr, und sie schauen kritisch auf diejenigen Banken und Staaten, die mit der Verwahrung von Geld ihr Geld verdienen. Obwohl die Schweiz in den letzten Jahren einiges in Richtung Transparenz und internationaler Datenaustausch über Konten und ihre Inhaber verändert hat, ist sie nach wie vor Zielobjekt kritischer Beobachtung. Hier drohen weitere Schwierigkeiten – und zwar aus der reichen Welt; erwähnt sei hier die neue amerikanische Politik.
Düstere Aussichten
Es wäre ein Fehler zu glauben, dass die Geschichte zum Schluss immer gut ausgeht. Die Zukunft der Welt wird vielleicht schlecht aussehen. Die oben erwähnten Analysen deuten darauf hin, dass global ganz andere Szenarien wahrscheinlicher sind als Nachhaltigkeit und Balance – etwa ein ökologischer Kollaps, das heisst ein Zusammenbruch grosser ökologischer Systeme, potenziell verbunden mit dem Tod hunderter Millionen Menschen, zum Beispiel als Folge des Klimawandels; oder aber eine weitere Bewegung in Richtung einer weltweiten Zweiklassengesellschaft (Brasilianisierung), also eine sich weiter öffnende Schere überall auf der Welt.
Die Wahrscheinlichkeitsschätzungen des Autors betragen etwa 35 % für Balance, 50 % für Brasilianisierung und 15 % für einen ökologischen Kollaps. Jørgen Randers schätzt die Wahrscheinlichkeit für Nachhaltigkeit noch viel kleiner ein. Er bezeichnet die beiden anderen Szenarien als «overshoot and managed decline» (Weltzweiklassengesellschaft) oder «overshoot and decline enforced by nature» (ökologischer Kollaps). Zu berücksichtigen ist dabei immer, dass solche Wahrscheinlichkeiten wegen des chaotischen Übergangs der Entwicklungen nicht berechnet, sondern nur plausibilisiert werden können.
Grosse Sorgen bezüglich einer Zweiklassengesellschaft haben in jüngerer Zeit mehrere prominente Ökonomen geäussert.[10] Egal, wie weit wir in Europa gegen die beiden wenig schönen Szenarien anzugehen versuchen: Läuft der weltweite Trend in diese Richtung, trifft es uns über die weltweiten Verknüpfungen auch, verbunden mit Wut der Bürger, Re-Nationalisierung und Unterminierung der Demokratie. In der Folge wird es auch in Europa und in der Schweiz deutlich bergab gehen. Die Möglichkeiten einzelner Länder, erfolgreich dagegen zu halten, sind begrenzt.
Ökologie, Inklusion und Stabilität
Natürlich ist auch eine zukünftige Welt vorstellbar, in der eine nachhaltige Entwicklung gelingt. Doch dazu muss die internationale Kooperation verbessert werden. Die damit verbundene Ausdehnung des internationalen Handels hätte eine Erhöhung der Gesamtwertschöpfungsfähigkeit zur Folge. Um nachhaltig zu sein, müsste diese aber reguliert werden; nötig sind ein konsequenter Umwelt- und Klimaschutz sowie eine vernünftige nationale und internationale Verteilung der Wohlstandsgewinne (Inklusion). Daran hapert es bis heute massiv. Immerhin hat sich seit der Weltfinanzkrise 2007 die internationale Beurteilung der Lage verändert: Statt für freie Märkte argumentieren die Vereinten Nationen, die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, aber auch die OECD heute vermehrt für sogenannte «green and inclusive markets». Das entspricht dem europäischen Paradigma der ökosozialen Marktwirtschaft.
Ein wesentliches Element einer solchen Struktur ist ein Finanzausgleich zwischen den Staaten, ähnlich dem internen Finanzausgleich, der für alle entwickelten Staaten – auch für die Schweiz – charakteristisch ist. Auf internationaler Ebene ist allerdings die Organisation einer solchen Ausgleichsfinanzierung schwierig und trifft generell auf grossen Widerstand der reichen Länder.
Eine Alternative zu Transferzahlungen bietet eine adäquate Verwaltung und Bepreisung von knappen Weltgemeinschaftsgütern (Global Commons), etwa die Atmosphäre, Rohstoffe auf dem Meeresboden, die Arktis und Antarktis, die Nutzung der Atmosphäre als CO2-Deponie, die Nutzung des Luftraums als Medium für die Nachrichtenübermittlung und die Nutzung des Weltraums. International wird dieser Ansatz unter der Thematik einer fairen Bepreisung der Global Commons diskutiert. In diesem Zusammenhang steht auch die Vergabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften an Elinor Ostrom 2009.[11]
Neben diesen Tendenzen wird auch die digitale Transformation starken Veränderungsdruck erzeugen. Sie kann viele gut dotierte Arbeitsplätze kosten. Der Druck durch immer intelligentere Systeme wird zunehmen. Unter Wettbewerbsbedingungen gilt es, auch bei diesem Thema vorn dabei zu sein. Das gelingt der Schweiz mit ihrer qualitativ hochwertigen Wissenschaft bisher sehr gut. Ähnlich steht es auch in anderen aktuellen Bereichen: So hat die Schweiz die Klima- und Energieprobleme zum politischen Thema gemacht, allerdings mit mehr Vorsicht und Augenmass als Deutschland; so nutzt sie das Instrument der Kompensation von CO2-Emissionen konsequenter als ihr nördlicher Nachbar. Interessant sind auch die Diskussionen über die 2000-Watt-Gesellschaft.
Die Chancen für die Schweiz, 2050 erfolgreich zu bestehen, sind also nicht schlecht. Insbesondere dann, wenn ihr europäisches Umfeld stabil bleibt, kann sie darin so stark bleiben, wie sie ist, und sich weiter entwickeln. Bewegt sich die Welt allerdings in Richtung Brasilianisierung oder ökologischer Kollaps – und das ist durchaus möglich –, wird es auch für Europa und die Schweiz eng werden.
[Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher, Professor für Informatik und Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung an der Universität Ulm]
Anmerkungen:
[01] www.faw-neu-ulm.de, www.senat-deutschland.de, www.clubofrome.de
Der Autor ist ein Impulsgeber der Global Marshall Plan Initiative. Mit Kollegen aus dem Senat der Wirtschaft und dem Club of Rome Deutschland fordert er den Marshallplan mit Afrika ein: Angesichts wachsender Migrationsströme soll Deutschland Mittel bereitstellen, um nachhaltig bessere Perspektiven für Menschen in Afrika zu schaffen. Der 1968 gegründete Club of Rome ist eine gemeinnützige Organisation und versammelt Experten verschiedener Disziplinen aus über 30 Ländern. Er setzt sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit ein und erlangte mit dem 1972 veröffentlichten Bericht «Die Grenzen des Wachstums» weltweite Beachtung. Seit 2008 hat er seinen Sitz in Winterthur (Red./Wikipedia). www.clubofrome.org
[02] Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens III: The Limits to Growth. Universe Books, New York 1972.
Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens III, Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1972; Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1973.
[03] Graham Turner: «A Comparison of The Limits to Growth with Thirty Years of Reality». In: Socio-Economics and the Environment in Discussion (SEED). CSIRO Working Paper Series Nr. 2008-09. Juni 2008, ISSN 1834-5638.
[04] Jørgen Randers, 2052 – Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre, oekom, München 2012.
[05] Franz Josef Radermacher, Balance oder Zerstörung: Ökosoziale Marktwirtschaft als Schlüssel zu einer weltweiten nachhaltigen Entwicklung. Ökosoziales Forum Europa (Hg.), Wien 2002.
Franz Josef Radermacher, Bert Beyers, Welt mit Zukunft – Die ökosoziale Perspektive. Murmann, Hamburg 2011.
[06] Bundesamt für Statistik, https://www.bfs.admin.ch/
[07] Franz Josef Radermacher, «Was macht Gesellschaften reich? Die Infrastruktur als wesentlicher Baustein». In: Reinhard Loske, Roland Schaeffer (Hg.), Infrastruktur für eine nachhaltige Entwicklung, Metropolis, Marburg 2005.
[08] United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2015.
[09] www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
[10] Joseph E. Stiglitz, Der Preis der Ungleichheit, Siedler, München 2012.
Anthony B. Atkinson, Ungleichheit: Was wir dagegen tun können, Klett-Cotta, Stuttgart 2016.
Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, C. H. Beck, München 2016.
[11] Vgl. Franz Josef Radermacher, «A Better Governance for a Better Future». In: Journal of Future Studies, March 2016, 20(3): 79–92.TEC21, Fr., 2017.04.21
21. April 2017 Franz Josef Radermacher