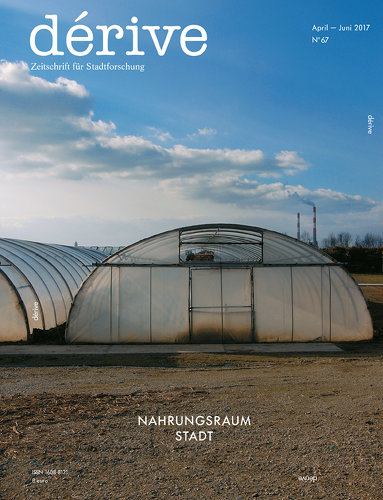Editorial
Urban Gardening liegt seit Jahren im Trend, städtische Märkte feiern eine Renaissance und sind Fixpunkt von Stadttourismustouren, Kochevents gibt es aller Orten und Streetfood wandelt sich auch in unseren Breiten von der exotischen Attraktion zum Alltagsangebot. Man könnte meinen, die Stadtbevölkerung verbringt ihre Tage mit Gärtnern, Kochen und Essen. In dieser Schwerpunktausgabe zum Thema Nahrungsraum Stadtwerden Sie trotzdem über die neuesten Urban-Gardening-Tipps ebenso wenig lesen, wie über die coolsten Streetfood-Hangouts oder die angesagtesten Community-Kochevents in Ihrer Nachbarschaft – auf dérive ist eben Verlass.
Stattdessen legen wir unseren Fokus auf die räumlichen Ausprägungen und Auswirkungen der diversen Hypes und Trends, beschäftigen uns am Beispiel Wien mit dem Themenkomplex urbane Landwirtschaft, Stadtwachstum, Imagepolitik und Partizipation oder sehen uns den Nahrungsmittelanbau in Kubas Städten näher an.
Katharina Held, die für den Schwerpunkt verantwortliche Redakteurin, schreibt in ihrem Einleitungsartikel: »Nahrungsmittel sind als fundamentaler Bestandteil menschlichen Lebens auf vielfältige Weise in das städtische Alltagsleben eingebunden, sie verändern öffentliche Räume, das allgemeine Stadtbild, die Stadtpolitik, durchdringen städtisches Leben und produzieren Stadt und Urbanität.« Wie sich das im Fall der Berliner Markthalle Neun auswirkt, analysiert Held in einem weiteren Artikel für den Schwerpunkt. Im Mittelpunkt des Beitrages stehen die Eventisierung des Marktgeschehens und ihre Auswirkungen auf die Nachbarschaft. Berlin ist gemeinsam mit Beirut gleich noch einmal Schauplatz in diesem Schwerpunkt, wenn es im Beitrag Falafel gentrified von Miriam Stock um sich verändernde Geschmackslandschaften und deren räumliche Effekte geht. Inga Reimers setzt sich in Die Stadt als Tafel mit dem Trend zum gemeinschaftlichen Kochen und Essen als Tool für Community-Building oder zur Inszenierung von Debatten auseinander.
Kuba wiederum gilt wohl zu recht als besonders avanciertes Beispiel für Urban Farming. Carey Clouse zeigt im Artikel Hyper-local Foodscapes wie sich die urbane Landwirtschaft ab 1989, dem Jahr des Untergangs der Sowjetunion und dem damit verbundenen Abbruch von Handelsbeziehungen, zur heutigen Blüte entwickelte. International weniger bekannt ist möglicherweise, dass auch in Wien vergleichsweise viele Nahrungsmittel angebaut werden. Die Stadt verfügt nach eigenen Angaben über rund 5.000 Hektar Landwirtschaftsflächen, 870 Hektar davon werden für den Gartenbau – vor allem für die Gemüseproduktion – genutzt, rund 700 Hektar gehören dem Weinanbau. Auf diesen Flächen werden jährlich rund 60.000 Tonnen Gemüse bzw. Trauben für über 2.000.000 Liter Wein geerntet. In einer stark wachsenden Stadt wie Wien verwundert es jedoch nicht, dass diese Flächen unter Druck geraten. Sarah Kumnig zeigt mit ihrem Artikel Partizipation und grüne Imagepolitik in Wien am Beispiel des Wiener Donaufeldes, wie der Konflikt zwischen baulicher Stadterweiterung und urbaner Landwirtschaft ausgetragen bzw. besänftigt wird.
Der Magazinteil dieser dérive-Ausgabe führt mit drei Beiträgen an die Schauplätze Addis Abeba, Athen und in den Aufzug als Ort zur Einübung urbanen Verhaltens. Lisa Bolyos schreibt in ihrer Reportage über die Geschwindigkeit der schier uferlosen Stadtentwicklung Addis Abebas, die nicht ganz zufällig an chinesische Verhältnisse erinnert: Die damit verbundene Zerstörung informeller Siedlungen und Strukturen erzeugt Widerstand, der sich mittlerweile generell gegen die Regierungspolitik richtet.
Peter Payer erzählt im zweiten Magazinbeitrag die »kleine Zivilisationsgeschichte« Wie wir lernten, mit dem Aufzug zu fahren. Er erinnert an die damit verbundenen Ängste, die sowohl sozialer Natur waren, als auch in Bezug auf mögliche Unfälle herrschten. Payer porträtiert die Figur des Aufzugswärters und analysiert die Fahrstuhl-Kabine als Ort an dem »es galt, extreme Nähe auszuhalten, auch über mögliche Klassengrenzen hinweg«.
Für den letzten Beitrag haben wir uns ins Beste Hotel Europas begeben, um mit einer Aktivistin der Initiative City Plaza Athens ein Interview zu führen. Vor rund einem Jahr wurde durch Besetzung aus einem leerstehenden Hotel im Zentrum Athens eine selbstverwaltete Flüchtlingsunterkunft für 400 Personen. Die Bewohner und Bewohnerinnen des beeindruckenden Projekts, das mit dem Slogan »No pool, no minibar, no room service but still the best hotel in Europe« für sich Werbung macht, organisieren und finanzieren ihren Alltag entlang von Solidarität und Selbstorganisation und stellen sich täglich den zahlreichen Herausforderungen und Widersprüchen.
Das Kunstinsert in dieser Ausgabe stammt von Maruša Sagadin, die mit ihrer Arbeit Terra Cotta, Panna Cotta mit der Säule als architektonischem Fragment spielt.
Es dauert zwar noch ein gutes halbes Jahr bis unser urbanize! Festival von 6. bis 15. Oktober in Wien erneut seine Tore öffnet, aber wir stecken natürlich längst bis unter die Haarwurzeln in den Vorbereitungen. Inhaltlich wird sich bei der 8. Ausgabe von urbanize! alles um das Themenfeld
Stadt und Demokratie drehen. Am besten gleich im Kalender blockieren – dringend notwendige Debatte ist angesagt!
Bis dahin wünschen wir erkenntnisreiche Lektüre, die dérives
Inhalt
EDITORIAL
Christoph Laimer, Elke Rauth
Nahrungsmittel in der Stadt, Nahrungsmittel aus der Stadt
Vorwort zum Schwerpunkt
Katharina Held
Falafel gentrified
Neue „authentische“ Geschmackslandschaften in Berlin und Beirut
Miriam Stock
Partizipation und grüne Imagepolitik in Wien
Widersprüche des Stadtentwicklungsprozesses Donaufeld
Sarah Kumnig
Hyper-local Foodscapes
Cuba’s Experience with Urban Agriculture
Carey Clouse
Making the Market
Controversy and discourse surrounding a market hall in Berlin Kreuzberg
Katharina Held
Die Stadt als Tafel
Öffentliches Essen und Kochen als Setting
Inga Reimers
KUNSTINSERT
Maruša Sagadin
Terra Cotta, Panna Cotta
MAGAZIN
»Was wir entwickeln müssen, ist unser Horizont«
Addis Abebas uferlose Stadtentwicklung
Lisa Bolyos
Wie wir lernten, mit dem Aufzug zu fahren
Eine kleine Zivilisationsgeschichte
Peter Payer
Das beste Hotel Europas
Interview mit der Athener Initiative Hotel City Plaza
Christoph Laimer, Elke Rauth
BESPRECHUNGEN
Von Spanien lernen?!
Wider den Purismus
Kleingärten in der Stadt
Von Prag bis Baku: Erkundungsreisen in osteuropäische Städte
Die Terranauten
Die Statik der Irrationalität
IMPRESSUM
Nahrungsmittel in der Stadt, Nahrungsmittel aus der Stadt
(SUBTITLE) Vorwort zum Schwerpunkt
Food „emerges as something with phenomenal power to transform not just landscapes, but political structures, public spaces, social relationships, cities“ (Steel 2009).
Nahrungsmittel sind als fundamentaler Bestandteil menschlichen Lebens auf vielfältige Weise in das städtische Alltagsleben eingebunden, sie verändern öffentliche Räume, das allgemeine Stadtbild, die Stadtpolitik, durchdringen städtisches Leben und produzieren Stadt und Urbanität: Als Orte der Nahversorgung sind Supermärkte, Kioske, Bäckereien etc. fester Bestandteil des Stadtbildes. Sie tragen zusammen mit Restaurants, Cafés und Imbissen zur Atmosphäre eines Stadtteils bei, bestimmen das öffentliche Leben. Im Konsumraum Stadt entfaltet Ernährung Wirkmacht, stellt doch die Nahrungsmittelindustrie einen großen Teil des Umsatzes und der Arbeitsplätze städtischer Wirtschaft.
Das Transportaufkommen für die Lebensmittelmassen verdichtet den Stadtverkehr. Auch für das Image einer Stadt sind Nahrungsangebot und lokale Spezialitäten von Bedeutung: Durch Stadtmarketing wird auch die Restaurant- und Gastronomieszene wichtiges Aushängeschild und das Essensangebot ein distinktiver Faktor von Städteprofilen.
Die Verbindung zwischen Essen und der Stadt ist aber zunächst vor allem eine historisch gewachsene, symbiotische Verknüpfung. Städtische Ernährungssysteme stellen eine der wichtigsten Infrastrukturen menschlicher Siedlungen und gleichzeitig auch die Voraussetzung für städtisches Wachstum dar. Vorindustrielle Städte versorgten sich zumeist autark aus der unmittelbaren Umgebung oder sogar aus dem eigenen Stadtgebiet heraus. Aufgrund schlechter Transportbedingungen und vor allem der wenigen und technisch nicht ausgereiften Konservierungsmöglichkeiten waren der Anbau von Obst und Gemüse sowie die Haltung von Vieh notwendigerweise städtische Praktiken (Stierand 2008): Überwiegend (urban)landwirtschaftlich genutzte Freiflächen bestimmten das Stadtbild, Märkte bildeten einen räumlichen und sozialen Mittelpunkt. Zunehmende Urbanisierung, wissenschaftlicher und technischer Fortschritt (Erfindung neuer Konservier-Methoden wie der Konservendose) und mobiler Handel heben ab dem 19. und beginnenden 20. Jahrhundert die räumlichen Beschränkungen des städtischen Ernährungssystems auf. Im Zuge der Globalisierung entkoppelt sich die Erzeugung der Lebensmittel vom Wohnort: Produktions-, Konsum- und Verbrauchsräume rücken noch weiter auseinander.
Seit den neunziger Jahren finden die gesellschaftlichen, sozialen, ökologischen und politischen Zusammenhänge des globalen Nahrungsmittelsystems stärkere Beachtung in urbanen Disziplinen, wobei viele der jüngsten Studien über Nahrungsmittel und Städte zumeist die gesicherte Versorgung und gesunde Ernährung der Bevölkerung in den Fokus rücken. Städtische Ernährungssysteme sind von zentraler Bedeutung in einer Welt, in der die Versorgung großer Teile der urbanen Bevölkerung aufgrund struktureller Probleme, in Folge von ökologischen und ökonomischen Notlagen und des Massenkonsums nicht gewährleistet werden kann. Urban food planning – beschrieben als „one of the most dynamic and rapidly expanding city-driven global social movements“ (Ilieva 2016) – erörtert Möglichkeiten lokaler Ernährungspolitik und neue Strategien in der Stadternährungsplanung. Aber nicht nur die Wissenschaft und Politik, vor allem auch selbstorganisierte Bürger und Bürgerinnen setzen sich mehr und mehr mit der Frage einer nachhaltigen und gesicherten Versorgung und Entwicklung von Städten auseinander.
Sie engagieren sich in Ernährungsräten, bauen in urbanen Gärten Gemüse an, erdenken Subsistenz-Szenarien und suchen Wege, Lebensmittelüberschüsse in neue städtische Ressourcenkreisläufe zu überführen.
All dies bringt im urbanen Alltag Praktiken hervor, die den Raum der Stadt aktiv mitgestalten. Im großen Themenfeld Nahrungsraum Stadt wirft der Schwerpunkt dieser dérive-Ausgabe einen Blick auf sozial-räumliche Zusammenhänge und Implikationen einiger dieser unterschiedlichen Praktiken von der Produktion bis zum Konsum von Nahrungsmitteln in und aus Städten.
Die Beiträge
In ihrem Artikel zu Urban-Farming in Havanna, Kuba, nimmt Carey Clouse die Besonderheiten des kubanischen Systems urbaner landwirtschaftlicher Produktion in den Blick. Zugeschnitten auf den Kontext, die kulturellen Werte und Restriktionen Havannas, bietet dieses dennoch Ansatzpunkte und Übersetzungspotential für die Versorgung von Städten in der Krise.
Urbane Landwirtschaft ist auch Thema im Beitrag von Sarah Kumnig, der den Kontext neoliberaler Stadtentwicklung hinterfragt. Analysiert wird hier ein Stadtentwicklungsprozess in Wien, dessen grünes Entwicklungsleitbild sowie die Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger am Prozess.
Die Tätigkeiten des gemeinsamen Kochens und Essens greift Inga Reimers in ihrem Artikel zu Ess-Settings auf. Anhand zweier Beispiele denkt sie hier über die zentralen räumlichen Elemente solcher temporärer Settings und deren Einbindung in den urbanen Raum nach.
Dass Essen in der Stadt mittlerweile auch in den Medien, von Blogs und Magazinen, als Trend propagiert wird und die Rolle von authentischer Küche, Food Start-Ups und Essen als Kulturerfahrung im Zuge der Gentrifizierungsdebatte diskutiert werden (Zukin 2010, Boniface 2003), reflektieren zwei Beiträge in diesem Schwerpunkt. Miriam Stock spürt unter der Überschrift Falafel gentrified auf der Basis eines Vergleiches des kulinarischen Angebotes in Berlin und Beirut den sich verändernden Geschmackslandschaften dieser Städte und den dafür verantwortlichen Einflüssen nach. In Berlin bleibend widmet sich Katharina Held der Markthalle Neun in Berlin-Kreuzberg und dem Diskurs um die Halle, der Widersprüche und Konfliktpotenziale des neuen Food-Trends aufzeigt.
Literatur:
Ilieva, Rositsa T. (2016): Urban Food Planning: Seeds of Transition in the Global North. London: Routledge.
Steel, Carolyn (2009): Hungry City. How Food Shapes Our Lives. London: Vintage.
Stierand, Philipp (2008): Stadt und Lebensmittel. Die Bedeutung des Städtischen Ernährungssystems für die Stadtentwicklung. Dissertation. Universität Dortmund. Verfügbar unter: http://speiseraeume.de/downloads/SPR_Dissertation_Stierand.pdf (Stand: 10.02.2017).
Zukin, Sharon (2010): Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places. Oxford & New York: Oxford University Press.
Boniface, Priscilla (2003): Tasting Tourism: Travelling for Food and Drink. Burlington: Ashgate.dérive, So., 2017.04.16
16. April 2017 Katharina Held