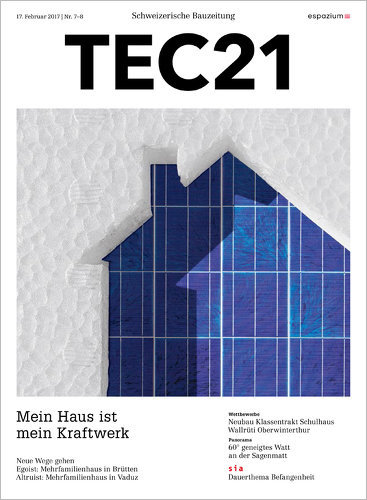Editorial
Unter dem Motto «Mein Haus ist mein Kraftwerk» zeigen wir in diesem Heft, wie die dezentrale Energieversorgung von Gebäuden funktionieren kann. Ob ein Bauwerk dabei ausschliesslich sich selbst versorgt oder als Energieknotenpunkt innerhalb eines Arealverbunds andere gleich mitbedient, hängt vom Standort des Bauwerks und der Zielsetzung des Planers ab. Beides ist mit dem aktuellen Stand der Technik und der Nutzung regenerativer Energiequellen möglich.
Architekten und Ingenieure holten beim Wohnhaus in Brütten ZH das Maximum aus den Systemen heraus, die am Markt erhältlich sind. Sie kombinierten sie in einer Weise, dass das Haus als energieautarker Einzelkämpfer von seiner Umgebung völlig unabhängig ist. Für den Typus eines Mehrfamilienhauses gab es das noch nie.
Für die technische Ausrüstung des Active Energy Building in Vaduz, das seine Energie altruistisch mit den angrenzenden Gebäuden teilt, wurden weder Kosten noch Mühen gescheut. In jahrelanger Forschung entwickelte und patentierte das
Planungsteam Innovationen in der Bau- und Energietechnik, die als Ideenpool für zukünftige Nachahmer dienen sollen.
Bei beiden Gebäuden wird ein enormer technischer Aufwand betrieben, und die vermeintlichen Grenzen des Möglichen werden dabei ignoriert. Vielleicht, um Nelson Mandela recht zu geben: «It always seems impossible until it’s done.»
Nina Egger, Viola John
Inhalt
AKTUELL
07 WETTBEWERBE
Erfrischend radikal
16 PANORAMA
60° geneigtes Watt an der Sagenmatt | Der Architekt und das Klima | Schweizerische Baurechtstagung
18 VITRINE
Neues aus der Baubranche | imm cologne
20 SIA
Virtual Reality als Medium der Bürgerbeteiligung | Umsicht – Regards – Sguardi 2017 | Dauerthema Befangenheit | Sehenswert − neue Bauten in der Romandie
24 VERANSTALTUNGEN
THEMA
26 MEIN HAUS IST MEIN KRAFTWERK
26 EIN NEUER WEG
Nina Egger
Die Energieversorgung entwickelt sich von zentralen Grossproduzenten hin zu verstreuten kleineren Playern.
28 EGOIST
Nina Egger, Paul Knüsel
Im Mehrfamilienhaus in Brütten ZH wird das Maximum aus dem aktuellen Stand der Technik herausgeholt.
32 ALTRUIST
Wojciech Czaja, Nina Egger, Viola John
In Vaduz versorgt ein Mehrfamilienhaus mit zahlreichen technischen Neuerungen seine Nachbarn gleich mit.
AUSKLANG
37 STELLENINSERATE
45 IMPRESSUM
46 UNVORHERGESEHENES
Ein neuer Weg
Bei der nachhaltigen Energieversorgung geht es nicht nur darum, wie viel Energie verbraucht werden darf und wie viel aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden soll. Auch auf welchem Einzugsgebiet die Energie verteilt wird, ist eine Frage nach dem rechten Mass.
Klimaschutz hat seine Tücken. Die Schweizer Treibhausgas-Emissionen sollen bis 2020 um 20 % niedriger liegen als 1990, die Energieversorgung aber langfristig gesichert sein – und das trotz dem geregelten Ausstieg aus der Kernenergie. Wie kann also nachhaltige Energienutzung funktionieren? Es geht um drei Dinge: Möglichst wenig Energie verbrauchen, diese effizient nutzen und sie aus CO2-neutralen, nachwachsenden Ressourcen erzeugen. Diese Aufschlüsselung trifft auf Konsumgüter ganz genauso zu wie auf den Gebäudepark. Da dieser die Hälfte des Schweizer Energieverbrauchs ausmacht, arbeiten Experten seit Jahrzehnten an seiner Energieverbrauchsoptimierung.
Auf den Trend zu immer dickeren Wärmedämmungen, die den Verbrauch von Heizöl-(-äquivalenten) reduzieren sollten, folgten die Trends zu effizienten Haushaltsgeräten und haustechnischen Anlagen zum Beispiel mit Wärmerückgewinnung sowie schliesslich zur eigenen Erzeugung von erneuerbarer Energie. Plusenergiehäuser waren das neue goldene Kalb. Aktive Gebäude, wie das 2016 vom Büro Viridén Partner renovierte Mehrfamilienhaus beim Schaffhauserplatz in Zürich, führen gleich zur nächsten Trendwende: weg von der zentralen Energieerzeugung, hin zu einer Dezentralisierung.
Woher kommt die Energie?
Unter zentraler Energieversorgung versteht man die Produktion von enormen Energiemengen an einzelnen (zentralen) Standorten, die dann – zum Teil über Ländergrenzen hinweg – in viele Richtungen verteilt werden. Durch lange Leitungswege entstehen hierbei hohe Verluste. Als Endkunde ist man überdies von den Importen, Angeboten und Preisen des Energielieferers abhängig. Bei der dezentralen Versorgung gibt es nicht das eine grosse Zentrum, sondern viele kleine.
Zentral versus dezentral ist keine schwarz-weisse Angelegenheit. Es gibt nicht nur russische Gaspipelines und die komplette, abgeschottete Eigenversorgung, wie sie auf der Monte-Rosa-Hütte (vgl. TEC21 49/2015, «Gebäudebetrieb zwischen Anspruch und Wirklichkeit») angestrebt wird. Das Versorgungsgebiet eines zentralen Erzeugers kann landesweit, kantonal oder stadtweit sein. Ein dezentraler Erzeuger gilt auch dann noch als solcher, wenn er Nebengebäude wie ein Gartenhaus oder einen Stall mitversorgt. Der Gedanke lässt sich auf die Nachbarn bis hin zur Arealvernetzung ausweiten.
Letztere wird auf einschlägigen Konferenzen schon seit Jahren als bedeutende Zukunftsvision gehandelt. Ob damit die goldene Mitte gefunden ist, eine Grössenordnung, die die Vorteile von zentraler und dezentraler Energieversorgung zu vereinen schafft, wird in der Schweiz gerade rege und in verschiedenen Komplexitätsgraden erforscht. Die Hochschule Luzern betrachtet in ihrem Projekt «SCCER» Energy Cluster, die Strom, Wärme und Gas teilen (vgl. TEC21 9–10/2015, «Erdwärme: First come first serve?»). Die Empa Dübendorf beschäftigt sich in ihrem Projekt «ehub» mit der Arealvernetzung (vgl. TEC21 22/2016, «Empa NEST – Brutplatz für die Forschung») und am Hönggerberg der ETH Zürich werden thermische Netzknoten im Realbetrieb getestet (vgl. TEC21 34/2015, «Thermische Netze»).
Das Haus als Kraftwerk
Was bedeutet Dezentralisierung aber nun für ein Einzelgebäude? Eventuell gar nichts. Wenn ein Gebäude nur als Verbraucher auftritt, könnte das exakt selbe Gebäude ohne die geringste Änderung statt von einem zentralen Anbieter von einem dezentralen versorgt werden – vorausgesetzt beide stellen ihm die gleichen Energieformen (z.B. Wechselstrom auf Niederspannung) zur Verfügung. In einem vernetzen Areal hat das Objekt noch zusätzliche Möglichkeiten. Jedes Gebäude kann als Erzeuger, Verbraucher oder Speicher dienen, muss aber eben nicht alle diese Funktionen gleichzeitig und auch nicht für alle Energieformen erfüllen.
Zur Betrachtung, wie dezentrale Energieversorgung funktioniert und wie es mit ihr weitergehen könnte, sind die aktiven Gebäude innerhalb eines Systems am aufschlussreichsten. Versorgt sich ein Gebäude oder Gebäudekomplex völlig selbst, wie es das Mehrfamilienhaus von René Schmid in Brütten (vgl. «Egoist») tut, oder dient ein Gebäude als Knoten im Energienetz, wie das Active Energy Building von Falkeis Architekten in Vaduz (vgl. «Altruist»), lässt sich daraus besonders viel lernen. Denn derartige Gebäude bedürfen eines besonders hohen Technikeinsatzes, um ihre Funktion zu erfüllen.
So bieten diese Extrembeispiele mit ihrem vielfältigen technischen Arsenal den Praxistest für diverse Methoden der Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie, der Maximierung von passiven Gewinnen und Minimierung von Verlusten, der Energiespeicherung und der effizienten Nutzung. An ihnen wird sich im Laufe von den Alltag begleitenden Monitorings zeigen, ob und wie die dezentrale Energieversorgung über das Areal betrachtet funktionieren kann. Nicht jedes Gebäude muss in Zukunft so aussehen. Aber es hat sein Gutes, dass ein paar es heute tun.TEC21, Fr., 2017.02.17
17. Februar 2017 Nina Egger
Egoist
Hinter der matt anthrazitfarbenen Glasfassade wohnen neun Familien ohne Anschluss an ein Energienetz. Auf den ersten Blick verwundert es, wie das funktioniert, denn Energieerzeuger sind keine zu sehen. Im Keller geben 26 Wechselrichter und ein Speicher erste Hinweise auf die Lösung.
Am Rand des Hofacher-Quartiers von Brütten ZH steht ein Mehrfamilienhaus, das weder an das öffentliche Stromnetz angeschlossen noch auf externe Brennstoffe angewiesen ist. Der ländliche Ersatzneubau mit neun Wohnungen ist ein Pilot- und Demonstrationsprojekt, das neueste Komponenten der Solartechnik mit einem ausgeklügelten Versorgungs-, Speicher- und Regelungssystem kombiniert. Die Bewohner leben energetisch autark von der Umgebung, dank gebäudeintegrierter Photovoltaik, Erdsonden und innovativen Speichervarianten. Dafür wurde der Bau mit dem Norman Foster Solar Award 2016 (vgl. «Mehr als nur Solar») ausgezeichnet.
Grundsätzlich hat Energieautarkie im Siedlungsumfeld nichts verloren. In der Wüste, am Nordpol oder auf dem Mond wäre es etwas anderes. Doch warum soll ein Bau wie ein Eremit ganz für sich allein bleiben, wenn es sicherer und effizienter ist, ihn an ein öffentliches Versorgungsnetz anzuschliessen oder mit den Nachbarn, mit denen er Energie- und Stoffflüsse austauschen könnte, als kleines Netzwerk zusammenzuschliessen?
Beim Mehrfamilienhaus in Brütten ging es aber nicht darum, zu tun, was unter den gegebenen Bedingungen am vernünftigsten ist, sondern darum, die heutige Technik bis aufs Letzte auszunutzen. Das Extrembeispiel soll zeigen, was alles möglich ist. Und das ist nun bewiesenermassen einiges.
Die (nicht sehr geheime) Rezeptur
Um sich zu 100 % selbst mit thermischer und elektrischer Energie versorgen zu können, müssen drei Grundbedingungen erfüllt sein: Der Verbrauch muss so gering wie möglich gehalten werden, die Eigenenergieproduktion muss so hoch wie möglich sein, und um dem zum fluktuierenden Angebot häufig versetzt auftretenden Bedarf gerecht werden zu können, werden Speicher benötigt. Bei Bautypen mit von vornherein geringem Bedarf und einer grossen zur solaren Energiegewinnung geeigneten Oberfläche lässt sich dem etwas leichter nachkommen – eine Scheune mit fünf Glühbirnen als einzigen Verbrauchern wäre ein geringes Problem. Aber ein Mehrfamilienhaus? Da ist das Volumen kompakt – wenig Oberfläche zur Energiegewinnung – und die Belegungsdichte hoch; entsprechend auch die Verbräuche. Kein Wunder also, dass bislang in der Schweiz niemand ein autarkes Mehrfamilienhaus erbaute.
Gezielte Verbrauchsreduktion
Der Energieverbrauch wird durch die gut gedämmte Gebäudehülle und durch hohe Effizienz bei der kontrollierten Wohnraumlüftung, bei Wand- und Bodenheizung sowie bei technischen Geräten gering gehalten. Der Energiebedarf für Heizen, Brauchwarmwasser, Haushalts- und Betriebsstrom beläuft sich auf 63 300 kWh/a. Mit Wärmepumpe, Lüftung, Kühlung, Hilfsstrom und Energie zur Speicherbefüllung werden insgesamt 119 460 kWh/a verbraucht, exakt die Menge, die erzeugt wird.
Maximale Energieerzeugung
Energie erzeugt wird an allen Ecken und Enden des Gebäudes. Die Photovoltaikanlage am Dach mit 512 m² monokristallinen Solarzellen (79.54 kWp) und die 485 m² mikromorphen Dünnschicht-Solarzellen an der Fassade (46.96 kWp) produzieren zusammen durchschnittlich 92 000 kWh/a. Die Solarpaneele sind dabei speziell auf die Anwendung im architektonischen und gestalterischen Bereich angepasst und weiter entwickelt worden. Ein spezielles Verfahren, eigens für dieses Projekt an der HSLU entwickelt, ermöglicht die Behandlung des Deckglases, wodurch eine matte Oberfläche entsteht. Die verbauten Photovoltaikpaneele sind blendfrei und als Bauplatten verwendbar. Die mikromorphen PV-Fassadenmodule erzeugen selbst im Winter, unabhängig ihrer Ausrichtung, sowie bei niedrig stehender Sonne und viel diffusem Licht einen relativ hohen Stromertrag. Die Gebäudeform ist so beschaffen, dass kein Bauteil Schatten auf die Fassade wirft, was den Einsatz der PV-Fassade optimiert und auch den monolithischen Charakter des Bauwerks stärkt. Der Solarertrag reicht aus, den jährlichen Stromeigenbedarf in den neun Familienhaushalten abzudecken.
Zur elektrischen Energie der Photovoltaikanlagen kommt Wärmeenergie aus Umgebungswärme und aus Erdsonden mit Wärmepumpe und Wärmetauscher hinzu. Der thermische Energiebedarf für Raumheizung und Warmwasser wird aus diesem System gedeckt; es bezieht nur Strom, den das Wohngebäude selbst aus Sonnenenergie produzieren kann. Insgesamt werden 119 460 kWh/a bereitgestellt.
Optimierte Speicherung
Abgestimmt auf Nachfrageprofil und Nutzenergie ist die Speicherung kaskadenartig organisiert. Batterien und Wasserstofftanks dienen der kurz- und langfristigen Stromspeicherung, für überschüssige thermische Energie gibt es Wärmespeicher. Um die Speicher möglichst klein ausführen zu können, wurde der winterliche Solarertrag optimiert.
Als Kurzzeitspeicher für den von der PV-Anlage produzierten Überschuss fungiert eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Batteriewechselrichter stellen innerhalb des Gebäudes das Stromnetz sicher und übernehmen die Primärregelung des Netzes. Gewisse Komponenten sind redundant ausgeführt, um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Bei einem Energieüberschuss der PV-Anlage wird die Energie in der Batterie zwischengespeichert. Wenn der Strom der PV-Anlage nicht mehr ausreicht, um den aktuellen Bedarf zu decken, kann die Energie rasch aus diesem Kurzzeitspeicher abgerufen werden. Die Batterie ist so ausgelegt, dass sie Lücken von einzelnen Stunden bis etwa drei Tagen überbrücken kann.
Da die Kurzzeitspeicher im Sommer schnell geladen sind, wird ein saisonaler Langzeitspeicher (Wochen bis Monate) benötigt. In den sonnenarmen Monaten kann die Energie aus dem Langzeitspeicher im Gebäude wieder eingesetzt werden. Über Batterien ist eine Langzeitspeicherung aufgrund der Verluste und hohen spezifischen Kosten für diesen Einsatz allerdings nicht wirtschaftlich realisierbar. Beim Projekt Brütten sind daher zusätzlich weitere Technologien (z.B. Wasserstoffspeicherung) im Einsatz. Diese Langzeitspeichersysteme sind eng mit dem Batteriespeichersystem verbunden und stellen die Versorgung bei längeren Unterdeckungen sicher.
Umwandlung
Als Power-to-Gas (kurz PtG oder P2G, auch «elektrische Energie zu Gas») wird ein elektrochemischer Prozess bezeichnet, in dem durch Wasserelektrolyse unter dem Einsatz von Strom Wasserstoff hergestellt wird. Der Strom wird in drei Schritten behandelt:
1. Produktion von Wasserstoff durch Wasserelektrolyse, auch Power-to-Gas genannt
2. Speicherung des Wasserstoffes unter Druck
3. Produktion von elektrischem Strom durch eine Brennstoffzelle (Typ PEM)
Der dabei ebenfalls entstehende Sauerstoff kann genutzt oder in die Atmosphäre abgeblasen werden. Bei diesem Prozess entsteht neben dem Wasserstoff bei einem Druck von 30 bar ohne Verdichter gleichzeitig nutzbare Wärme in Form von Kühlwasser mit rund 35 °C.
Der so hergestellte Wasserstoff kann in Druckspeichern saisonal zwischengespeichert werden. Es sind verschiedene Drücke möglich und die Tankanlagen können überirdisch oder unterirdisch erstellt werden. Massgebend sind die Rahmenbedingungen am Aufstellungsort.
Die Brennstoffzelle wandelt Wasserstoff in Elektrizität um. Statt einer klassischen Verbrennung arbeitet eine Brennstoffzelle mit einer elektrochemischen Reaktion und ist emissionsfrei. Das Prinzip einer Brennstoffzelle ist vergleichbar mit dem einer Batterie. Sie verfügt ebenfalls über eine Anode, eine Kathode und einen Elektrolyten. Eine Brennstoffzelle kann selbst aber keine Energie speichern und sie kann auch nicht «aufgeladen» werden. Brennstoffzellen können kontinuierlich Gleichstrom produzieren, solange Brennstoff (Wasserstoff) und Luft zur Verfügung stehen. Neben der elektrischen Energie steht nutzbare Wärmeenergie zur Verfügung. Die Stromerzeugung durch die chemische Reaktion ist lautlos.
Thermischer Speicher
Thermische Langzeitspeicher dienen zur Speicherung von grossen Wärmemengen über lange Zeiträume. Der saisonale Wärmespeicher (zwei Wassertanks) wird via Wärmepumpe beladen, sobald zu viel Strom produziert wird. Dieser ist mit dem Brauchwassersystem (Hochtemperatur) und dem Heizsystem (Niedertemperatur) verbunden.
In Brütten sind die Speicher unter dem Haus angeordnet. Als Speicherbehälter werden zwei konventionelle Stahl-Email-Tanks (Abb.) verwendet, wie sie auch in der Landwirtschaft zur Lagerung der Gülle eingesetzt werden. Die Speicher sind drucklos ausgeführt. Die Ladung und Entladung erfolgt über im Innern angebrachte Rippenrohrwärmetauscher, die Energie an das stehende Wasser im Speicher abgeben oder daraus entziehen. Die Speicher sind im gesamten Umfang 200 mm dick in Wärmedämmung eingepackt. Die Ausdehnung des Speicherwassers wird über eine entsprechende Reservehöhe und einen Überlauf mit Siphon gewährleistet. Ein allfälliger Zugang in den Speicher erfolgt von oben über einen wärmegedämmten Einstiegsschacht und eine eingebaute Schachtleiter. Die maximale Speichertemperatur beträgt rund 65 °C, die minimale 6 °C.
Alles massgeschneidert
Die gebäudeintegrierte Photovoltaik ist auf hohe Leistung und saisonalen Ausgleich dimensioniert. Zur Optimierung waren Speziallösungen bei Geometrie und Hinterlüftung der Dünnschichtmodule sowie bei der Konzeption der Schaltkreise und der Wechselrichteranschlüsse zu finden. Zur Demonstration des energieautarken Wohngebäudes gehört die zurückhaltende Gestaltung: So besitzen die Solarfassaden eine matte, blendfreie Optik. Ebenso ist an den bündigen, verschattungslosen Dachkanten erkennbar, wie Solartechnik und Architektur jeweils als ein Ganzes entworfen sind.
Definierte, simulierte Schnittstellen
Technisch ist die autarke Energieversorgung auf verlässliche Systeme angewiesen. Gewisse Komponenten sind daher redundant ausgelegt. Programmatisch geht es jedoch darum, die Schnittstellen zwischen Produktion und Verbrauch genau zu definieren. Die Knacknuss war hier, ein kompaktes Gebäudevolumen als ausreichende Fläche für die Energiegewinnung zu nutzen und die hohe Belegungsdichte mit einer moderaten Verbrauchsspitze zu kombinieren. Die unterschiedlichsten Lastgänge und Betriebsmodi wurden vorgängig simuliert. Das Energiemanagement steuert Produktion, Speicherung und Haustechnik intelligent; das Gebäudeleitsystem bezieht dafür auch reale Wetterdaten ein.
Die Verbrauchsseite, bestehend aus Haushaltsgeräten, Lüftungsanlage und weiteren haustechnischen Apparaturen, ist auf höchste Energieeffizienz getrimmt. Die Mieterschaft wurde zudem unter anderem aus einem öffentlichen Nachhaltigkeitswettbewerb ausgewählt. Der private Energiekonsum wird im Rahmen eines Austauschs untereinander sowie eines weitergehenden Forschungsvorhabens thematisiert.
Nachahmung (teilweise) erwünscht
Am Mehrfamilienhaus Brütten können sich Techniker und Wissenschaftler erfreuen, was aktuell alles möglich ist. Ein Monitoring wird in den nächsten Jahren zeigen, wie gut die einzelnen Komponenten des Gebäudes zusammenspielen und wo es trotz penibler Planung noch Nachbesserungsbedarf gibt.
Die Grundidee, sich trotz dem Standort mit guter Infrastruktur völlig autark mit Energie zu versorgen, dient mehr zur Demonstration denn als Vorbild. In der Schweiz besteht ohnehin eine Anschlusspflicht, die diesem Vorgehen widerspricht. Einzelne Elemente des Konzepts, die der Energiebedarfsminimierung, Energieerzeugung und -speicherung dienen, sind aus sowohl ökologischer als auch ökonomischer Sicht aber sehr wohl nachahmenswert. Hier gilt es, für jede Bauaufgabe und jeden Standort den geeignetsten Weg zu finden.
Nina Egger, Paul KnüselTEC21, Fr., 2017.02.17
17. Februar 2017 Nina Egger, Paul Knüsel
Altruist
Sieht so die Zukunft aus? Weil Architekten zu Forschern wurden und ein Gebäude zum selbstlosen Energieversorger, entstanden allerlei technische Neuerungen. Das Wohnhaus ist ein Ideenpool für künftige Energiesysteme.
Viele Jahre vergehen für Planung und Bau, getragen von Akteuren, die man nicht unbedingt erwarten würde: Im Zentrum von Vaduz entsteht derzeit das Active Energy Building von Falkeis Architects – Anton Falkeis und Cornelia Falkeis-Senn und einem Team von Forschern, Entwicklern, Schlossern, Maschinenbauern, Robotikern und vielen mehr. Das Gebäude setzt sich aus zwölf Wohneinheiten zusammen und produziert mehr erneuerbare Energie für Heizung und Kühlung, als es selbst verbraucht. Dabei versorgt es gleichzeitig sich selbst und bildet einen Versorgungsknoten für die Nachbargebäude. Das Energiekonzept des Gebäudes basiert einerseits auf bewährten Prinzipien und Systemen, beispielsweise Geothermie zur Bereitstellung von Wärmeenergie sowie Photovoltaikzellen für Strom. Andererseits sind einige der eingebauten Technologiekomponenten eigens für dieses Gebäude entwickelte Prototypen, deren Anwendung für zukünftige Energiesysteme als Vorlage dienen kann, etwa jene für die Klimaregulierung.
Gebaut wird im Energy Cluster
Das Areal, auf dem das Bauwerk errichtet ist, beinhaltet Wohn- und Bürogebäude, Grünanlagen und überbaute Tiefgaragen. Hier soll durch die ausschliessliche Verwendung von erneuerbaren Energiequellen sowie durch die Verknüpfung mit einem Pumpspeicherwerk und E-Mobility die CO2-Bilanz künftig auf vorbildlich niedrigem Niveau gehalten werden. Das Active Energy Building steht im Verbund mit den anderen Gebäuden des Areals und bildet mit ihnen einen sogenannten Energy Cluster (Abb.). Der Vorteil: Die dezentrale Energieversorgung kann innerhalb dieses Netzwerks besser genutzt werden als von einem Einzelobjekt. Denn je nach Nutzung der Wohn- und Büroräume entstehen zu unterschiedlichen Tageszeiten Energiebedarfsspitzen. In Summe sind sich die Energieverbräuche auf dem Areal am Vormittag und Abend dadurch viel ähnlicher, als dies im Einzelfall für Wohngebäude oder Büros zutrifft, wo sich der Bedarf im Tagesverlauf von tiefen Tälern zu hohen Spitzen und wieder talwärts schwingt.
Bewährte Systeme weisen den Weg zu Innovationen in der Energietechnik
Für die Nutzung von Geothermie wird dem Erdreich an zwei Stellen Wärme entnommen bzw. zugeführt. Einmal mit einer Entnahmetiefe von 13 m und einer Förderleistung von 900 l/min, im anderen Fall mit einer Entnahmetiefe von 15 m und einer Förderleistung von 1800 l/min. Die Verteilung der thermischen Energie im Cluster erfolgt je nach Aktivität der Nutzungen.
Für die Bereitstellung von PV-Strom sind die schmale Südseite und das gesamte Dach als aktive Flächen ausgebildet. Um bei jedem Sonnenstand für einen maximalen Energieertrag zu sorgen, spielt die ideale Ausrichtung der PV-Zellen zur Sonne eine grosse Rolle. Daher wurden die energiegewinnenden Elemente so konzipiert, dass sie sich mit dem Sonnenstand mitdrehen (Abb.). Die Photovoltaikflügel wurden speziell für dieses Projekt entwickelt. Die Solarzellen selbst sind zwar weitläufig erhältlich, doch für die Konstruktion der gebäudeintegrierten, dreiachsigen Nachführung wurde das Planungsteam um Robotikingenieure und Maschinenbauer erweitert.
Für die Klimaregulierung an der Ost- und Westseite des Gebäudes wurden in Zusammenarbeit mit Forschern der Hochschule Luzern spezielle Fassadenmodule mit Latentwärmespeicher entwickelt. Die Tests und Simulationen mit den mit einem Phase-Change-Material (siehe Kasten «Phase Change Materials» unten) auf Paraffinbasis gefüllten Flügelelementen nahmen fast drei Jahre in Anspruch. Die Recherche gestaltete sich schwierig, denn die meisten PCM-Hersteller am Markt rieten von dieser noch kaum erforschten Technologie ab. Nachdem sich keine Partner aus der Industrie gefunden hatten, musste die erforderliche Kompetenz für Forschung, Entwicklung und Umsetzung von falkeis.architects selbst aufgebaut werden.
Als Vorbild dient die Natur
Um die im obersten Geschoss angebrachte Energie- und Klimatechnik aufzunehmen, entwickelten die Planer ein Tragwerk aus Stahl, das sie auf das Gebäude setzten. Die Konstruktion umspannt das Dachgeschoss sowie Teile der Ostfassade und ermöglicht zudem die elf Meter lange, südseitige Auskragung des Attikageschosses.
Die Stahlstruktur basiert auf einem Vorbild aus der Natur: dem Voronoi, das organischen Zellen ähnelt. Zum Beispiel bestehen die Flügel einer Libelle aus einer solchen Struktur aus einzelnen Feldern, die so zusammengesetzt sind, dass sie bei geringem Gewicht eine sehr hohe Stabilität aufweisen. Nur so kann die Libelle fliegen. Als Voronoi-Algorithmus bezeichnet man eine Zerlegung des Raumes in bestimmte Regionen. Jede Region wird durch genau ein Zentrum bestimmt und umfasst alle Punkte des Raumes, die näher am Zentrum der Region liegen als an jedem anderen Zentrum.
Die Voronoi-Tragstruktur besteht aus einzelnen zusammengeschweissten Blechträgern. Hierzu wurden die Einzelteile entweder über Kopfplatten mit Schraubverbindungen gefügt oder an ihren Flanschen mit V-Nähten zusammengeschweisst. Alle Träger weisen eine gleichbleibende Höhe von 80 cm auf, bei variabler Neigung der Stege von bis zu 42°. Sie sind im Stahlbetonverbund mit der Gebäudehülle verschnitten. Die Dach- und Fassadenelemente sind über Metalllaschen untereinander verbunden.
Wie Blütenköpfe drehen sich die PV-Elemente zur Sonne
In die polygonalen Felder der Voronoi-Struktur fügen sich Fenster, Oberlichter und alle beweglichen Elemente ein. Darunter sind mehrere Arten von PV- und PCM-Modulen. An der Lamellenfassade im Süden und auf den Balkonelementen im Osten sind polykristalline Zellen installiert, die zusammen 11 kWp liefern. Elf mit monokristallinen Modulen ausgestattete Oberlichter kommen auf 5.4 kWp. Der Grossteil des PV-Ertrags kommt aber von 13 dreiachsig nachgeführten Photovoltaikflügeln mit Flächen von bis zu 12 m², die in der Voronoi-Struktur des Dachs untergebracht sind. Sie folgen, ähnlich den Blütenköpfen von Blumen, während des Tages dem Sonnenverlauf.
Mit einem seit 2014 installierten Mock-up konnten Forscher der HSLU einen Ertragsfaktor von 2.9 nachweisen. Die 34.79-kWp-Anlage wird somit den jährlichen Solarertrag einer gleich grossen, fix montierten Solaranlage nahezu verdreifachen. Damit soll das gesamte Areal mit Solarstrom versorgt werden können. Überschüsse, die nicht genutzt werden, nimmt die Kraftwerks AG ab.
Die Klimaregulierung funktioniert phasenweise verschoben
Sieben mit einem Phase Change Material (PCM) als Latentwärmespeicher ausgestattete Klimaflügel sind an der Ost- und Westseite des Gebäudes in die polygonalen Zwischenräume der Voronoi-Struktur eingepasst. In ihrer Ruheposition liegen die Flügel flach in der Tragstruktur und dienen dem Schutz vor sommerlicher Überwärmung. Mit von Solarstrom betriebenen Spindelmotoren, die die Flügel bis zu 110° aufklappen und dem Himmel beziehungsweise der Sonne entgegenstrecken, wird das Potenzial des Phase Change Materials maximal ausgeschöpft.
Die vier Heizflügel (Abb.) befinden sich an der Westfassade des Gebäudes und klappen in den Morgenstunden auf, während das darin enthaltene PCM noch fest ist. Dank der Ausrichtung zur Sonne wird das Paraffin im Material erhitzt und verflüssigt sich bei einer Temperatur von 32 °C. Sobald das geschmolzene PCM am Ende des Tages den maximalen Wärmeeintrag erreicht hat, schliessen sich die Flügel automatisch und docken mittels eines Ventils an das Lüftungssystem an. Über einen Wärmelufttauscher wird die freigegebene Energiemenge an das Haus abgegeben. Die PCM-Flügel decken rund 10 % der gesamten Heizlast ab.
Genau umgekehrt verhält es sich bei den drei ostseitigen Kühlflügeln (Abb.). Diese liegen untertags plan in der Fassade und klappen sich nachts auf, wenn das Material aufgrund der absorbierten Gebäudewärme vollständig geschmolzen ist. In den Nachtstunden wird die überschüssige Energie abgestrahlt. Bei 21 °C verfestigt sich das Paraffin und erstarrt. Noch vor Sonnenaufgang klappen die abgekühlten und erstarrten PCM-Module wieder ein und tragen zur Kühlung der zweigeschossigen Attikawohnung bei. Auf diese Weise können 16 % der Gesamtkühllast des Hauses eingespart werden.
Sowohl bei den Heiz- als auch bei den Kühlflügeln handelt es sich um polygonale Carbonfaserrahmen, die mit waagerecht montierten Aluminiumlamellen bestückt sind. Der Querschnitt der stranggepressten Lamellen erinnert an jenen von Flugzeugflügeln: Die Wölbung kann sich leicht verformen und nimmt auf diese Weise die zehnprozentige Volumenänderung auf, die das darin enthaltene Paraffin zwischen flüssigem und festem Zustand aufweist.
Bei der Konstruktion zählt die digitale Innovation
Für das Tragwerk des Gebäudes kamen zwei verschiedene Stützenmodelle zum Einsatz: eine gleichschenklige symmetrische Betonfreiformstütze sowie ein asymmetrisches Modell mit einem diagonalen und einem vertikalen Schenkel (Abb.). Durch die mal A-, mal V-förmige Verbauung verdoppelt sich das Repertoire auf insgesamt vier Varianten.
Die genaue Position jeder einzelnen A- und V-Stütze wurde in einem iterativen digitalen Berechnungsverfahren, gesteuert durch einen genetischen Algorithmus, so lange optimiert, bis eine Synthese aus minimalem Materialeinsatz und maximalem Sonneneintrag über die Ost-, Süd- und Westfassaden erreicht war (siehe Kasten «Digitaler Entwurf» unten).
Die Stützen verbinden sich untereinander zu komplexen Baumgebilden mit Verästelungen und Verzweigungen. Mit jeder Etage nimmt nicht nur die abzutragende Eigen- und Nutzlast ab, sondern auch die Zahl der dafür verantwortlichen Stützen. Die Spannweiten zwischen den Fuss- beziehungsweise Kopfpunkten betragen bis zu 12 m.
Die Freiformgeometrie mit der gedrehten Naht verleiht den Säulen ein weiches, organisches Erscheinungsbild. Zu verdanken ist die hohe Zeichnungsfähigkeit des Materials dem selbstverdichtenden High-Performance-Beton (HP-Beton) mit hohem Quarzanteil, harter Gesteinskörnung und beigemischten Polypropylenfasern (PP-Fasern). Entwickelt wurde die Betonrezeptur namens «alphapact P080» in Kooperation mit Holcim Schweiz.
Für den ungleichmässigen Querschnitt der Stütze wurde eine dreiteilige Gussform als Schalung entwickelt, die auf Basis der 3-D-Daten aus Epoxidharz gegossen wurde und keinerlei Hinterschneidungen enthält. Eingeschweisste und einbetonierte Anker- und Anschlussplatten mit integrierten Messpunkten erleichterten nicht nur die Montage vor Ort, sondern sorgten auch dafür, dass die geringe Bautoleranz von zwei Millimetern sogar noch unterschritten werden konnte.
Ein interessantes Experiment
Das Active Energy Building ist zweifellos interessant hinsichtlich seiner technischen Funktionen und Entstehungsgeschichte. Seine Erstellung erforderte einen hohen planerischen und bautechnischen Aufwand, was nur durch die finanzielle Unterstützung der Bauherren möglich wurde, die als Forschungsmäzene wirkten.
Das Ehepaar Marxer, das den Auftrag für das Bauwerk erteilte, appellierte an den Erfindungsreichtum der Architekten und bot ihnen die Chance, die Grenzen des technisch Möglichen auszureizen. Das Active Energy Building ist nicht als klassisches Architekturprojekt zu verstehen, sondern als ein Experiment, das zur Architektur- und Wohnbauforschung beiträgt. Nach dem Bezug des neuen Gebäudes wird über einen Zeitraum von zwei Jahren ein externes Monitoring zur weiteren Optimierung der Energieproduktion und -einsparung eingesetzt werden. Schon jetzt gibt es dank dem Active Energy Building einige neue Patente für Bauelemente. Es bleibt spannend und abzuwarten, wie sich die Forschungsergebnisse zukünftig auf die Baubranche auswirken werden.TEC21, Fr., 2017.02.17
17. Februar 2017 Nina Egger, Viola John, Wojciech Czaja