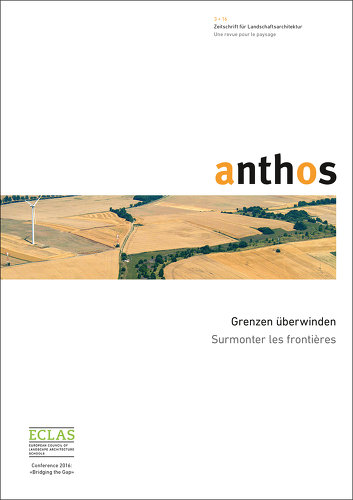Editorial
Die unüberwindbarsten Grenzen haben wir in unseren Köpfen. Sie halten uns auf Trab und machen uns das Leben schwer, weil sie uns daran hindern, systemisch und in Zusammenhängen zu denken und zu entscheiden. Stattdessen sehen wir die Einzelteile, trennscharf abgegrenzt voneinander: hier einen Baum, da einen Baum und daneben noch einen. Zusammen könnten sie ein Stadtwald sein, Elemente einer schützenswerten Kulturlandschaft mit traditionellen Hochstammobstgärten, Ausdruck zunehmender Verbuschung in alpinen Sömmerungsgebieten, charakterbildende Individuen einer historischen Parkanlage, eines liebevoll gepflegten Privatgartens, einer Auenlandschaft.
Je nach Kontext ordnen wir die Dinge ein. Und je mehr Erfahrung und (Fach-)Wissen wir haben, desto freier können wir analysieren, kombinieren, Rückschlüsse ziehen, entwickeln. Wirklich spannend wird es meist erst über dem Tellerrand: Wo die Pfade noch nicht tief gespurt sind, wo Pioniergeist gefragt ist und neue Allianzen überraschen. Wo wir die Kür tanzen können, weil wir die Pflicht beherrschen. So abgedroschen es klingen mag, so wahr ist es dennoch: Erst eine gute, fundierte Ausbildung durch Lehre oder Studium gibt uns dafür die nötige Beinfreiheit.
Der Blick über den Tellerrand kann die eigene Disziplinengrenze sein, oder das Neue im anderen suchen, in fernen Ländern, Kulturen, Themen. Meist relativiert er die eigenen Befindlichkeiten auf wundersame Art und zeigt uns Mitteleuropäern eindrucksvoll auf, wie niedlich viele unserer Probleme zumindest im Vergleich mit anderen Weltgegenden, politischen oder wirtschaftlichen Realitäten tatsächlich sind.
Die seit 1919 stattfindenden internationalen Konferenzen der Europäischen Hochschulen für Landschaftsarchitektur (European Council of Landscape Architecture Schools ECLAS) bieten eine ausserordentliche Gelegenheit für Perspektivenwechsel und einblicke in aktuelle Lehr- und Forschungsthemen unserer Nachbarländer – und weit darüber hinaus – zu bekommen. «Bridging the Gap – Grenzen überwinden» ist das Thema der diesjährigen Konferenz, die vom 11. bis 14. September 2016 in Rapperswil SG stattfindet. Ein erfreulicher kleiner Grenzübertritt ist die Überwindung des Röstigrabens für diese Konferenz. HSR und hepia haben sich für die Organisation zusammengetan.
anthos ist Medienpartner und hat die Ehre, die Referate der internationalen Keynote-Referenten ebenso wie eine Auswahl weiterer Konferenzbeiträge publizieren zu dürfen, die an der Konferenz zu hören sein werden. Ausserdem haben wir weitere Autoren eingeladen, das vielschichtige Thema auch um ihre Facetten zu bereichern.
Zur einfacheren Orientierung haben wir den Beiträgen kleine Logos vorangestellt: eine Art Lesehilfe, unter welcher fachlichen Fragestellung hier jeweils Grenzen überwunden werden.
Sabine Wolf
Inhalt
ECLAS CONFERENCE 2016: Program
Lesebrücke: Logo-Glossar
Chris Reed: Die Ökologien öffentlicher Plätze
Jörg Rekittke: Schlichtweg städtisch
Albert Fekete: Schlichtweg städtisch
Claudia Moll: Die Kunst- und Handelsgärtner Froebel
Antje Havemann: Das Grüne Band: Lebenslinie Todesstreifen
Paolo Bürgi: Die Landschaft lesen
Simon Colwill: Von Alterungsprozessen lernen
Suzanne Kříženecký: Ein Garten der Kulturen des Mittelmeeres
Noel Kingsbury: Ein Garten der Kulturen des Mittelmeeres
Mick Abbott, Kate Blackburne, Jacky Bowring, Charlotte Murphy: Fraktales Pflanzen in Aotearoa, Neuseeland
Florian Glowatz-Frei: Bucheggpark Zürich
Matthias Stremlow: Von der Kulturlandschaft zur Landschaftskultur
Daniela Gažová: Streusiedlungen
Ashleigh Hunter, Bruno Marques: Traditionelles Wissen nutzen
Nicole Uhrig: Grenzen ausloten in Berlin Marzahn
Ein Garten der Kulturen des Mittelmeeres
Hoch über dem Hafen von Marseille – zwischen Stadt, Himmel und Meer – symbolisiert der Jardin des Migrations die Vermischung der Zivilisationen rund um das Mittelmeer sowie der Pflanzen, die ihnen eigen sind. Die Migration der Völker und ihrer Gewächse quer durch die Jahrhunderte und über die Meere wird in 15 Bildern thematisiert, in denen uns die poetische Geschichte der Menschen, ihrer Landschaften und ihres Gebrauchs von Pflanzen vor Augen geführt wird.
Marseille, seit der Antike ein bedeutender Mittelmeerhafen und Drehkreuz der Zivilisationen im Laufe der Jahrhunderte, erhielt anlässlich der Nominierung der Stadt als europäische Kulturhauptstadt im Jahr 2013 das «Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers MuCEM». Das Museum und seine Gartenanlage, der «Jardin des Migrations», liegen am Eingang des Alten Hafens der Stadt: Die Festung Fort Saint-Jean, eine ehemalige Militärfestung aus dem 17. Jahrhundert, hoch über der Stadt gelegen und bisher für das Publikum nicht zugänglich, wurde zu einem der drei Standorte des Museums auserkoren. Die Geländeunebenheiten des Standorts nimmt die Anlage als Facetten der Mittelmeerlandschaft auf. Über mehrere Ebenen der Festungsanlage hinweg gestaltet, bietet die Anlage einmalige Ausblicke über Marseille und das Mittelmeer. Zwei Fussgängerbrücken aus Cortenstahl verbinden den Garten mit dem Herzen des MuCEM – dem von Rudy Riciotti entworfenen Gebäude J4 – sowie mit dem Stadtviertel Quartier du Panier.
Eine Geschichte der Pflanzen und der Menschen
Auf 12 000 Quadratmetern, wovon 6500 bepflanzt sind, haben die Landschaftsarchitekten Jean-Louis Knidel, Gilles Ottou und Hubert Guichard in Zusammenarbeit mit der Botanikerin Véronique Mure und dem Baumschulexperten Olivier Filippi einen Trockengarten mit 15 Themenbereichen erarbeitet, der die Geschichte der Pflanzen und der Menschen erzählt. Man betritt den Garten über den «Cour des orangers», den Orangenbaumhof. Er ist gemeinsam mit dem Gemüsegarten der einzige bewässerte Teil der Gartenanlage, alle anderen Bereiche benötigen keine künstliche Bewässerung. Seit der Eröffnung des Gartens vor drei Jahren haben sich die Pflanzungen sehr gut weiterentwickelt, wie der «Jardin des myrtes» (Myrtengarten), «Les salades sauvages du fort» (die Wildsalate der Festung), «Les figuiers suspendus» (die hängenden Feigenbäume) oder die «Herbes de la Saint-Jean» (vielfältige Johanniskräuter) zeigen.
Während «Le chemin des aromatiques» (Gewürzpflanzenpfad), «Le potager méditerranéen» (mediterraner Gemüsegarten) und «Le parcours ethnobotanique des plantes emblématiques de la Méditerranée» (ethnobotanischer Entdeckungspfad der emblematischen Mittelmeerflora) regelrechte Sammelgärten sind, und die Pflanzen dort gekennzeichnet und erläutert werden, zum Beispiel in Bezug auf ihre traditionelle Verwendung in der muslimischen und jüdisch-christlichen Kultur, lehnen sich «Les jardins de la colline» (Hügelgärten) oder «Le bosquet des chênes verts» (Steineichenhain) an Landschaften an, wie die für Südfrankreich so typische Garrigue, sowie an die mediterrane Tradition der Land-, Forst- und Weidewirtschaft. Diese traditionellen und identitätsstiftenden Landschaften wurden von Menschenhand mit Pflanzen aus Mittelmeergegenden ausserhalb Frankreichs gestaltet. Somit würde die mediterrane Landschaft nicht ohne die Migration von Mensch und Flora existieren: Sie ist das Ergebnis einer Wanderung und Weiterentwicklung.
Diese eingewanderten Pflanzen, wie der ursprünglich aus Kleinasien stammende Mandelbaum oder der vor den Phokäern eingeführte Kulturolivenbaum, kamen während der Antike, im Mittelalter oder sogar erst im 19. und 20. Jahrhundert hierher. Die drei Teilbereiche «Jardin des ailantes» (Garten der Götterbäume), «Jardin de la canebière et des auffes» (Garten der Hanf- und Halfagräser) oder «Jardin des industries marseillaises» (Garten des Marseiller Handwerks) veranschaulichen dies, indem sie an die Bedeutung der Seiden- und Seilproduktion sowie an den Handel mit Gewürzen, Kaffee, Seife und Öl erinnern. Und schliesslich gibt es noch den «Jardin du vent» (Garten des Windes), dessen graziler Gräsertanz die fundamentale Rolle des Windes bei der Gestaltung der Landschaften unterstreicht, indem er Pollen transportiert und Samen verbreitet. Oder einfach, indem er auf der Dreschtenne die Weizenkörner von der Ähre trennt.
Grenzen überwinden
Entlang dieser sowohl sinnlich als auch didaktisch erfahrbaren Pfade arbeitet ein Gärtner in einer neuen Ausprägung seines Berufs: Er ist für die Entwicklung und Pflege des Gartens zuständig, doch ein Drittel seiner Arbeitszeit widmet er dem Dialog mit den Besuchern. Dabei wirkt er als Mittler zwischen Garten und Publikum. So wird der Jardin des Migrations zu einem Ort, der Freude und Lehre verbindet, die Sinne anspricht und auf verschiedenen Ebenen aktiviert: Er spiegelt die kulturelle Mischung zwischen den Zivilisationen des Mittelmeerraums und ihrer Flora wider, lädt zum Nachdenken über die Begrifflichkeiten der indigenen und exogenen Spezies ein und vergegenständlicht das Phänomen der Durchlässigkeit, des Flusses und der Evolution.anthos, Mo., 2016.12.05
05. Dezember 2016 Suzanne Kříženecký