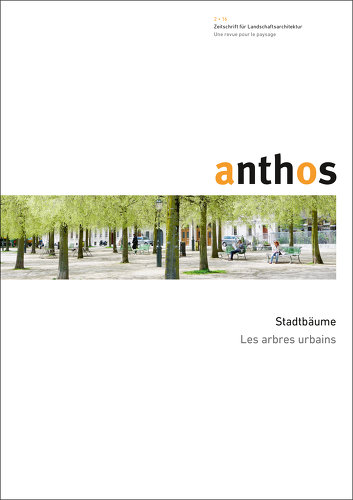Editorial
Das Schicksal vieler Bäume ist, dass sie für die meisten Menschen einfach nur da sind. Jahr ein, Jahr aus. Das Laub färbt sich bunt, fällt ab, im Frühjahr spriesst frisches Grün. Wenn wir laufen lernen, bieten sie uns Halt, im Alter wieder. Einige blühen besonders schön, wie Magnolie oder Kirsche. Die Aufmerksamkeit für Letztere ist in Japan kulturell verankert: Hanami (japanisch 花見, «Blüten betrachten») ist die japanische Tradition, im Frühjahr die ausserordentliche Schönheit der in Blüte stehenden Kirschbäume zu feiern. Den Bäumen wird eine Wertschätzung entgegengebracht, die hierzulande unbekannt ist.
Was aber, wenn sie weg wären? Wenn sich das Klima zu ihren Ungunsten wandelte? Der Stadtbaum am Ende der Strasse gefällt würde, weil er der neuen Leitungsführung entgegen stünde? Sie bei Planungen vergessen gingen oder wegen der vielen Unterbauungen keine Chance hätten?
Nicht erst ihr Verlust sollte uns alarmieren, denn die entsprechenden Weichen stellen wir heute. Der Zeitpunkt für eine breite gesellschaftliche Diskussion zum Wert des Baums und zur Sicherung seiner Existenzbedingungen ist günstig: Mit der Debatte um Innenverdichtung steigt nicht nur die Expertenangst vor dem Verlust alter Stadtbäume und geeigneter Baumstandorte, auch eine interessierte Bürgerschaft nutzt ihre Mitsprachemöglichkeiten und bringt das Bedürfnis nach baumbestandenen Freiräumen mehr und mehr in die Partizipationsverfahren ein. So entstehen in Neubauprojekten hier und da wieder Allmenden mit Nutzbäumen. Auch im Rahmen der aktuellen Commons-Strategien, die Kommunen vielerorts aktiv unterstützen, indem sie Obstbäume in öffentliche Grünanlagen pflanzen. Wobei Nutzbäume ohnehin eine wachsende Lobby hinter sich haben: Rasch wachsende und gut vernetzte Projekte wie mundraub.org verfolgen das Ziel, in Vergessenheit geratene Früchte wieder in die Wahrnehmung zu rücken, um sie als Teil unserer Kulturlandschaft und für die Biodiversität zu erhalten. Auf einer interaktiven Karte sind weltweit, mit Schwerpunkt Europa, Bäume und Areale zum Selbsternten eingetragen. Und auch der einfache Strassenbaum bekommt derzeit Zuspruch, nicht zuletzt wegen seiner positiven Auswirkungen auf das Stadtklima – der urbanen Resilienzdiskussion sei Dank.
Über Trends und Moden hinweg werden vor allem unsere Stadtbäume aber nur dann langfristig gesichert werden können, wenn es dafür vorausschauende Planungen und Strategien, besonders auch verbindliche Regelungen und Vorschriften gibt. Sie fehlen heute leider weitgehend. Der Zeitpunkt zum Handeln ist gekommen.
Sabine Wolf
Inhalt
Alexandre Marchand: Der Stadtbaum im Wandel der Zeit
Dominique Ghiggi: Der Pfingstweidpark
Sandra Gloor, Margrith Göldi Hofbauer: Der ökologische Wert von Stadtbäumen
Dr. Susanne Böll: Strassenbäume im Zeichen des Klimawandels
Fritz Bächle: Hirschmattquartier Luzern
Roger Beer: Baumfällgenehmigungen in Genf
Martin Erb: Erhalt und Sicherung alter Bäume
Jürgen Faiss: Bauminventare
Martin Biedermann, Hans-Peter Rohler: Baumkonzepte
Robert Perroulaz, Séraphin Hirtz: Die Schule der Bäume
Felix Naef: Akzente setzen
Ivan Josi: Koalition der Pflanzen
Brigitte Vogel: Nachtigallenwäldeli in Basel
Sophia Carstensen: Raumwirkung und Atmosphäre von Stadtbäumen
Gudrun Hoppe: Garanten für Lebensqualität in der Stadt
Die Schule der Bäume
Bei der Beobachtung von Spontanvegetation im städtischen Umfeld stellt man sich für gewöhnlich vor, dass der Ort, den sich Bäume ausgesucht haben, um Wurzeln zu schlagen, in direktem Zusammenhang mit dem Eifer oder der Toleranz des Gärtners steht …
«Der Mensch ist tot und sein Garten lebt,
die Pflanzen samen sich dort selber aus,
ohne jede rationale Hilfe (…)»
Raymond Queneau[1]
Götterbaum, Holunder, Esche, Ahorn und andere Arten wachsen gerne auf unkultivierten Restflächen, die oft schwer zugänglich sind und für den eiligen oder nachlässigen Gärtner keine ästhetische Bedeutung haben. Dies ermöglicht eingewanderten, wild wachsenden Pflanzen (auch einheimischen), einen geeigneten Lebensraum vorzufinden. Die Hartnäckigkeit, Wuchs- und Lebenskraft dieser Pflanzen überraschen und zwingen uns, unsere Arbeitstechnik infrage zu stellen. Während durchgeplante, wohl durchdachte Pflanzungen heutzutage mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, protzen die unerwünschten Pflanzen mit ihrer Wuchsfreude – ganz ohne Bewässerung, Pflanzlöcher oder künstlichen Dünger.
Das Wohlbefinden der städtischen Baumpopulation ist ein dauerhaftes Sorgenkind des Stadtplaners. Zu ihrem Gedeihen wurden das Pflanzloch vergrössert, das Substrat verbessert, die Bewässerung intelligenter eingerichtet, Rückschnitttechniken überdacht, die Auswahl der Art und ihre Stärke bei der Pflanzung wohl überlegt. Trotz all dieser Anstrengungen kümmern Stadtpflanzen oftmals vor sich hin, wobei ihre kränkelnde Gestalt in krassem Kontrast zur Vitalität der aus Spontanbesiedelung hervorgegangenen Bäume steht.
Diese freien Bäume, die sich niemals der Zucht und Ordnung unterziehen mussten, haben keinerlei Ausbildung; sie waren nie Schüler einer Baumschule. Als regelrechte «Strassenbäume» stehen diese Wilden weder in Reih und Glied, noch weisen sie eine ordnungsgemässe Form auf – sie sind schlicht Planungsfehler. Sie wachsen einfach ohne jede Pflege, und Gärtner wie Planer empfinden für sie entweder Bewunderung oder blanken Hass.
Setzen wir unsere Beobachtungen doch in den menschenverlassenen Städten fort, beispielsweise in der Maya-Stadt Tikal, in der historischen Khmer- Grossstadt Angkor oder in Prypjat, der «beispielhaften sowjetischen Stadt», welche 1986 nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl evakuiert wurde. Die Natur hat die baulich intakten, verlassenen Stätten längst zurückerobert. Am überraschendsten ist die Standortwahl der Bäume: Nie hätte ein Gärtner gewagt, eine solche Pflanzung anzulegen. Für jeden Planer wäre es widersinnig, einen Baum auf engsten Raum, unmittelbar neben ein Gebäude zu setzen! Und trotzdem gedeihen sie. Das Zusammenleben zwischen Stein, Beton und Gehölzpflanzen ist überraschend. Die Symbiose zwischen Pflanzenreich und Beton führt zur Entstehung grossartiger Mikroklimata, neuer Wasserressourcen für die Pflanzen und der Verfügbarkeit von Mineralstoffen sowie dem Zugang zum Licht. Diese vielseitigen Strategien sind fantastische Überlegungsansätze.
Warum wächst der Sompong-Baum Tetrameles nudiflora viel besser auf den Ruinen der Khmer-Tempel in Angkor als auf echten Freiflächen? Was finden seine Wurzeln in den Regenrinnen dieser Architektur?
In Prypjat verschwinden dreissig Jahre nach der Nuklearkatastrophe die Strassen unter einer dichten, überbordenden Vegetation. Die Bäume gedeihen an Orten mit der stärksten radioaktiven Belastung, obwohl die Doppelhelix ihrer DNA permanent angegriffen wird und sie somit gezwungen sind, ihre genetischen Anlagen dauernd zu reparieren. Ohne Generalplan und ohne jegliche Einschränkungen hat das Reich der Pflanzen die Stadt unbändig in Besitz genommen. Die Komposition dieser Landschaftsgestaltung ist Ausdruck echter Intelligenz und hat zugleich eine eindeutig ästhetische Qualität. Die Verteilung sowie Durchmischung von heimischen und aus Gärten entwichenen Pflanzen verlief dabei erstaunlich harmonisch: Auf einem grossen Platz finden sich Pappeln, Birken besiedelten Balkone, Kiefern wählten tiefgründige Böden, Apfelbäume und Flieder gedeihen im Kindergarten.
Wie pflanzt man Bäume? Das ist die grosse Frage. Sobald man sie dem Wachstum der spontanen Pflanzen entgegenstellt, brechen die Lehren des Landschafts- und Gartenbaus zusammen. Richtlinien über gültige Pflanzabstände werden durch die Freiheit untergraben, welche die Natur sich bei ihrer eigenen Landschaftsgestaltung herausnimmt. Zu viel der Pflege stört die Bäume; Baumstützen verhindern, dass der Stamm dicker wird, was wiederum die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Wind beeinträchtigt. Übermässige Bewässerung verzögert das Wachstum der Wurzeln und zugleich die Eigenständigkeit des Baums: «übermässige Pflege bedeutet letztlich Verfall». Es ist dringend nötig, alle Annahmen und Gewohnheiten bezüglich städtischer Pflanzungen systematisch infrage zu stellen!
Vertrauen Sie den Pflanzen, die aus Samen entstanden sind, vermeiden Sie Klone. Bevorzugen Sie sowohl einheimische als auch eingewanderte Pflanzen, sofern sie an das Klima, die Wasservorkommen und das Erdvolumen angepasst sind, die dem städtischen Baum zur Verfügung stehen.
«(…) Tote und Verletzte sind unter den verlassenen Pflanzen zu beklagen, welche vielleicht die Hand des Gärtners vermissen.» Raymond Queneau[2]
Anmerkungen:
[01,}2] Raymond Queneau: Feu le jardinier. Dans: Courir les Rues, Battre la campagne, Fendre les Flots, Gallimard, 1968, S. 196. (Deutsche Übersetzung durch anthos).anthos, Mo., 2016.12.05
05. Dezember 2016 Robert Perroulaz, Séraphin Hirtz
Garanten für Lebensqualität in der Stadt
Wenn Grünzüge mit Bäumen aus der Landschaft in die Quartiere führen, Parkplätze zu Baumplätzen werden, Strassenräume und Wege zu Alleen, ist viel für die Lebensqualität von Mensch und Tier in Verdichtungsgebieten erreicht. Trotz bestehenden guten Beispielen sind wir noch weit davon entfernt, Bäume als wichtige Strukturgeber in städtebaulichen Überlegungen zu akzeptieren.
Als im 18. Jahrhundert in Anlehnung an die französische Renaissance auch in der Schweiz die ersten Boulevards entstanden, veränderte sich das Bild der Städte. Im Gegensatz zu den engen mittelalterlichen Stadtstrukturen gab es nun neben Licht und Luft auch ausreichend Raum für Strassenbaumpflanzungen. Alleen, die bis dahin ausserhalb der Siedlungen Wege markierten, fanden Einzug in die Stadt. Neben ihrer raumgliedernden und damit städtebaulichen Bedeutung steigerten die Stadtbäume die Lebensqualität der Bevölkerung. Sie trugen effizient zur Staubreduktion bei und verwandelten die neu entstandenen Verkehrsschneisen in attraktive Räume mit Schattenspiel. Das Flanieren unter Bäumen wurde zu einem Qualitätsmerkmal der Stadt und ist es bis heute geblieben.
Bäume brauchen für ihre Entwicklung viel Zeit. Ihre volle Funktion und Schönheit entfalten sie erst nach Jahrzehnten und das auch nur, wenn Bedingungen und Standort optimal ausgebildet sind. Daher müssen sie vorausschauend und für kommende Generationen gepflanzt werden. Dessen sind sich vor allem Stadtplaner, Städtebauer und Architekten häufig leider zu wenig bewusst. In der aktuellen Verdichtungsdiskussion schliesst sich die Frage an, ob insbesondere dem Altbaumbestand ausreichende Aufmerksamkeit und entsprechender Schutz zukommen.
Baumstrategien entwickeln
Wir brauchen langfristige städtebauliche Strategien für den Baum! Dies sowohl im öffentlichen Raum wie auch bei Arealentwicklungen für den privaten Wohnungsbau. Ein kurz skizzierter Massnahmenkatalog könnte folgende Eckpunkte enthalten:
Dem Schutz und dem Erhalt gewachsener Strukturen mit alten gesunden Bäumen gebührt eine höhere Priorität.
Adäquate Ersatzmassnahmen bei Verlust von Bäumen, zum Beispiel durch Überbauungen, sind genauer und als verbindlich zu definieren.
Bei Neubauprojekten sind zusätzliche Bäume in ausreichender Anzahl im Verhältnis zur Bewohnerschaft vorzusehen, ähnlich, wie das heute bei Parkplatzverordnungen der Fall ist.
In Baugebieten mit vorwiegend privatem Grund sind parzellenübergreifende Strategien mit Bebauungs- und Baumkonzepten unter Einbezug der Eigentümer und Bewohnerschaft zu etablieren, die langfristig die Umstrukturierung beispielsweise von Einfamilienhausquartieren zu dichteren und doch attraktiven Wohngebieten gewährleisten.
Aufgrund des grossen Potenzials zur Nachverdichtung mit tragenden Grünstrukturen wird der Siedlungsrand als Entwicklungsschwerpunkt definiert, der als baumbestandener Grünraum seine vielseits geforderte vermittelnde Funktion zur freien Landschaft übernimmt. Der Versuch, die Vernetzung durch reduzierte Geschosszahlen in den Bauzonen zu erreichen, war bisher wenig erfolgreich und ist zumindest in der Agglomeration nicht mehr zeitgemäss. Der Siedlungsrand der Zukunft ist hoch – und dafür weniger flächig – bebaut, mit baumbestandenen Zwischenräumen für die Alltagserholung.
Zur Sicherung ihrer Ökosystemdienstleistungen in grösserem Kontext sind Bäume vermehrt als lineare Vernetzungs- und Durchlüftungsstrukturen entlang von Gewässern, Bahnlinien, Strassen, Fuss- und Radwegen und durchgehenden Grünkorridoren zu pflanzen. Erst, wenn diese Strukturen gesichert sind, ist eine Maximierung baulicher Verdichtung angezeigt.
Mithilfe dieses Massnahmenbündels könnte es uns gelingen, auch für künftige Generationen ein angenehmes Klima und eine hohe Lebensqualität in Verdichtungsräumen zu sichern.anthos, Mo., 2016.12.05
05. Dezember 2016 Gudrun Hoppe