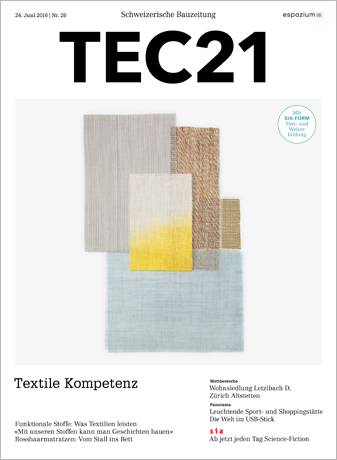Editorial
Fest, elastisch, flexibel, weich, rau, glatt, uni, gemustert, uralt und brandneu – all diese Eigenschaften treffen auf Textilien und ihre Herstellungstechniken zu. Seit Jahrhunderten gehören Textilprodukte zum festen Inventar von Innenräumen, als Vorhänge, Kissen, Tapisserien, Polstermöbel, Matratzen oder Kelims. Oft vereinen sie dabei ästhetische und funktionale Aspekte: Ein ausgesuchter Teppich wertet den Raum optisch auf, hält aber gleichzeitig die Füsse warm und dämpft den Schall.
Neben ihrer Vielseitigkeit in der Anwendung zeichnen sich Textilien durch ihre Reversibilität aus: Maschen lassen sich bei Bedarf leicht lösen, Gewebe für den Einsatz an anderen Orten transformieren. Das schafft Spielraum für Kreativität und macht Lust, Dinge ohne grossen Aufwand auszuprobieren. Kombiniert man Textiltechnik mit «fremden» Materialien oder Technologien wie Metallen, LED oder Silikon, potenzieren sich die Anwendungsmöglichkeiten.
Wie offen die Techniken sind, zeigen die Ausflüge in andere Disziplinen: Im Strickbau werden Holzbalken miteinander verbunden; und dass die architektonische Formensprache auf der textilen «Urkunst» aufbaut, ist spätestens seit Gottfried Semper bekannt. Auch eine der Grundfesten unserer Gesellschaft entstand einst am (industriellen) Webstuhl – was wäre die Welt heute ohne die Digitalisierung, entwickelt aus dem Lochkartenprinzip?
Einen kleinen Ausschnitt aus der textilen Vielfalt möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe präsentieren.
Tina Cieslik
Inhalt
AKTUELL
07 WETTBEWERBE
Jung und Alt in einem Haus
11 PANORAMA
Brücken aus Stahl | Leuchtende Sport- und Shoppingstätte | Die Welt im USB-Stick
15 VITRINE
Neuheiten für Innenräume
17 SIA
Freigabe von vier Normen | Endspurt Kennzahlenerhebung | Ab jetzt jeden Tag Science-Fiction
21 VERANSTALTUNGEN
THEMA
22 TEXTILE KOMPETENZ
22 WAS TEXTILIEN LEISTEN
Tina Cieslik
Multifunktional: Die neuen Stoffe sind nicht nur schön, sondern auch vielseitig einsetzbar.
25 «MIT UNSEREN STOFFEN KANN MAN GESCHICHTEN BAUEN»
Tina Cieslik
Mode trifft Interieur: Wie, das erklärt der Interior-Kreativchef von Jakob Schlaepfer.
28 VOM STALL INS BETT
Tina Cieslik
Ungeahnt: In Niederbipp erlebt die Rosshaarmatratze eine Renaissance.
AUSKLANG
31 STELLENINSERATE
37 IMPRESSUM
38 UNVORHERGESEHENES
Was Textilien leisten
Lang als heimelig verpönt, feiern Vorhänge, Kissen und Teppiche seit einigen Jahren ein Comeback in unseren Interieurs. Die neuen Stoffe können oft mehr, als den Raum mit Sinnlichkeit zu füllen.
Die Textilkunst ist weltweit eine der ältesten Kulturtechniken. In der Schweiz nahm und nimmt sie einen bedeutenden Platz ein: Auf dem Höhepunkt 1870 arbeiteten 12 % aller Schweizer Erwerbstätigen in der Textilindustrie, vorwiegend in den beiden Zentren in der Nordwestschweiz um Basel und in der Ostschweiz um St. Gallen.[1] Technische Innovationen wie die industrielle Herstellung von Spitzen – die bekannte St. Galler Spitze – oder die maschinelle Paillettenstickerei legten den Grundstein für ein Gewerbe, das auch heute noch internationales Renommee hat.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte die inländische Textilproduktion zunehmend ins günstigere Ausland ab, vor allem nach Asien. Um sich gegen die Konkurrenz behaupten zu können, spezialisierten sich die noch bestehenden Betriebe – beispielsweise auf technische Textilien für die Medizin-, Outdoor- oder Sicherheitsbranche, aber auch auf hochwertige Luxusstoffe für Haute Couture oder funktionale Gewebe für Inneneinrichtungen.
Was die Innenausstattung betrifft, hat sich in den letzten Jahren die Wahrnehmung gewandelt. Nach den plüschigen 1970er-Jahren verschwanden die Textilien aus den Räumen, sowohl den öffentlichen wie auch den privaten. Textilkunst galt als weibliches Bastelhandwerk. Inzwischen haben die Raumtextilien die Interieurs zurückerobert, in Form von Teppichen, Kelims, Vorhängen, Polsterstoffen, aber auch architektonischen Elementen wie Soft Cells oder Raumteilern.
Neben der emotionalen Komponente, der Fähigkeit, «dem Raum Poesie zu verleihen»,[2] übernehmen sie oft auch funktionale Aufgaben. Die neueste Generation der Stoffe vereint oft gleich mehrere Eigenschaften: Sie sind schwer entflamm- und biologisch abbaubar, verbessern die Akustik, wirken als Blendschutz, reflektieren einfallende Sonnenwärme und dienen als Lichtquelle.
Nicht synthetisch, aber flammhemmend
Im Objektbereich ist die Verwendung flammhemmender Stoffe wegen der hohen Sicherheitsanforderungen fast zwingend. Synthetische flammhemmende Textilien können statische Elektrizität erzeugen und Staubpartikel sowie Schadstoffe anziehen, zudem absorbieren sie keine Feuchtigkeit. Textilien aus Naturfasern (vgl. Glossar) wie Leinen oder Baumwolle sind feuchtigkeitsregulierend, allergenfrei und antistatisch, aber eben auch leicht brennbar.
Von 2011 bis 2015 hat das Unternehmen Christian Fischbacher aus St. Gallen daher auf Initiative des lombardischen Garnhersteller Coex und der Universität Pavia an einem Stoff aus möglichst umweltfreundlichen Naturmaterialien geforscht, der aber dennoch schwer entflammbar sein sollte (vgl. Glossar). Das Ergebnis ist «ECO FR», ein Stoff aus der Regeneratfaser Viskose und den Naturfasern Leinen und Baumwolle. In Italien hergestellt, gibt es ihn in drei verschiedenen Qualitäten, die sich durch den Anteil des jeweiligen Ausgangsmaterials und damit in Gewicht und Dichte unterscheiden.
«FR» steht für fire retardant, das Produkt hält Temperaturen bis zu 1000 °C stand, ohne zu schmelzen oder zu tropfen. Anschliessend verkohlt es, bindet Sauerstoff und erstickt dadurch die Flammen, ohne dass schädliche Emissionen entstehen. Dies wird mittels einer molekularen Modifikation der Zellulose bei der eher umweltbelastenden Viskoseherstellung (vgl. Glossar) erreicht, sodass der Stoff nicht nachträglich chemisch imprägniert werden muss (waschbar ist er allerdings nicht, was wiederum eine chemische Reinigung bedingt).
Dies wirkt sich auch auf die Entsorgung aus: Der Stoff soll komplett biologisch abbaubar sein. Ob dies innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 30 Tagen gelingt, wird momentan getestet.
Schall, Wärme, Blendung
Ein weiteres Bedürfnis ist die Verbesserung der Akustik[3] und die Regulierung von einfallendem Sonnenlicht, und der Wärme, die dieses mit sich bringt. Schallabsorbierende Textilien verbessern die Raumakustik, indem der kinetische Anteil der Schallenergie innerhalb des Gewebes in Wärme umgewandelt wird, was die Nachhallzeit vermindert.
Für die Regulierung von Licht und Wärme werden in der Regel metallisierte Stoffe eingesetzt, die Ersteres reflektieren.
Der Langenthaler Textilhersteller Création Baumann befasste sich mit der Vereinigung dieser drei Funktionen. Nach anderthalb Jahren interner Entwicklung lancierte das Unternehmen im April 2016 den transparenten Vorhangstoff «Reflectacoustic»: Er bietet hohen Blend- und Wärmeschutz, gleichzeitig absorbiert er auch den Schall. Der bewertete Schallabsorptionsgrad, geprüft nach ISO 11654, liegt bei αw= 0.6 (vgl. Glossar, «Nachhallzeit»). In das zweiseitige Polyestergewebe aus Trevira CS ist auf der Rückseite ein metallisiertes Foliengarn eingewoben.
Auf diese Weise reflektiert die Geweberückseite das Sonnenlicht und verringert die Wärmeeinstrahlung um 40 %. Besonders ist die Oberfläche der vor Ort in Langenthal hergestellten, waschbaren Textilien: Bestehende reflektierende Stoffe sind in der Regel an der Rückseite mit einer Schicht aus Metallstaub bedampft, sodass sie grau wirken. Bei der Neuentwicklung entschied man sich stattdessen für eine Streifenlösung, transparente Flächen wechseln sich mit metallisierten Rippen ab. Dadurch bleibt der Stoff zum einen lichtdurchlässig, zum anderen besitzt er eine glatte Vorderseite, auch in Weiss.
Licht und Atmosphäre
Die Verbindung von Textilien und Licht gelingt dem Vorhangstoff «eLumino», den Création Baumann 2013 auf den Markt brachte. Die Technik, die LED auf Stoff appliziert, wurde im Rahmen des anderthalbjährigen KTI-Forschungsprojekts «e-Broidery» zusammen mit Partnern wie dem Textilunternehmen Forster Rohner aus St. Gallen und der Hochschule Luzern für Design und Kunst HSLU entwickelt.
Die langjährige Erfahrung und eigene Forschungsarbeiten des Stickereispezialisten Forster Rohner waren dabei entscheidend: Stickerei erlaubt die genaue Platzierung von Elementen auf einem Stoff und ermöglicht so die nötige Präzision zur Übertragung elektronischer Signale. Jede Diode benötigt zwei Leiterbahnen, die als Doppellinie in die Stickerei integriert sind. Die Dioden sind Eigenentwicklungen und erinnern an glänzende Pailletten.
Leiterbahnen und LED erzeugen auf dem Stoff, einer Mischung aus Polyester in Trevira CS und mit Metall beschichteteten Garnen, ein dekoratives Muster mit auf drei Stufen dimmbaren Lichtpunkten. Die Leiterbahnen werden industriell eingestickt, in einem zweiten Schritt werden die Dioden aufgebracht. Die Eigenschaften des Stoffs, seine Weichheit und der Fall bleiben erhalten.
«eLumino» wird mit einem Kabel mit USB-Stecker an die Stromversorgung angeschlossen, kann aber auch mit Akku betrieben werden. Um den Stoff zu waschen oder zu reinigen, kann die Stromzufuhr entfernt werden. Dimmer und An/Aus-Schalter sind in der Seitennaht platziert. Den Stoff gibt es in zwei Dessins und in zwei Stoffqualitäten, einmal als transparenter Voile (47 g/m2), einmal als opakes Gewebe (167 g/m2), in jeweils drei Farben. Inzwischen lief bereits ein neues Forschungsprojekt zum Thema «e-Broidery» an der HSLU, das sich mit chromatischen Lichteffekten auseinandersetzte und im November 2015 abgeschlossen wurde.[4]
Handwerk trifft Hightech
Neben den funktionalen Eigenschaften machen Textilien aber auch einfach Freude. Die Weichheit und Elastizität, die Beweglichkeit und die Faltungen, die vielfältigen Materialien, Muster, Farben und die Abstufungen in der Transparenz bieten visuelle, akustische und haptische Eindrücke. Inwieweit sie sich mit immer mehr Funktionen beladen lassen, werden zukünftige Entwicklungen zeigen. Im Hinblick auf die ökologischen Standards der gesamten Produktionskette gibt es aber schon heute noch Luft nach oben.TEC21, Fr., 2016.06.24
Anmerkungen:
[01] «Historisches Lexikon der Schweiz > Textilindustrie,
www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13957.php, Zugriff am 23.5.2016
[02] Beatrice Hirt, «Textile Innovation als treibende Kraft» in Made by..., Hochschule Luzern Design & Kunst, Nr. 4, Mai 2014
[03] Vgl. auch E-Dossier «Akustik», www.espazium.ch/tec21/dossier/akustik
[04] Vgl. www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/forschung/projekte/detail/?pid=536
Die Textilien sind auch in bewegten Bildern erlebbar.
ECO FR: www.bit.ly/eco_fr
eLumino: www.bit.ly/elumino
24. Juni 2016 Tina Cieslik