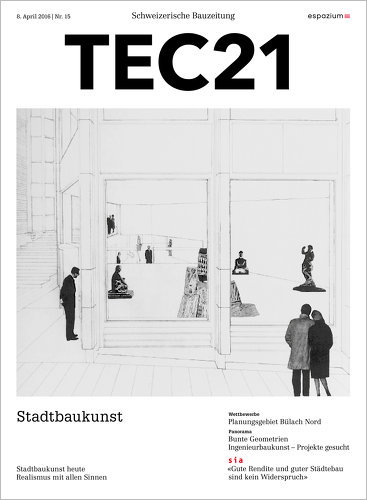Editorial
Warum sollen wir uns heute noch mit «Stadtbaukunst» beschäftigen? Viele verbinden damit eine konservative Haltung aus längst vergangenen Zeiten. Camillo Sitte, Karl Henrici und Theodor Fischer prägten Ende des 19. Jahrhunderts den «künstlerischen Städtebau», nachdem die Stadtgrundrisse zuvor nach geometrisch-formalen Kriterien entworfen worden waren.
Sie dachten die Stadt nun verstärkt als Raum, indem auch Vorhandenes miteinbezogen wurde, Architektur und Städtebau bildeten eine Einheit: eine spannende Auseinandersetzung – umso mehr, weil diese Themen, nach dem Scheitern der städtebaulichen Visionen der Moderne, den Diskurs ab den 1980er-Jahren erneut prägten.
In dieser Ausgabe blicken unsere Autoren in die Geschichte zurück. Ingemar Vollenweider aus Basel und Matthias Castorph aus München sind praktizierende Architekten und lehren Stadtbaukunst an der TU Kaiserslautern. Sie fokussieren Protagonisten aus unterschiedlichen Epochen: Theodor Fischer als Vertreter der klassischen Stadtbaukunst sowie Alison und Peter Smithson, bekannt als Pioniere des englischen Brutalismus, die sich vom Städtebau der Moderne distanzierten und in ihrer späten Schaffensphase, für viele nicht bekannt, eine grosse Sensibilität für Stadt und Atmosphäre zeigten.
So unterschiedlich diese Persönlichkeiten und ihre Kontexte sind, so überraschend sind die Berührungspunkte und Ergebnisse in ihrer räumlichen Auseinandersetzung mit der Stadt: Denn die Planungen von Fischer sind zeitgemässer und die Denkformen der Smithsons traditioneller, als man erwarten würde. Beide Perspektiven sind für uns heute gleichermassen bereichernd.
Susanne Frank
Inhalt
AKTUELL
07 WETTBEWERBE
Modelle für die Zwischenstadt
12 PANORAMA
Bunte Geometrien | Projekt gesucht | Die Welt von Alexander Girard
18 VITRINE
Neues aus der Baubranche | Weiterbildung
22 SIA
«Gute Rendite und guter Städtebau sind kein Widerspruch» | Kompetenzcluster für die Digitalisierung des Bauens | Anwendungswissen digitales Planen | Energieeffizienz, Planungspolitik, BIM – aber auch Architekturgespräch | Austausch mit Sektionen der Romandie
29 VERANSTALTUNGEN
THEMA
30 STADTBAUKUNST
30 STADTBAUKUNST HEUTE?
Matthias Castorph
Theodor Fischer zeigte als Architekt und Stadtplaner in München, wie Stadt als Raum gedacht wird und städtebauliche Theorien in die Praxis überführt werden.
36 REALISMUS MIT ALLEN SINNEN
Ingemar Vollenweider
Die Architekten Alison und Peter Smithson entwickelten eine grosse Sensibilität für räumliche Zusammenhänge und die Wahrnehmung von Stadt. Ihre Denkformen inspirieren auch heute.
AUSKLANG
42 STELLENINSERATE
45 IMPRESSUM
46 UNVORHERGESEHENES
Realismus mit allen Sinnen
Die Architekten Alison und Peter Smithson beschäftigten sich mit der sinnlichen Wahrnehmung städtischer Phänomene und setzten sie in Verbindung mit der sozialen Frage des Gebrauchs. Ihre Seh- und Emp!ndungsschule liefert Instrumente und Einsichten, die auch heute relevant sind.
Die Wiederentdeckung des Städtischen ist ein Projekt der «dritten Generation der Moderne», wie sich die englischen Architekten Alison und Peter Smithson selbst definieren. Sie ist, vielleicht überraschend, mit einer Suche nach elementaren Wahrheiten und möglichen Neuinterpretationen verbunden, die sich ihrerseits wiederzuentdecken lohnen. «Italienische Gedanken – Beobachtungen und Reflexionen zur Architektur» erschien 1996 nur auf Deutsch in der Reihe «Bauwelt Fundamente» und fasst die Arbeiten von Alison und Peter Smithson im Rahmen des von Giancarlo de Carlo gegründeten «International Laboratory of Architecture and Urban Design» (ILA & UD) in der Zeit zwischen 1976 und 1991 zusammen.
Sie eröffnen eine Sichtweise, die wahrscheinlich weniger bekannt ist als die Statements der Smithsons in Form von Ausstellungen und Texten aus der heroischen Phase vor 1970. Sie werden 2001 ergänzt durch «Italienische Gedanken, weitergedacht» und entstehen in einem Zeitraum, in dem die Smithsons neben den Gebäuden für den Universitätscampus von Bath nur noch wenig bauen. Ihre brutalistische Wohnüberbauung «Robin Hood Gardens» im Londoner East End gilt schon kurz nach Fertigstellung 1972 als sozial gescheitert. Aktuell wird über deren bereits 2008 beschlossenen Abriss gestritten. Wie dieser gesellschaftliche Misserfolg das Denken der Smithsons in der Folge beeinflusst, ist an anderer Stelle zu untersuchen. An dessen innerer Konsequenz ändert sich jedenfalls nichts, wie die tabellarische Übersicht belegt, die dem ersten Band der «Italienischen Gedanken» vorangestellt ist und den Zusammenhang zwischen den akademischen Arbeiten am ILA & UD und dem schmalen gebauten Werk in dieser Zeit darstellt.
Ihr Interesse für kleine Situationen, Tore und Portale, Schranktüren, Spuren in der Landschaft oder den Himmel über Rimini steht natürlich in der Kontinuität ihrer Entdeckung der Ästhetik des Gewöhnlichen und des sogenannten «As-Found-Prinzips», das die Smithsons in den 1950er-Jahren früh berühmt gemacht hat: «As found is a small affair: it’s about being careful.»[1] Allerdings macht es einen Unterschied, ob dieses sorgsame Interesse für das «Andere» am mythischen Anfang einer Karriere steht, ohne Aufträge und gebautes Werk, oder in einer Phase, in der man erwarten würde, dass sich nach ersten Erfolgen ein immer grösseres Œuvre entfaltet.
Je nach Blickwinkel erscheint diese leidenschaftliche Beschäftigung als eigenständig oder verschroben, mutig oder tragisch. In jedem Fall steht sie quer zu vielem, was das architektonische Metier und die Produktion von Stadt aktuell prägt.
Konglomerate Ordnung
Die «Italienischen Gedanken» sind nicht systematisch geordnet. Wie in den Wunderkammern der Spätrenaissance und des Barock stehen Grosses und Kleines, Allgemeines und Spezifisches scheinbar zufällig nebeneinander. Die Herausgeber Hermann Koch und Karl Unglaub sprechen im Vorwort von ihren Bemühungen, «die ungewöhnlichen fragmentarischen Wortschöpfungen und Satzbauten der Autoren ins Deutsche zu übertragen».[2] Die Pulsgeber der brutalistischen Avantgarde sind Engländer mit einem Hang zu eigenwilligen Sprach- und Denkmodellen und unhierarchischen Ordnungssystemen. Ein solches System, die «konglomerate Ordnung», nimmt dann im ersten Band einigen Raum ein, bildet einen inhaltlichen Schwerpunkt, wenn man einen ausmachen will. «Ein Gewebe der konglomeraten Ordnung nimmt alle Sinne in Anspruch», steht einleitend. Als Referenz dient den Smithsons der Getreidespeicher «La Grancia di Cuna» im Contado von Siena, den sie als ein Konglomerat von Hallen, Rampen und Türmen beschreiben, mit labyrinthischen Qualitäten und geheimen Orten, in dem man aber immer ein natürliches Gefühl der Sicherheit und Orientierung verspüre. Diese «Natürlichkeit» und die Erfahrung, «dass ein Gewebe ‹geordnet› ist, auch wenn wir den Ort nicht auf den ersten Blick verstehen oder das Gebäude kennen»[3], ist wohl der elementare Wesenszug, den die Smithsons mit einer strategischen Perspektive auf den Begriff zu bringen versuchen. Mit einem deutlichen Shift gegenüber ihrer strukturalistischen Auffassung der 1950er-Jahre, die sehr konzeptionell aus der Gegenposition zum CIAM und der funktionsgetrennten Stadt entwickelt war, betonen sie jetzt die sinnliche und räumliche Wahrnehmung von Stadt und Architektur. Im Rückblick relativieren sie, zwar nur sehr sanft, ihren idealistischen, allzu symbolistischen Ansatz: «Sicherlich waren unsere frühesten Arbeiten in den Fünfzigerjahren – die ‹Golden Lane streets-in-the-air› und unser Beitrag zum ‹Hauptstadt-Berlin-Wettbewerb› – bewusst Gewebe in Form überlagerter Netze, die miteinander verbundene Räume bildeten, um irgendwie das Netzwerk der Gesellschaft auszudrücken.»[4] Dagegen ist der «Kanon der konglomeraten Ordnung», den sie in den «Italienischen Gedanken» aufstellen, einem Realismus verpflichtet, der sehr konkrete, fast naturalistische Züge trägt. War die Umdrehung des Denkens vom Objekt zum Raum zuvor eine Bewegung im Kopf, die bei den besagten Projekten dazu führt, dass neu die Räume und Wege, sprich die Erschliessungssysteme objekthaft aufgefasst und als Netzstrukturen entworfen werden, ohne eine Antwort für die Räume, die wiederum dazwischen entstehen, geben zu können, so wird das Räumliche jetzt primär als erlebbares Phänomen formuliert.
«Ein Gebäude der konglomeraten Ordnung hat räumliche Präsenz – überwältigender als die Präsenz des Objekts. Es ist nicht im entferntesten auf ein einfaches geometrisches Schema reduzierbar oder durch zweidimensionale Bilder vermittelbar.»[5] Die Vorstellung, dass sich ein Gebäude der konglomeraten Ordnung seinem Wesen nach mit allem verbindet, was es umgibt – «mit anderen Gebäuden, Menschen, dem Himmel, Bergen, Vögeln, Flugzeugen»[6] –, kommt in ihren Gebäuden auf dem Campus der Universität Bath zum Ausdruck, die aktiv das Wege- und Beziehungsnetz der öffentlichen Orte, auch Parkplätze und Bushaltestellen, miteinbeziehen. Im Gebäude «6 East» der Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen ist das komplexe Raumprogramm in Zonen unterschiedlicher Dichtegrade angeordnet, die eine natürliche, instinktive Benutzung und Bewegung durch das Gebäude unterstützen sollen. Nach aussen kommuniziert das Haus über Rampen, Loggien und differenziert ausgebildete Fensteröffnungen mit der unmittelbaren und ferneren Umgebung des Campus.
Dieses strukturelle Prinzip wird auf den Massstab der Stadt erweitert und als «das islamische konglomerate Erbe» an der Altstadt von Sevilla anschaulich gemacht. Idealistischer Städtebau der Inszenierung versus realistischem Städtebau, der durch den Gebrauch und die Topografie des Orts geprägt ist: «Die Wege und Strassen der Renaissance sind Theater. Mittelalterliche Wege und Strassen sind Tatsachen.»[7] Die Voraussetzungen dafür, dass ein Stadtraum absorptionsfähig ist, werden umrissen. Die reduzierte Geschwindigkeit des Verkehrs, die nicht aufgrund von Gesetzen, sondern aus Gewohnheit Vertrauen in das soziale und physische Gewebe der Stadt schafft, ist ebenso benannt wie die Unregelmässigkeit des Raums, der dadurch «unsichtbar» endet, in andere Raumzonen übergeht und immer ein Überangebot an Leere und Kapazität evoziert. Die Verunklärung von Grenzen soll zugleich die Zerstreuung von Geräuschen unterstützen und ein Gefühl von Kontinuität und Zugehörigkeit vermitteln, das in der «Erweiterung der Behausung» im Rhythmus des jahrzeitlichen Wechsels seine funktionale Entsprechung findet.
Die steile These, unerschütterliches Vertrauen in die eigene Gemeinschaft sei Voraussetzung dafür, dass die Bewohner fähig sind, das Fremde zu absorbieren, im Sinn einer eher «gleichgültigen Neugierde», scheint heute neue Brisanz zu gewinnen. Die Auseinandersetzung mit der «Absorptionsfähigkeit des Zwischenraums» weist auf den Schwerpunkt der weitergedachten «Italienischen Gedanken» des zweiten Bands hin – oder wie es die Autoren selbst in der Einführung formulieren: auf den Zwischenraum als Kernthema jedes gebauten Eingriffs.
Zwischenraum
Aus heutiger Sicht und mit schnellem Blick wirken viele der Beobachtungen und Einsichten des zweiten Bands etwas abgehoben. Das mag auch mit den gezeigten Projekten zusammenhängen. Kleinste Interventionen, denen grosse Wirkungen unterstellt werden, formal im wahrsten Sinn etwas schräg, wenn immer wieder die diagonale Linie in gerüsthaften Konstruktionen oder in Stab- und Fachwerken auftaucht und offenbar als Merkmal und Zeichen eines neuen Stils verstanden sein will. Lässt man sich davon nicht ablenken, wird allerdings ein hochverfeinertes Sensorium für räumliche und atmosphärische Zusammenhänge sichtbar.
Die Richtung ihres Denkens weg von der osmotischen Struktur von Gebäuden hin zur bindenden Kraft des Zwischenraums führt zunächst zu Verbindungselementen wie Pfaden, Autobahnen oder Flussläufen, also – wenig erstaunlich für die Smithsons – zur Infrastruktur der Zirkulation, von dort zu «Uferreaktionen» oder «Massnahmen zur Bodenverbesserung». Über die Wahrnehmung des Himmelsausschnitts als Gestaltungsmittel führt sie auch zur Beschäftigung mit der Stadtsilhouette, zum Charakter von Strassenräumen und zur Gliederung von Baukörpern und Fassaden als Betonung einer topografischen Situation. Im Rückblick dient das berühmte Foto der Smithsons von 1956 mit Mitgliedern der Independent Group, dem Künstler Eduardo Paolozzi und dem Fotografen Nigel Henderson, mit denen zusammen sie auf Stühlen mitten in der Strasse sitzen, der Reflexion über die Proportion und Lichtqualität dieser Strasse: «Hier, in der Limerstone Street, hat der Himmel eine besondere Qualität. Es hat etwas mit der Form des Strassenraums zu tun, mit dessen Definition durch kurze, gerade Gesimslinien und mit der Qualität des Lichts. Man fühlt diese Qualität jedesmal, wenn man durch die Strasse geht. Hier nimmt man den Himmel wegen des flachen Horizonts und der Offenheit der Strasse wahr – und weil er durch ganz einfache Häuser und Schornsteine geformt wird.»7
Die Verknüpfung eines legendären Moments der britischen Avantgarde mit der empathischen Beschreibung eines traditionellen Strassenraums deutet die Spannweite des Denkens an und das architektonische Kontinuum, in dem die Smithsons sich ganz «unmodern» bewegen. Das funktioniert auch in die andere Richtung: «Bath – Walks within the Walls» erscheint 1971. Gleichzeitig mit der Fertigstellung von «Robin Hood Gardens», der Inkunabel des Brutalismus, gehen die Smithsons auf träumerische Rundgänge auf der Suche nach dem Wesen einer alten Stadt. Ihre Faszination für deren Permanenz verblüfft, sie interpretieren diese allerdings nicht nur formal, sondern auch als soziales Programm: «The reverie that Bath can induce is an important part of the lesson ... unique in the depth of its commitment to the romantic-classical dream ... remarkable cohesion ... a form-language understood by all, contributed by all. That the rules were understood by all meant they were extended far beyond the text-books.»[9] Konvention wird zur Basis für die schöpferische Auseinandersetzung mit der Stadt und die Ausbildung charakteristischer Orte.
Lessons to learn?
Die Smithsons bieten einen Realismus im Umgang mit der Stadt, der an der sinnlichen Wahrnehmung städtischer Phänomene und Muster ansetzt und sie in Verbindung bringt mit der sozialen Frage des Gebrauchs. Dafür entwickeln sie Kategorien, die nicht systematisch geordnet sind, aber zu einer konsistenten Haltung führen. Ihre Seh- und Empfindungsschule, die vom Alltag und dem Gewöhnlichen ausgeht und sich im Lauf der Jahre immer stärker architektonisch verfeinert, sowie ihre Thesen zu einer absorptionsfähigen Stadtstruktur gehören in einer Zeit, in der wir Debatten über Dichtestress führen und eher ohnmächtig vor der Frage stehen, wie wir unsere Stadt, die Agglomeration, weiterbauen sollen, ins Curriculum jeder zeitgemässen Architekturlehre, gewissermassen als Vorkurs oder Propädeutikum für die Auseinandersetzung mit Stadt, Landschaft und Architektur. Diese Programmatik bereitet aber auch einen Paradigmenwechsel vor, der für die Smithsons zu jenem Zeitpunkt längst im Gang ist: «Die nächste Architektursammlung unserer Zeit wird völlig anders sein, da sie nicht ‹Gebäude› dokumentieren wird, sondern ‹gebaute› Situationen.»[10] Als Primat vom öffentlichen Raum auszugehen, relativiert die objekthafte Thematisierung von Architektur. Die Häuser gehen Beziehungen ein, und die Stadt wird zur kollektiven Leistung.
Heute entsteht Stadt immer noch objektgesteuert, im besten Fall durch die Aufteilung grösserer Baublöcke unter verschiedenen Architekten. Lebendigkeit durch Markenvielfalt bleibt meist die einzige Zielsetzung. Über die Frage, welche spezifischen Orte und Raumcharaktere dabei entstehen könnten und welche Konsequenzen sich daraus für die Benutzung, die Struktur und die Erscheinung von Architektur ableiten müssten, wird selten diskutiert. Was früher durch Konvention und Begrenzung der Mittel selbstverständlich war, ist vielleicht heute in neuen Modellen von Diskurs und Kooperation zu verhandeln, die genau so mühsam wie spannend wären, weil damit viel mehr zu erreichen ist als ein weiteres schönes Objekt (vgl. TEC21 46/2015, «Städtebau als Gemeinschaftswerk»). Tibor Joanelly hat im «werk» 6-2015 in einem Essay mit dem Titel «Play it right» eine Strömung aktueller Schweizer Architektur ausgemacht, die einem neuen Realismus verpflichtet Häuser baut, die allerdings unterschiedliche, persönliche Sichtweisen auf die Wirklichkeit thematisieren. Entstehen würden dabei Häuser, die man gebrauchen und sinnlich erleben kann, weil sie ganz bestimmte Atmosphären erzeugen und davon getragen sind. Dieser architektonische Anspruch bietet die Ausgangslage, um von einzelnen Häusern auf Situationen und Ensembles erweitert zu werden, sprich, den Realismus der Architektur mit der Realität der Orte zusammenzubringen. Die Annäherungen von Alison und Peter Smithson zeigen ein doppeltes Wagnis: diese Orte sinnlich «wahr zu nehmen», möglichst umfassend, und dafür Worte zu finden, aus denen Denkformen des Städtischen werden.
Zeit, die «Italienischen Gedanken» weiterzudenken.
Anmerkungen:
[01] Peter Smithson, in «As Found – The Discovery of the Ordinary», ed. by C. Lichtenstein, T. Schregenberger, 2001, S. 198
[02] A. & P. Smithson, Italienische Gedanken, Bauwelt Fundamente 111, 1996, S. 7
[03] Ebd., S. 110
[04] Ebd., S. 126
[05] Ebd., S. 116
[06] Ebd., S. 140
[07] A. & P. Smithson, Italienische Gedanken, weitergedacht, Bauwelt Fundamente 122, 2001, S. 28
[08] Ebd., S. 66
[09] A. & P. Smithson, «Bath – Walks within the Walls», Adams and Dart, 1971 zitiert in «Without Rhetoric, An Architectural Aesthetic 1955–1972», 1974, S. 66 ff.
[10] A. & P. Smithson, «The Heroic Period of Architecture», 198TEC21, Fr., 2016.04.08
08. April 2016 Ingemar Vollenweider