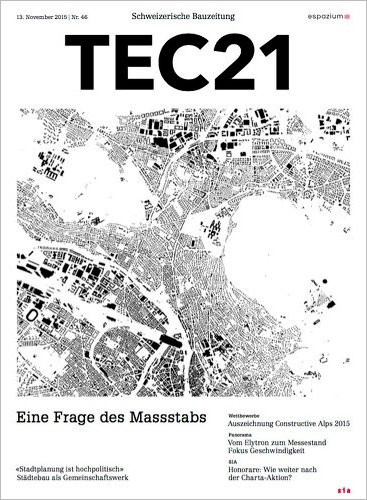Editorial
Das Thema Verdichtung stellt unsere Stadt- und Raumplanung aktuell vor grosse Herausforderungen. Mehr noch als die Städte selbst betrifft dies die räumliche Entwicklung über ihre Grenzen hinaus in den Stadtlandschaften der Agglomeration. Warum sieht es dort so aus, wie es aussieht? Welche Einflüsse sind entscheidend? Und vor allem: Wie kann man die Entwicklung steuern?
Mit Verantwortlichen aus Architektur und Planung diskutieren wir über Aufgaben, Probleme und Lösungsmöglichkeiten in der Planungspraxis – und berühren dabei die Schnittstellen zwischen Architekten, Städtebauern und Raumplanern, die auf jeweils unterschiedlichen Massstabsebenen arbeiten. Politische und gesellschaftliche Fragen prägen die Prozesse der Stadtplanung auch heute massgeblich.
Umso wichtiger erscheint es, diese Zusammenhänge auch in einem grösseren Kontext zu beleuchten: Mit einem Blick in die Historie und einer scharfen Analyse sowohl der städtebaulichen als auch der gesellschaftlichen Entwicklungen zeigt der Architekt, Ökonom und Philosoph Georg Franck in seinem Essay Perspektiven auf und bezieht hierbei auch die Lehre ein.
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist eine wichtige Voraussetzung, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Ob dies gelingt, entscheidet sich jedoch auf der gesellschaftlichen Ebene: Lösungen zeichnen sich ab, wenn wir Stadtplanung als gemeinschaftliche Aufgabe verstehen und angehen.
Susanne Frank
Inhalt
7 WETTBEWERBE
Architektur als soziale Skulptur
10 PANORAMA
Vom Elytron zum Messestand | Fokus Geschwindigkeit
14 VITRINE
Neue Räume 2015 | Bau Energie Messe 2015
17 STABILITÄTSNACHWEIS NACH THEORIE 2. ORDNUNG
Normen zu Beton und Raumnutzungsdaten | Honorare: Wie weiter nach der Charta-Aktion?
23 VERANSTALTUNGEN
24 «STADTPLANUNG IST HOCHPOLITISCH»
Susanne Frank
Verantwortliche aus Architektur, Städtebau und Raumplanung berichten aus der Praxis und diskutieren über aktuelle Fragen, Probleme und Perspektiven in der Stadtplanung.
28 STÄDTEBAU ALS GEMEINSCHAFTSWERK
Georg Franck
Der Zerfall des Städtebaus hat unsere räumliche Umwelt nachhaltig geprägt. Begreift man Städtebau als Gemeinschaftsleistung, so zeigen sich Lösungen aus dem Dilemma.
35 STELLENINSERATE
37 IMPRESSUM
38 UNVORHERGESEHENES
Städtebau als Gemeinschaftswerk
Städtebauliche Glanzleistungen der Vergangenheit beruhen auf gemeinschaftlicher Produktion. Was kann eine Gesellschaft, die immer stärker individualisiert, daraus lernen, und wie lässt sich dieses Wissen anwenden? Städtebau ist keine solistische Disziplin, sondern ein Ensemblespiel.
Raumplanung und Städtebau steuern die Entwicklung von Siedlungsstrukturen und Mustern der Raumnutzung. Anders als in Planwirtschaften ist in Marktwirtschaften die Disposition über die Raumnutzung zwischen zentraler öffentlicher Planung und dem privaten Grundeigentum geteilt. Grund für die Unselbstständigkeit der privaten Verfügung ist erstens die Unteilbarkeit derjenigen Raumnutzung, die alle mit allen anderen Grundstücken verbindet, und sind zweitens die Auswirkungen der privaten Nutzung des Raums, die sich nicht an Grundstücksgrenzen halten und die ab gewisser Intensitätsstufen eines übergreifenden Managements bedürfen. Die Intensität dieser externen Effekte nimmt zu mit der Dichte, der Emissivität der Nutzungen, der Kleinteiligkeit des Grundeigentums und der Knappheit des Raums. Es gibt keine Städte ohne bewusstes Management externer Effekte.
Die klassische, bis in die Anfänge des Städtewesens zurückreichende Form des öffentlichen Managements der externen Effekte privater Raumnutzung ist die Gestaltung von Baurechten. Durch die Festlegung, wie hoch, wie dicht, wofür und in welcher Weise gebaut werden darf, wird geregelt, welche Art und Intensität solcher Effekte der Nachbarschaft zuzumuten und von dorther zu dulden sind. Diese Art des Managements ist bis heute die zentrale Aufgabe der Raumplanung: die räumlich individualisierende Gestaltung von parzellenscharf abgegrenzten Raumnutzungsrechten.
Die Rechtsplanung arbeitet mit dem sperrigen Verfahren der Schöpfung subjektiver Baurechte. Sie ist, was die Gestaltung von Räumen betrifft, auf den Weg des Ver- und Gebietens angewiesen.
Architektonische und städtebauliche Qualität kann man aber nicht verordnen, sondern durch Vorschriften allenfalls verhindern. Niemand wird von der Rechtsplanung erwarten, dass sie auf die Subtilitäten der architektonischen Gestaltung des urbanen Raums eingehen kann. Die architektonische Qualität der Strassen- und Platzräume ist vielmehr Sache der Architektur, die eine grundsätzlich doppelte Aufgabe hat: Die Architektur soll erstens Innenräume umschliessen und zweitens Aussenräume definieren. Im städtischen Kontext hat die Architektur immer auch Städtebau zu sein. Die Architektur ist, was die Definition der Aussenräume betrifft, nicht auf sich allein gestellt, sondern auf andere Architekturen bezogen und auf deren Mitwirkung angewiesen. Sie ist, als Städtebau, keine solistische, sondern eine Disziplin des Ensemblespiels.
Das Verhältnis von Raumplanung und Städtebau folgt nicht der einfachen Dichotomie von öffentlich und privat. Es ist auch keines zwischen fest verankerten Institutionen. Wohl ist die Raumplanung fest als Rechts- und Infrastrukturplanung institutionalisiert, gar keine Institution mit verbindlich festgelegtem Zuständigkeitsbereich ist aber der Städtebau. Städtebau gibt es nur im Rahmen eines Möglichkeitsraums, dessen Existenz und Ausmasse davon abhängen, ob 1. die öffentliche Planung und 2. die privaten Bauherren ihn offenhalten, und 3. davon, ob die beteiligten Architekten auch Gebrauch davon machen. Allen drei Bedingungen war der Zeitgeist der Moderne abhold.
1. Zum Projekt der Moderne gehörte das Programm, die kompakte Stadt durch die lockere Siedlung zu ersetzen. Für den durchschlagenden Erfolg dieses Programms hat eine Raumplanung gesorgt, die niedrige Baudichten und offene Bauweise zum Standard machte. Die lockere Siedlung verteilt frei stehende Bauten in der Landschaft, ersetzt die Stadt durch die Zwischenstadt: die durchgrünte Siedlung, nicht Stadt und nicht Land. In der Zwischenstadt steht der Städtebau auf verlorenem Posten. Die Architektur ist auf das einzelne Bauwerk beschränkt und von jener zweiten Aufgabe, auch Aussenräume zu definieren, entlastet. Der urbane Raum bleibt amorph, die klare Definition beschränkt sich auf die Verkehrsflächen. Ergebnis ist ein flächendeckender Siedlungsbrei, in dem die Regeln des Städtebaus dem Gesetz der wachsenden Entropie gewichen sind.
2. Die Raumplanung war nicht allein bei der Überwindung des Städtebaus. Sie konnte das Programm nur umsetzen, weil sie auch auf privater Seite offene Türen einrannte. Der Wunsch nach dem Eigenheim im Grünen bedeutet niedrige Baudichten und hohen Flächenverbrauch. Durch billigen Individualverkehr wurde dieser Luxus zu einem sozialen Standard. Auch das produzierende Gewerbe bevorzugte niedrige Baudichten, hoch maschinierte Produktionsstrassen wollen flexibel erweiterbar sein und eignen sich nicht zur geschossweisen Stapelung. Hier wie dort geht der Wunsch nach Ellenbogenfreiheit weiter als der Sinn für die Gemeinschaftsaufgabe eines kohärenten Städtebaus.
3. Selbst dort, wo Spielräume für das Gestalten im kollektiven Zusammenspiel gegeben sind, werden sie nicht genutzt. Der moderne Architekt versteht sich nicht als eingebundener Ensemblespieler, sondern als trotziger Einzelkämpfer gegen Konvention und Konformität. Sein Kampf richtet sich gegen eine Auffassung der Architektur, die auf andere Architekturen bezogen und auf deren Mitwirkung angewiesen ist, denn diese steht quer zu den für die Moderne so charakteristischen Individualisierungs- und Rationalisierungsansprüchen. Ist es also nicht einfach Wunschdenken, von solch einer gemeinschaftlichen Produktion zu träumen?
Der Städtebau als Kulturtechnik und hohe Kunst
Festzuhalten ist, dass die gemeinschaftliche Produktion all jenen städtebaulichen Glanzleistungen zugrunde liegt, auf die sich Europa so viel zugutehält. Die herrlichsten Plätze in Venedig und Siena, die schönsten Corsi in Rom und Florenz, die prächtigsten Boulevards in Paris und Barcelona sind alles andere als schiere Ansammlungen von Spitzenarchitektur. Überall gibt es da durchaus bescheidene Beiträge. Allerdings, und das ist entscheidend, spielen sie mit im Konzert und tragen das Ihre zu den Akkorden, Obertönen und Resonanzen bei, die das Spiel im Ensemble zuwege bringt. Sie verstehen es, trotz Mangel an Virtuosität, mitzuspielen, ohne zu patzen. Dafür dürfen sie sich im Glanz der Gemeinschaftsleistung sonnen.
Zu der bedeutenden Gemeinschaftsleistung ist es nicht gekommen, weil die Mitspieler von Egoisten zu Altruisten bekehrt worden wären. Die individuelle Vorteilsuche will darin gesucht werden, dass man zu einer Gemeinschaftsleistung beiträgt, die den eigenen Beitrag besser dastehen lässt, als er isoliert betrachtet wäre. Es gilt, eine Balance zwischen der Konkurrenz im Schönheitswettbewerb und der Kooperation im städtebaulichen Zuspiel zu finden. Es ist die Balance zwischen Konkurrenz und Kooperation, worum es in allen Arten des Mannschaftssports geht. Natürlich sind die Spieler im Team immer auch Konkurrenten, den Witz und den Reiz des Spiels macht es aber aus, dass die Konkurrenz die Kooperation nicht stören darf. Ganz dasselbe gilt für den Städtebau. Die Architektur im grösseren Massstab zu betreiben, heisst, die Architektur zu einem Teamsport zu machen.
Dieser Gewinn aus gutem Zuspiel ist keineswegs auf die Glanzleistungen des Städtebaus beschränkt. Er fällt überall an, wo es einem Ensemble von Architekturen gelingt, das Gut zu erspielen, das man gemeinhin eine «gute Adresse» nennt. Eine gute Adresse kann weder durch Rechtsplanung herbeizitiert noch dadurch hergestellt werden, dass eine individuelle Architektur die Architektur in ihrer Umgebung in den Schatten stellt. Sie entsteht vielmehr dann, wenn sich die individuellen Architekturen in der Gesellschaft anderer Architekturen zu benehmen wissen. Eine Adresse ist gut, wo der öffentliche Raum einladend, wo der Strassen- oder Platzraum wirtlich ist. Dies ist gerade nicht auf die Nobelquartiere beschränkt, sondern überall dort zu finden, wo sich die Bewohner und Benutzer mit ihrem Viertel identifizieren. Hier ist es denn auch ganz gewöhnliche, durchschnittliche Architektur, die den Ton angibt.
Kieze und Grätzel stellen die allgemein erschwingliche Form der guten Adresse dar.
Es sind die typischen Altbauquartiere, die den traditionell kompakten Typ der Stadt verkörpern.
Charakteristisch sind die klar definierten Strassen- und Platzräume mit geschlossenen Wänden. Die Wände werden von Geschossbauten in geschlossener Bauweise gebildet, deren Grundrisse ganz selbstverständlich nach der Strassenseite hin (statt nach der Himmelsrichtung) orientiert sind. Die Repräsentation bedient sich konventioneller Formensprachen, die es nahelegen, dass der Ausdruck der individuellen Architekturen in eine Konversation mit dem Kontext übergeht. So kam es, dass Bauweise und Formensprache einem Regelwerk folgten, das aus der Architektur tatsächlich so etwas wie einen Teamsport macht.
Programmierte Unwirtlichkeit der Städte
Die Moderne hat mit dieser Art Städtebau Schluss gemacht. Die soziale Orientierung zur Strassenseite hin wurde der Orientierung nach der Sonnenseite geopfert, die konventionellen Formensprachen wichen der Formengrammatik der abstrakten Architektur. Die Moderne hatte zwar Sinn für den Plan als grossen Wurf, aber keinen für das Gestalten im geregelt kollektiven Zusammenspiel. Statt des Spielers im Team hat die Moderne jenes Selbstbild des Architekten als heroischen Einzelkämpfer kultiviert.
Keinem der Avantgardisten der heroischen Frühzeit der Moderne wäre nun der Verdacht gekommen, seinem elitären Eigensinn könnte ein Massenerfolg winken. Dennoch war, als im Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit jene finale Welle der Massenproduktion an umbautem Raum anrollte, die abstrakte Moderne als neue Konvention der Architektur etabliert. Aus dem kapriziösen Einfall wurde die betonierte Realität der flächendeckenden Agglomeration.
Der Schrecken, mit dem diese Entgleisung zu Bewusstsein kam, erhielt einen sprechenden Namen. Er heisst seit Alexander Mitscherlichs Befund von 1965 «die Unwirtlichkeit unserer Städte». Die Städte sind in genau dem Sinn unwirtlich geworden, dass die Gemeinschaftsproduktion guter Adressen eingestellt wurde. Die Agglomeration hat sich verabschiedet vom Städtebau, der sich als Produktion guter Adressen versteht. Gute Adressen gedeihen nicht, wo Solitäre in undefinierten Resträumen herumstehen. Sie gedeihen, wie besonders wertvolle Früchte, nur unter besonderen Bedingungen: klar definierte Strassen- und Platzräume, die durch Schaufassaden gerahmt sind und Erdgeschosse mit publikumsorientierter Nutzung. Die Agglomeration bietet diese Bedingungen gerade nicht. Sie ist voll von Reihen und Stangen, die von Parkplätzen und Abstandsgrün umgeben sind. Es gibt keine klar definierten Strassen- und Platzräume, sondern nur klar demarkierte Verkehrsflächen. Das Bedürfnis nach Repräsentation ist tabuisiert, es sei denn, sie manifestiert sich ganz ungeniert als Werbung. Die publikumsorientierten Nutzungen finden sich in Shoppingcenter verbannt. Kurz: Der öffentliche Raum als Becken guter Adressen ist auf Quartiere eingeschränkt, die inzwischen älter als 80 Jahre sind.
Die Unwirtlichkeit unserer Städte bezieht sich leider nicht nur auf die ausufernden Neubaugebiete – sondern auch auf den Raubbau in den noch funktionierenden Altbaugebieten. Viele der einst bedeutenden Stadtbilder sind durch unpassende Implantate verhunzt. Zu oft hat sich inzwischen gezeigt, dass sich die zeitgenössische Architektur in der Gesellschaft älterer Architektur nicht zu benehmen weiss. Zu der mangelnden Sensibilität aufseiten der Architekten kommt ein schnödes Kalkül aufseiten der Bauherren hinzu. Das Bauen in guter Umgebung lädt nämlich dazu ein, das Becken zu nutzen, ohne selbst etwas zur Güte der Adresse beizutragen. Der Neubau kann auch im Windschatten segelnd die gute Adresse ernten. Wer scharf rechnet und auf schnellen Gewinn achtet, nutzt diese Situation aus. Wenn er Nachahmer findet, wird das Becken Zug um Zug ruiniert.
Natürlich ist der Zerfall des Städtebaus den Planern und Politikern nicht verborgen geblieben. Sie haben sich auch nicht aus der Verantwortung geschlichen.
So schien es nur logisch, die Misere der räumlichen Entwicklung in der Ohnmacht der Planung zu suchen.
Wenn die Planung überfordert ist, dann muss das daran liegen, dass das Instrumentarium der Rechtsplanung zu schwach ist – ergo muss es geschärft werden. Je schärfer aber die Regulierung, umso enger wird es für die architektonische Gestaltung und umso weniger werden sich die Architekten aufgerufen fühlen, von sich aus für den städtebaulichen Zusammenhang zu sorgen.
Der Niedergang des Städtebaus als Tragödien der urbanen Allmende
Der Ruin des urbanen Raums als Becken für den Anbau guter Adressen folgt einem bekannten Muster. Es ist nicht unähnlich, aber auch nicht gleich dem Muster, das die Kritik an der Bauspekulation und der kapitalistischen Verwertungslogik im Visier hat. Die gründerzeitlichen Stadterweiterungsgebiete belegen, dass der Städtebau trotz hochkapitalistischer Bauspekulation, profitorientierter Bauindustrie und Immobilienwirtschaft blühen kann.
Der Ruin des urbanen Raums folgt einer anderen Einladung, die von der Unteilbarkeit des Beckens ausgeht, in dem gute Adressen gedeihen. Die gute Adresse kann nur von den Anrainern des Strassen- oder Platzraums gemeinsam angebaut werden. So kann auch derjenige Anrainer vom Mitgenuss nicht ausgeschlossen werden, der nichts zu ihrer Produktion oder Erhaltung beiträgt. Existenzielle Grundlage des Städtebaus ist eine Art von Immunsystem, das dem perversen Anreiz Widerstand bietet, den Aufwand für die sorgfältige Einpassung des Neubaus in den umgebenden Bestand zu streichen.
Der traditionelle Städtebau verfügte über ein solches Immunsystem. Er konnte sich auf eine Konvention verlassen, die sich im Metier von selbst verstand. Es gehörte zum Metier des Architekten, zu wissen, wie sich eine Architektur in der Gesellschaft anderer Architektur zu verhalten hat, damit die Gesellschaft angenehm wird – ebenso erwarteten dies die Bauherren. Wohl versuchte eine jede, ein bisschen besser als die umstehenden dazustehen, keine machte aber Anstalten, aus der Reihe zu tanzen. Sie sprach eine ornamentale Sprache, die die Architekten durch das Studium historischer Vorbilder erlernen konnten. So war es auch durchschnittlich begabten Entwerfern vergönnt, eine gute Figur im Konversationsspiel der Architektur zu machen. Nur so ist es denn auch zu erklären, dass die erste Welle der industriellen Massenproduktion an umbautem Raum auf bemerkenswertem städtebaulichem Niveau bewältigt wurde. Die Stadterweiterungsgebiete des 19. Jahrhunderts gehören inzwischen zu den beliebtesten Wohnquartieren der Grossstädte.
Die Funktion von Konventionen, die sich einmal von selbst verstanden, wird erst so recht deutlich, wenn sie aufgehört haben zu funktionieren. Inzwischen sehen wir, dass der Städtebau bis 1930 über eine Kraft verfügte, die heute verloren ist. Dennoch hat es keinen Sinn, an die Wiederbelebung verblichener Konventionen zu denken. Wir wollen nicht zurück ins 19. Jahrhundert; und selbst wenn wir wollten, könnten wir das Regelwerk, das damals stillschweigend fungierte, nicht reaktivieren. Wir können nur einen Schritt weiter zurückgehen und versuchen, die Produktionsweise zu beschreiben, deren sich die kollektive Produktion städtebaulicher Qualität bedient. Gibt es da noch andere Beispiele der gemeinschaftlichen Produktion unteilbarer Güter – und vielleicht sogar solche, die immer noch funktionieren und in vivo studiert werden können?
Tatsächlich existiert eine Form der Gemeinschaftsproduktion gleichberechtigter Partner, die auf freiwilliger Basis eine ungeteilte Ressource bewirtschaften. Sie heisst Allmende und bezeichnet den Gemeinbesitz, den die Beteiligten kollektiv bewirtschaften. Sie stellt eine Form des Besitzes dar, der die klare Trennung zwischen öffentlich und privat noch nicht vollzogen hat. Sie ist aber nicht nur eine uralte Bewirtschaftungsform, sondern auch eine mit ganz eigenen Möglichkeiten. Sie erlaubt einer Gruppe, etwas herzustellen, das sowohl die Möglichkeiten zentraler Planung als auch die Kräfte der einzelnen Beteiligten übersteigt. Sie hat sich bewährt bei der Nutzung von Grundwasserbecken und Fischgründen, beim Betrieb von Bewässerungssystemen und bei der Nutzung von Almen und Hochwäldern. Allerdings entsprechen den Möglichkeiten, die die Mischform von privater und kollektiver Bewirtschaftung bietet, auch die erwähnten Risiken. Allmenden als Gemeinbesitz reizen zu typischen Formen des Trittbrettfahrens und Sichdrückens.
Diese Gefahren sind unter der Annahme, dass sich die Eigner wie «homines oeconomici» verhalten, tödlich. Daher wurde der Allmende in der modernen Theorie des Wirtschaftshandelns ein lautes Requiem gesungen. Dennoch ist die Produktionsweise nicht tot, sondern erfreut sich unerwarteter Aktualität. Die Stichwörter sind «creative commons», «open source» und «peer to peer production».
Aus der Aufbruchstimmung in der Frühzeit des Internets ging eine Szene von Pionieren hervor, die im unbeschränkt zugänglichen und unreglementiert nutzbaren Netz der Netze eine Art gelobten Lands jenseits der exklusiven Eigentumsrechte und der staatlichen Bevormundung erblickten. Sie entdeckten für sich die Vorzüge der gemeinschaftlichen, vom Profitdenken befreiten Produktion von Gütern, die sie Lust hatten herzustellen. Die Szene erwies sich als ausgesprochen kreativ. Es war daher nur schlüssig und an der Zeit, dass 2009 eine Wissenschaftlerin mit dem Nobelpreis für Ökonomie geehrt wurde, um sowohl empirisch als auch theoretisch die Rationalität und ganz besondere Leistungsfähigkeit der Commons zu ergründen. Elinor Olstroms «Governing the Commons» (1990) zeigt, dass es Fälle wie die genannten Fischgründe, Bewässerungssysteme und Almen gibt, die sich seit Jahrhunderten bewähren und die leisten, was weder zentrale Planung noch eine Privatisierung vermöchten.
Städtebau als Bau und Pflege von «urban commons»
Das strassen- und platzräumliche Becken guter Adressen zählt leider nicht zu den Fällen, die Olstrom analysiert. Zweifellos stellt es aber eine Allmende dar, denn die guten Adressen werden entweder von den Anrainern gemeinsam hergestellt oder sie kommen eben nicht zustande. So ist der Städtebau auch eine Art «peer to peer»-Produktion. Doch das Zusammenwirken der «peers» kommt nicht so leicht über das Gerempel von Einzelkämpfern hinaus, wenn es zu keiner Verständigung über die Art des Zusammenspiels kommt. Die Praxis der «free software production» hat herausgefunden, wie die Verständigung über den Modus des Zusammenspiels und die inhaltliche Zusammenarbeit auseinandergehalten werden können, ohne die Schritte von vornherein trennen zu müssen. Das Problem wird nicht zentral in Komponenten zerlegt, deren Lösung dann an einzelne Mitarbeiter delegiert wird. Vielmehr werden die Mitglieder eingeladen, Angebote zu Teillösungen in die Runde zu werfen, um dann im Sinn einer Synthese zur Lösung des komplexen Problems fortentwickelt zu werden. Umgekehrt gilt, dass Autoren ihre Arbeitsstände anderen, von deren Können sie sich etwas versprechen, zur Überarbeitung und Fortentwicklung weiterreichen können. So kommt es zur parallelen Entwicklung von Alternativen, die einerseits in einem Verhältnis der Konkurrenz stehen, andererseits uneingeschränkt kooperieren, da der Code sämtlicher Entwicklungslinien stets der gesamten «community» zur freien Verfügung steht. Welche Linie sich schliesslich durchsetzt, entscheidet die Gruppendynamik. Die Mitarbeit ist freiwillig und unentgeltlich. Die Belohnung besteht in dem schönen Gefühl, etwas zu einer bedeutenden Gemeinschaftsleistung beizutragen – und in der Anerkennung seitens derer, die von der Sache etwas verstehen.
Dasselbe Ethos, das die Produktion freier Software trägt, müssen Entwerfer entwickeln, wenn eine Ensembleleistung jenseits der Objektarchitektur gelingen soll. Dieses Ethos muss entwickelt und eingeübt werden. Mit dem grossen Wort einer Renaissance des Städtebaus ist daher zunächst einmal die Lehre der Architektur angesprochen. Aufseiten der Studenten ist das Interesse an der «open source»- und «peer to peer(p2p)»-Bewegung gross, leider hält die Lehre fest an der Auffassung der Architektur als einer solistischen Disziplin. Gleichwohl kann von einem gelungenen Experiment berichtet werden.
Entwerfen als Teamsport
Zu einer Probe aufs Exempel hat der Zürcher Direktor des Amts für Städtebau, Patrick Gmür, die Lehrstühle für Städtebau und digitale Methoden an der Technischen Universität Wien eingeladen (vgl. Kasten rechts). Zürich bekennt sich zum Leitbild der «walkable city» als dem Bild der nachhaltigen Stadt im Gegensatz zur flächenfressenden Agglomeration. Um die Möglichkeiten einer Nachverdichtung eines Stadtquartiers zu testen, wurde ein Gebiet in Zürich Altstetten ausgewählt. Mit der anzustrebenden Verdichtung sollte ein Städtebau einhergehen, der wieder urbane Räume gestaltet.
So verlangte die Nachverdichtung die Rehabilitation der Art von Architektur, die im Kollektiv Aussenräume definiert.
Die Ergebnisse dieses Lehrprojektes sprechen für sich: Es gelang der Nachweis, dass die Nachverdichtung im Mass, wie es der Umbau der Stadt zur «walkable city» anzeigt, im Rahmen des für Zürich charakteristischen Ortsbilds möglich ist. Es konnte sogar gezeigt werden, dass das moderne Zürich gewinnt, wenn es an seinen Rändern städtischen Charakter annimmt. Was das Experiment aber vor allen zeigt, ist, dass es nicht an der Unfähigkeit oder dem Desinteresse junger Architekten liegt, wenn die Architektur in Gesellschaft nicht als Spiel der Architekten im Ensemble gelehrt wird. Es hat auf Anhieb funktioniert, städtebauliche Entwürfe wie «open source»-Software herzustellen. Dass das nur ausnahmsweise geübt wird, liegt nicht an unwilligen oder überforderten Studierenden, sondern einzig am Lehrangebot der Architekturschulen.
Es nur eine Frage der Zeit ist, dass der Städtebau als Teamsport gelehrt wird. Entwerfen als Teamsport heisst, dass alle zwar individuell eine Objektarchitektur entwickeln, diese aber den Peers zur Beurteilung und Überarbeitung weiterreichen, um im Gesamtergebnis mit einer kohärenten Architektur im grösseren Massstab herauszukommen. Es liegt beim Team, zu welchen gestalterischen Mitteln es greift, um aus der Ansammlung von Einzelbauten ein stimmiges Ensemble zu machen. Es sollte wie beim guten Sport so sein, dass das Ergebnis nicht vorherzusehen, aber sehr wohl nachzuvollziehen ist.
Die «open source»-Produktion könnte von jungen Architekten als Chance aufgegriffen werden, um als Peers unter Peers etwas zu leisten, das sie aus eigner Kraft nicht so ohne Weiteres zuwege brächten.
Perspektiven für den Städtebau
Eine Renaissance des Städtebaus setzt freilich mehr voraus als die Initiative einzelner Gruppen. Auch die Raumplanung und die Kommunalpolitik müssen sich bewegen. Ein Anfang mit dem Städtebau als Teamsport sollte damit gemacht werden, dass eine neue Art von städtebaulichen Wettbewerben ausgelobt wird. Wettbewerbe nicht nur für Neubaugebiete und einzelne Situationen im Bestand, sondern mit Umgriffen eines ganzen Quartiers und im Massstab bis hinab zu 1 : 200. Weil Wettbewerbe dieses Umfangs zu teuer oder zu wenig lukrativ sind, sollten sie sich an Arbeitsgemeinschaften richten, die im Modus p2p zusammenarbeiten möchten. Von den Kommunen sollte ein Mustervertrag entwickelt werden, durch den sich die Arbeitsgemeinschaft formell als Allmende konstituiert.
Als nächsten Schritt geht es darum, einen Mustervertrag zu entwickeln, anhand dessen sich auch Gruppen interessierter Eigentümer und mithin Auftraggeber als Allmenden konstituieren können. Die Ausarbeitung einer solchen Verfassung wurde im Lehrexperiment durch die fiktive Annahme übersprungen, dass der Anreiz des höheren Baurechts die Gründung urbaner Allmenden hinreichend attraktiv macht. Tatsächlich liegt hier der harte Kern des Problems, vor dem der gemeinschaftliche Anbau guter Adressen steht. Bei der Gründung von urbanen Allmenden gilt es zunächst, vernünftige Umgriffe für die Planung zusammenzustellen: Ensembles mit geschlossenen Strassenzügen oder Platzsituationen. Jeder der Eigentümer im geeigneten Umgriff bekommt ein Vetorecht über das Projekt insgesamt, das er ausspielen kann, um Sonderrechte zu ertrotzen. So bekommt bereits der allererste Zusammenschluss mit jenen Anreizen zu tun, die es dem operativen Betrieb der Allmende schwer machen.
Damit ist von vornherein klar, dass eine Kooperative vom Typ «urban commons» nichts für Investoren ist, die den schnellen Profit im Sinn haben. Es gibt aber auch Eigentümer, die sehr wohl in Kategorien der Nachhaltigkeit denken und gute Adressen etablieren wollen. Es gibt solche, die an der ästhetischen Qualität nicht nur ihres Hauses, sondern der ganzen Nachbarschaft interessiert sind. Für solche Bauherren könnte die Allmende eine interessante Alternative zur Praxis der individuellen Architektenverträge werden.
Ob eine Wiederbelebung des Städtebaus als gemeinschaftlicher Produktion guter Adressen bloss Wunschvorstellung bleiben oder zu einer praktikablen Option werden wird, wird davon abhängen, ob es gelingen wird, für die urbane Allmende eine robuste Rechtsform zu entwickeln. An dieses Regelwerk knüpfen sich komplexe Anforderungen. All dies deutet auf ein umfangreiches Projekt hin, dessen Ziel bisher lediglich in groben Umrissen deutlich ist.
Das Warten auf die Mustersatzung ist allerdings kein Grund, auch mit dem Entwerfen im Modus von «open source» und «peer to peer» zu warten. Es ist leicht möglich, Architekten, die sich zu Allmenden zusammentun, als Teilnehmer städtebaulicher Ideenwettbewerbe zuzulassen und das Format solcher Wettbewerbe an die reicheren Möglichkeiten des «commonalen» Entwerfens anzupassen. Wettbewerbe dieser Art wären ein ausgezeichnetes Instrument vorausschauender Planung, um mit der nachhaltigen Stadt ernst zu machen. Die «walkable city» verspricht, ein verzwicktes und langfristiges Projekt zu werden, das noch ganz andere Strategien als die der gängigen Praxis des Städtebaus fordert. Eine dieser alternativen Strategien ist, dass sich die kommunale Stadtplanung und Entwicklungspolitik des Entwerfens im Modus von «open source» und «peer to peer» auch unabhängig davon bedient, ob es zur Bildung urbaner Allmenden im vollen Umfang des Begriffs kommt. Das Beispiel Zürich lädt zum Gebrauch dieser neuen Möglichkeit ein.TEC21, Fr., 2015.11.13
13. November 2015 Georg Franck