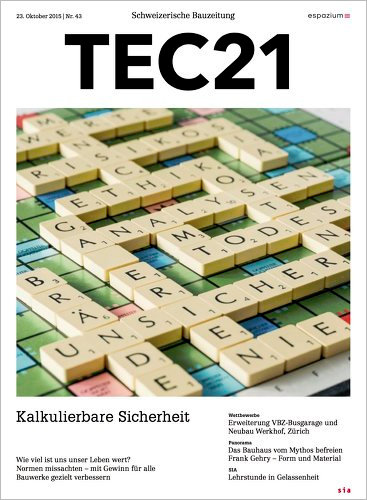Editorial
Als Reisende möchten wir sicher von A nach B gelangen, auch wenn die Fahrt durch einen Tunnel oder einen Lawinenhang mit seinen Schutzgalerien führt. Wir verlassen uns darauf, dass die, die verantwortlich sind für diese Infrastrukturbauten, alles unternommen haben, damit uns nichts passiert – und trotzdem geschehen Unfälle und Katastrophen. Bedeutet das, es gibt eine Obergrenze für Sicherheitsmassnahmen? Oder ist es einfach der Ausdruck dessen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses nie gleich null sein wird?
Die vielfältigsten Risiken begleiten uns täglich. Nur: Sind wir uns dessen bewusst? Dass wir diese Risiken laufend analysieren und bewerten, ist noch viel weniger wahrscheinlich – und doch tun wir es, wenn auch unbemerkt.
Wie all die Bauwerke zu planen und zu dimensionieren sind oder wie sie – nach den tragischen Erfahrungen mit mehreren Tunnelbränden vor ein paar Jahren – zu sanieren, zu verstärken und sicherer zu machen sind, ohne die begrenzten finanziellen Mittel zu überstrapazieren: Normen und Richtlinien geben die Werkzeuge dazu.
Neben dem SIA sind auch die Stellen des Bundes laufend daran, unsere Infrastrukturbauten den neuesten Erkenntnissen anzupassen: Soeben hat das Astra neue Richtlinien zur Tunnelsicherheit auf den Nationalstrassen erlassen.
Rudolf Heim