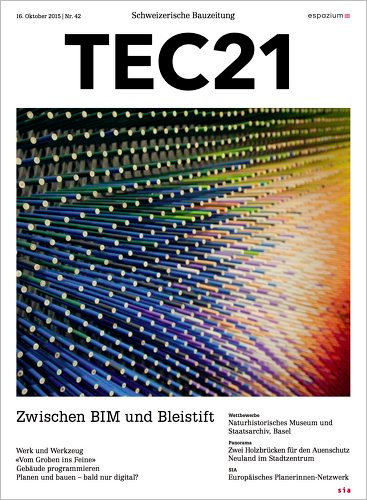Editorial
Kein Weg führt an BIM vorbei – meinen die euphorischen Befürworter dieser Methode mit Blick auf die Zukunft unserer Planungskultur. Fest steht jedenfalls: Wenn man sich damit beschäftigt, wie es aktuell um die Planungs- und Bauprozesse in der Schweiz steht, führt dies zwangsläufig dazu, dass man sich mit BIM auseinandersetzen muss. Doch ist BIM tatsächlich das lang ersehnte Allheilmittel, mit dem sich alle Probleme rund ums Bauen lösen lassen? Kaum ein Thema hat in den vergangenen Jahren die Gemüter so sehr erhitzt und ist gleichzeitig so kontrovers diskutiert worden (vgl. TEC21 45/2013). Klar ist, dass es zu BIM viele Fragen gibt, aber keine einfachen Antworten. BIM birgt Potenziale und stellt uns zugleich vor grosse Probleme. Doch es ist an der Zeit, statt einfältiger Schwarz-Weiss-Malerei differenzierte Töne zuzulassen. Daher stellt das vorliegende Heft unterschiedliche Positionen zur Diskussion.
BIM ersetzt weder ein kluges Konzept, das am Ausgangspunkt aller weiteren Prozesse steht, noch das Skizzieren mit Bleistift und Skizzenrolle oder gar ein konventionelles Architekturmodell. Dass Entwurf und Planung kein linearer Vorgang sind, stellt uns vor viele Herausforderungen beim Einsatz von BIM. Ausserdem braucht es intelligente Ansätze, um die zunehmend komplexer werdenden Datenmengen zu strukturieren.
Es will wohldurchdacht sein, für welche Aufgabe welches Werkzeug angemessen ist – und vor allem, wie und zu welchem Zeitpunkt es eingesetzt wird.
Susanne Frank
Inhalt
07 WETTBEWERBE
Mit der Vergangenheit in die Zukunft
12 PANORAMA
Ein Stück Schweizer Regenwald ist zurück | Zwei Holzbrücken für den Auenschutz | Neuland im Stadtzentrum
21 VITRINE
Neues aus der Bauindustrie
23 ERDBEBEN: UNVERÄNDERTE GEFÄHRDUNGSSITUATION
Europäisches Planerinnen-Netzwerk auf dem Weg | Tagung zur Bahnverbindung CEVA | Register für Spann- und Ankersysteme | Konferenz der europäischen Ingenieure | Nachhaltig im Tiefbau
27 VERANSTALTUNGEN
28 WERK UND WERKZEUG
Michael Drobnik, Steffen Riegas
BIM in der Architektur: über den Einsatz der Methode und die grosse Herausforderung, das jeweils passende Werkzeug zu wählen.
31 «VOM GROBEN INS FEINE»
Susanne Frank, Manfred Huber
Ein kritischer Austausch über BIM: Fragen und Antworten.
34 GEBÄUDE PROGRAMMIEREN
Volkmar Hovestadt
Digital planen, bauen und betreiben –was heisst das? Die Methode «Digitales Bauen».
37 PLANEN UND BAUEN – BALD NUR DIGITAL?
Sacha Menz
Die Digitalisierung verändert unsere Planungsprozesse. Welche Auswirkungen hat das auf unsere Baukultur?
39 STELLENINSERATE
45 IMPRESSUM
46 UNVORHERGESEHENES
Werk und Werkzeug
Wie verwenden Herzog & de Meuron das Instrument BIM? Zwei Mitarbeiter berichten von den Potenzialen und Herausforderungen dieser Methode. Parallel zur Planung mit BIM existieren weiterhin Skizzen, Zeichnungen und konventionelle Architekturmodelle. Es gilt, das jeweils passende Werkzeug zu wählen.
BIM ist bereits in unser Vokabular eingegangen, und dennoch ist oftmals keine Klarheit vorhanden, worum es sich bei Building Information Modeling genau handelt. Technologien kommen und gehen. Sie sind kurzzeitig in aller Munde, werden «gehyped», entwickeln sich weiter oder sind bald überholt. Noch vor wenigen Jahren waren uns Begriffe wie Smartphone oder Cloud-basierte Apps vollkommen fremd, während eine Vielzahl einst vieldiskutierter Technologien wie PDAs oder Zip Drives bereits wieder in Vergessenheit geraten sind. Der Name der Suchmaschine Google zum Beispiel hat sogar als Verb Einzug in unser kollektives Vokabular gefunden, und vielleicht besteht dort eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Begriff BIM, bei dem wir auch nicht klar und eindeutig erkennen, ob wir von einem Produkt, einem Werkzeug oder einer Methode sprechen sollten. Welche Potenziale und Konsequenzen stecken in diesen drei Buchstaben für die Arbeit eines Architekten?
Unsere Arbeitsweise soll und wird sich zwangsläufig immer mit den Technologien, die uns zur Verfügung stehen, mitentwickeln. Das ist ein Prozess, dem wir zugleich aufgeschlossen und kritisch gegenüberstehen müssen. Nicht so weit entfernt sind die Zeiten, als noch Blaupausen per Post versendet wurden. Seither können wir bereits auf eine jahrzehntelange Evolution der Methode CAD zurückblicken, in der das Zeichnen mit dem Computer als Werkzeug ganz neue Arbeitsweisen geschaffen hat.
Vielleicht ist es sinnvoll, die Wurzeln nicht nur im CAD und in der Planungsdokumentation zu suchen. Es wäre zu einfach, BIM lediglich als die nächste Generation nach CAD zu interpretieren. Da wir von Modellen sprechen, können wir auch Parallelen zum traditionellen Modellbau heranziehen. Modelle sind, ebenso wie Pläne, die Formulierungen von Absichten und die Übersetzung einer oder mehrerer Ideen in dreidimensionale Abstraktionen. Zugleich ist das Modellbauen ein Prozess, der die Konstruktion, das Fügen und die Abläufe auf der Baustelle viel nachvollziehbarer antizipiert als das Zeichnen. Beim Aufbauen eines Modells beschäftigt man sich ohne Umweg mit dem Kombinieren von Teilen. Das gilt für den klassischen Modellbau genauso wie für die Arbeit mit virtuellen Modellen am Computer.
Bei Herzog & de Meuron pflegen wir eine lange Tradition im Arbeiten mit Modellen, sowohl mit physischen Modellen als auch mit digitalen 3-D-Modellen. Dabei versuchen wir in beiden Fällen, Begriffe wie Arbeitsmodell und Präsentationsmodell zu unterscheiden, sodass auch ein digitales Gebäudemodell lebendiges Entwurfswerkzeug und Dokumentationsinstrument zugleich sein kann. Wir sind heute auf dem Weg von den geometrischen zu den informierten Modellen. Das ist hilfreich, wenn wir BIM zur Koordination aller Projektdaten einsetzen. Gleichzeitig benötigen wir aber auch Werkzeuge, die eine gewisse Ambivalenz zulassen und damit Interpretationsräume öffnen. In unserer Arbeit bewegen wir uns also im Spannungsfeld zwischen digitaler Skizze und Informationsmodell.
Das richtige Instrument finden
Aus Sicht des Digital Technologies Department bei Herzog & de Meuron stellt sich die Herausforderung, gemeinsam mit den Projektteams die jeweils idealen Werkzeuge zu wählen, die uns bei der Formulierung und Ausarbeitung einer architektonischen Idee am besten unterstützen. Das gilt nicht nur für den eigentlichen Entwurfsprozess und die architektonische Idee, sondern durchdringt alle Phasen und Bereiche, in denen wir als Architekten aktiv sind. Denn neben unserem Hauptanliegen, gute Architektur zu entwickeln, sind wir natürlich an der effizienten Bearbeitung unserer vertraglich geschuldeten Leistungen interessiert.
Das hat dazu geführt, dass wir BIM bereits seit Jahren aktiv untersuchen und einsetzen. Erfahrungen konnten wir vor allem durch die grosse Verschiedenartigkeit in den Konstellationen von Aufgabe, Ort, Vertrag, Rollen und Planungspartnern sammeln. Hinzu kommt die weltweite Verteilung unserer Projekte in Europa, Amerika und Asien und die Unterschiedlichkeit von Massstab und Typologie. So bedienen wir uns in den Projekten gezielt ausgesuchter Aspekte von BIM, denn in jedem sind die Aufgaben, denen wir uns stellen, vielschichtig. Sie reichen vom Entwurf über die Modellierung und Visualisierung, die Ermittlung von Massen und Kosten, die Koordination mit anderen Beteiligten bis zur Planung und Dokumentation der gebauten Projekte.
Sprünge zwischen den Massstäben
Wir müssen genau beurteilen, ob und wie wir jede dieser Untersuchungen führen werden, welche dieser Aufgaben in unserem Leistungs- und Verantwortungsbereich liegt und inwiefern wir Informationen mit unseren Planungspartnern austauschen müssen. Es gilt, das richtige oder notwendige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe einzusetzen.
Nicht immer ist das digitale Modell der beste Ort, um eine Untersuchung zu starten. Um einen Entwurf oder Teile davon zu entwickeln, existieren parallel Skizzen, Zeichnungen oder der Modellbau mit Papier und Schere als wichtige, teils überlegene Werkzeuge. Selbst bei der Auswahl einer Software gilt es, eine passende Entscheidung zu treffen. Die schnelle und präzise Untersuchung von Licht und Material anhand von Visualisierungen bedeutet für uns dementsprechend eine bestimmte Auswahl an Software.
Besonders das Testen und Evaluieren von Optionen zu abgegrenzten Themen fällt uns oft leichter, wenn man es aus dem Kontext eines BIM-Modells herauslöst.
BIM-Modell als Kollektor
Das zentrale BIM-Modell dient uns vielmehr als Kollektor, um einen fortlaufenden Stand der Planung abzubilden und zu koordinieren. Die Informationsweitergabe anhand von Modellen lässt uns Fragestellungen in Zusammenarbeit mit unseren Planungspartnern meist effizienter beantworten als durch den Austausch von Zeichnungen. Auf der anderen Seite sehen wir uns oft mit einer Methode konfrontiert, die von einem rein linearen Prozess auszugehen scheint, in der kontinuierlich der Grad der Ausarbeitung an der Konkretisierung von Informationen gemessen wird. Der Ausarbeitungsgrad einer Planung hing von jeher mit dem Massstab einer Zeichnung zusammen, doch eine Massstäblichkeit existiert in digitalen Modellen nicht mehr. Wie messen wir also die Tiefe der Planung? Und wie springen wir zwischen den verschiedenen Massstäben?
Das Diagramm oben links beschreibt einen idealisierten Prozess, in dem mit Voranschreiten des Projekts zunächst die grobe Geometrie modelliert, dann verfeinert und schliesslich mit immer mehr Informationen angereichert wird, bis letztlich eine virtuelle Kopie des real gebauten Objekts entsteht.
LOD 100 (Level of Development) bedeutet für ein Architekturmodell, dass die Geometrie und Anordnung der Räume bereits festgelegt ist. Erst in Folge werden die genauen Dimensionen von Bauteilen und die Materialisierung ausgearbeitet. Die Vereinbarung von LOD ist ein Instrument, um die Mindestanforderungen der Modelle eines jeden Beteiligten in einer Planungsphase abbilden zu können.
Planung als iterativer Prozess
Im Regelfall folgen unsere planerischen Überlegungen nicht immer diesem Schema. Im Gegenteil: Der Fokus und die Intensität der Untersuchung eines Designthemas werden je nach Projekt unterschiedlich gewichtet, und damit ist auch der Ausarbeitungsgrad innerhalb des Modells alles andere als kongruent (Abb. oben rechts). Ein Beispiel dafür sind Untersuchungen, die wir zur Materialisierung einer Fassade machen, lang bevor die Kubatur des Gebäudes festgelegt ist. Es gibt also Ausschnitte, die im Vorentwurf bis ins LOD 400 entwickelt sind, während andere Bereiche bewusst unbestimmt bleiben.
Wenn LOD 100 nun bedeutet, dass die Lage und Geometrie von Räumen bereits konkrete Form angenommen haben, wie benennen wir dann die Überlegungen, bei denen noch nicht klar ist, in welcher Form oder ob es einen Raum überhaupt gibt? Sollten wir nicht konsequenterweise in diesen Bereichen einen LOD «0» oder «minus 100» kommunizieren? Ebenfalls fällt es uns schwer, die Gleichzeitigkeit von grundlegend verschiedenen Optionen zu verfolgen, während BIM konzeptionell darauf abzielt, den einen koordinierten Stand des Modells zu beschreiben. Ein Gebäude zu entwickeln ist ein iterativer Prozess, bei dem ständig Möglichkeiten untersucht und wieder verworfen werden (Abb. unten). Mit welchem Werkzeug oder welcher Methode die einzelne Entscheidung im Prozess herbeigeführt wurde, ist für das Ergebnis an sich zweitrangig.
Potenziale für den Architekten
BIM zeigt seine Stärken als Koordinationswerkzeug, wenn alle notwendigen Daten im Modell zusammengetragen werden. Wertvoll wird diese Informationssammlung aber erst, wenn wir beginnen, sinnvolle Fragen an diese Modelle zu stellen. Das schliesst daher nicht aus, dass eine BIM-Software auch ein legitimes Werkzeug sein kann, um uns auch im Entwurfsprozess zu unterstützen. Zu hinterfragen ist lediglich, ob die Kategorisierung in Bauteile und deren Definition in Ausarbeitungsgrade unser Vorgehen beim Entwerfen korrekt abbilden können. Beim Arbeiten mit BIM tragen wir diesen «typologischen Rucksack», in dem manchmal mehr Ballast als Unterstützung steckt.
Betrachtet man die Erwartungen einer Bauherrschaft, also die Sicht des Bestellers, lässt sich meist erkennen, dass dahinter der Wunsch steckt, ein Instrument der Effizienzsteigerung und der Kostensicherheit gefunden zu haben. Der Blickwinkel auf das Thema ist entscheidend für die eigenen Forderungen an BIM. Die Perspektive des Architekten ist ebenfalls vielschichtig, denn unsere Aufgaben variieren je nach Aufgabe, Phase, Rolle oder Ort. Das Potenzial kann darin liegen, BIM nicht nur als ein mögliches Werkzeug für die geometrische und inhaltliche Vorabdefinition eines Gebäudes zu begreifen, sondern auch, um die eigenen Prozesse der Planung gezielt zu überdenken und weiterzuentwickeln. Die Unschärfe, die der Begriff BIM momentan noch hat, ist vielleicht eine Chance, bereits sehr alte Themen zusammen neu zu diskutieren.
Denn interessanter als die Frage, mit welcher Methode wir ein Dokument oder eine Zeichnung erstellen, ist die Feststellung, warum oder für wen wir dies überhaupt tun und ob die Information nicht schon bereits an anderer Stelle verfügbar wäre. Vielleicht ist es gerade ein Merkmal neuer Technologien, dass sie mehrfache Sichtweisen und Schwerpunkte erlauben oder sogar erfordern und wir keine simple Eindeutigkeit des Begriffs erlangen können. BIM ist schliesslich nicht ein Produkt. Es ist vielmehr ein Ansatz, der sich irgendwo zwischen Softwareprodukt und Unternehmenskultur bewegt. Um dieses Werkzeug zielsicher einsetzen zu können, müssen wir zunächst die Erfahrung in der Anwendung ausbauen und es handwerklich und inhaltlich pflegen. Die grosse Herausforderung liegt wie immer darin, für jeden Schritt in unserem Prozess das angemessene Werkzeug zwischen BIM und Bleistift zu wählen.TEC21, Fr., 2015.10.16
16. Oktober 2015 Michael Drobnik, Steffen Riegas
«Vom Groben ins Feine»
Wie sinnvoll ist BIM für Wettbewerbe? Geht die Optimierung der Verwaltung auf Kosten der Innovation? Wir wollen beitragen, eine differenzierte Sichtweise zu entwickeln. Dazu haben wir eine Reihe von kritischen Fragen zusammengestellt, die uns der Präsident der Kommission SIA 2051 BIM schriftlich beantwortet hat.
TEC21: Herr Huber, gibt es Defizite in den aktuellen Planungs- und Bauprozessen, die man mit einer neuen Methode (BIM) beheben muss?
Manfred Huber: Die Planungs- und Bauprozesse, wie sie im Modell Bauplanung SIA 112 beschrieben sind, haben sich aus einer langen Tradition entwickelt und sind bewährt. Die neuen digitalen Planungs- und Baumethoden helfen aber, diese bewährten Prozesse zu stützen und weiterzuentwickeln – gerade weil im Kern der Methode das Bauwerksmodell und die interdisziplinäre Zusammenarbeit stehen.
Vor welchem Hintergrund hat der SIA das Merkblatt SIA 2051 BIM erarbeitet? Warum ist ein spezifisches Merkblatt für die Schweiz notwendig?
Die digitalen Planungs- und Baumethoden haben sich in den vergangenen Jahren rasch entwickelt und haben auch in der Schweiz Einzug gehalten. Kaum ein grösserer Baugrubenaushub findet zum Beispiel heute ohne die GPS-Daten statt, die der Bauingenieur dem Tiefbauer respektive dem Baggerführer zur Verfügung stellt. Skandinavien, Grossbritannien, die USA und zahlreiche weitere Länder wenden diese digitalen Methoden nun schon seit mehreren Jahren an und zeigen auch deren grosses Potenzial auf. Schweizer Architekten und Planer, aber auch Bauherrschaften, wurden auf diese Methode aufmerksam und haben begonnen, sie ebenfalls anzuwenden. Der Bedarf an Verständigung ist augenscheinlich geworden. Die Schweiz könnte nun beginnen, BIM-Leitfäden aus dem Ausland eins zu eins zu übernehmen und anzuwenden. Das Planen und Bauen ist aber immer noch sehr stark von der lokalen Kultur geprägt. Eine Übernahme von bestehenden BIM-Leitfäden ist daher nicht zielführend. Dennoch können wir offensichtlich von den Erfahrungen anderer Länder lernen, indem wir schauen, was sich bewährt hat und was weniger. Es gilt dabei, die BIM-Methode auf die schweizerischen Verhältnisse zu adaptieren. Das Merkblatt SIA 2051 wird dies leisten und zur Verständigung der BIM-Methode in der Schweiz beitragen.
BIM verspricht Vorteile in den höheren Leistungsphasen, der Ausführungsplanung – und vor allem im Facility Management. So beeinflusst die Methode BIM, von einem späten Zeitpunkt der Planung aus gedacht, auch die entscheidenden ersten Planungsphasen: Konzeption und Entwurf. Hier stellen sich die meisten Fragen, zum Beispiel wie am Entwurf gearbeitet wird, wie flexibel eine Planung mit BIM ist und ob sich der Aufwand erhöht. Sollte man in der Strukturierung und Optimierung der Planungsprozesse nicht «von vorn nach hinten» denken? Ein Gebäude fängt doch beim Entwurf an?
Die Methode BIM zwingt uns Architekten und Planer gerade, wieder vom Groben ins Feine zu denken – etwas, das mit dem Übergang vom Tuschstift zum CAD verloren ging. Wie beim Planungsprozess üblich, sollten wir uns zuerst über das zu erreichende Ziel im Klaren sein, dann über die dafür nötigen Inhalte sprechen und am Schluss uns noch Gedanken machen, wie wir die Zielerreichung überprüfen können. Dies sollte selbstverständlich entlang der uns bekannten Phasen des Planungs- und Bauprozesses erfolgen. Wir müssen uns wieder vermehrt darauf konzentrieren, phasen- und adressatengerecht zu arbeiten. Gerade für die BIM-Methode ist das zwingend. Trial and Error, das klassische Prinzip des Entwerfens und Verwerfens, lässt sich sehr gut mit der BIM-Methode anwenden. Ziele formulieren, die richtigen Inhalte beigeben, prüfen und dann entscheiden – aber bitte phasen- und adressatengerecht. Es sind pro Planungsphase nur die Informationen ins Modell einzufügen, die für die Beantwortung entwurflicher Fragen hilfreich sind. Es gilt, dabei das Prinzip «so viel als nötig, aber so wenig als möglich» zu beachten. Richtig angewandt, ergänzt BIM die uns bekannten Entwurfswerkzeuge und stärkt damit den klassischen architektonischen und ingeniösen Entwurf.
Der Entwurf eines Gebäudes ist ein Prozess. Vor allem beim Wettbewerbsentwurf bewegt man sich, oft gleichzeitig, auf unterschiedlichen Massstabsebenen, vom Städtebau bis ins Gebäudedetail. In der konzeptionellen Phase haben sich dabei sehr unterschiedliche Werkzeuge bewährt. Wie sinnhaft ist BIM für Wettbewerbe?
Die Anwendung einer Methode darf nie Selbstzweck sein. Dies gilt gerade auch bei der Anwendung von BIM im Wettbewerbswesen. Auslober, aber auch Teilnehmer von Wettbewerben müssen sich im Klaren sein, was sie mit der Anwendung der BIM-Methode erreichen möchten. Es gilt auch hier, zuerst über das Ziel zu sprechen und dann über die Inhalte. Ist es das Ziel, Kenngrössen wie zum Beispiel «Hauptnutzfläche zu Geschossfläche» zu erhalten, oder die architektonische Wirkung zusätzlich im digitalen Modell zu prüfen, so ist BIM ein starkes Werkzeug, um den Entwurfsprozess zu unterstützen. Dies geschieht in der Phase Wettbewerb sinnvollerweise meist über reine Raummodelle, die nur die Informationen enthalten, die dafür wirklich nötig sind. Von BIM-Modellen, die unzählige, nicht phasengerechte Informationen enthalten, ist aber dringend abzuraten. BIM basiert auf dem Gedanken des Optimums und nicht des Maximums.
BIM geht von einer progressiven Vertiefung der Detaillierung aus (LOD 100 bis 500). Der architektonische Entwurf springt jedoch häufig vom Detail zum Gebäudevolumen und zurück. Wie wird der LOD innerhalb des Projekts koordiniert und von wem?
Die progressive Vertiefung der Detaillierung von grob zu fein ist ein bekanntes Prinzip aus dem Entwurf. Selbstverständlich gibt es eine Wechselwirkung von grob zu fein und umgekehrt. Die LOD sind nicht in Stein gemeisselt. Sie sind projektspezifisch zu vereinbaren und können sich innerhalb der jeweiligen Planungsphase zwischen den Disziplinen auch unterscheiden. Auch hier steht im Vordergrund, zu welchem Ziel die BIM-Methode eingesetzt wird. Zu Beginn eines Planungsprozesses verständigen sich die beteiligten Planer zusammen mit der Bauherrschaft über die Ziele und die dafür nötigen Inhalte und Informationstiefen – und zwar bezogen auf die jeweilige Phase. Im Hochbau ist es naheliegend, dass dies unter der Leitung des Architekten geschieht, der auch üblicherweise die Funktion eines Gesamtleiters innehat. Voraussetzung dafür ist, dass er die nötigen Kenntnisse bezüglich eines BIM-Prozesses hat. Das Merkblatt SIA 2051 BIM und die dazu parallel erscheinende Dokumentation kann ihm dabei als Hilfestellung dienen. Fehlen die nötigen Kenntnisse, so muss der Verantwortliche bezüglich des BIM-Wissens Verstärkung holen.
Die Schnittstellen mit den Fachplanern werden ins digitale Modell ausgelagert. Häufig entstehen innovative Lösungen jedoch an den Fachplanersitzungen, wenn alle an einem Tisch sitzen und miteinander diskutieren. Droht diese Kultur – die in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern ausgesprochen hoch ist – nicht zu verschwinden, wenn die Planer nur noch auf virtuelle Abstimmungen setzen? Geht die Optimierung der Verwaltung nicht auf Kosten der Innovation?
Schnittstellen können am digitalen Modell gelöst werden. Sie werden aber nicht durch das digitale Modell gelöst. Dies ist ein grosser Unterschied. Das Modell hilft, Schnittstellen zu erkennen, zu visualisieren und darüber zu sprechen. Die Lösungen müssen in interdisziplinären Workshops gefunden werden. Dabei diskutieren die Beteiligten gemeinsam die anstehenden Herausforderungen und entwickeln innovative Lösungen, und zwar real von Angesicht zu Angesicht und nicht in einem virtuellen Raum. Das digitale Modell unterstützt aber die Diskussion erheblich, indem es die Fragen sichtbar macht. In der BIM-Fachwelt spricht man von ICE(Integrated Concurrent Engineering)-Sessions. Eine Form der Zusammenarbeit, die in der Schweiz hoch entwickelt ist und mit den digitalen Modellen eine zusätzliche Stärkung erhält.
Es stellt sich auch die Frage, ob BIM für alle Bauvorhaben gleichermassen geeignet ist. Wäre es nicht sinnvoll, je nach Projekt und Rahmenbedingungen zu differenzieren, ob BIM für den spezifischen Fall die beste Methode ist – oder ob nicht ein anderer Weg praktikabler und daher vorzuziehen ist?
BIM als Methode, die digitale Bauwerksmodelle in einer interdisziplinären Zusammenarbeit nutzt, kann unabhängig von der jeweiligen Grösse und Objektart genutzt werden. Hingegen unterscheiden sich sehr wohl die Ziele der Anwendung der BIM-Methode von Projekt zu Projekt stark und damit auch der Umfang und die Tiefe der Informationen, die mit dem Modell verknüpft werden. Für einen einfachen Umbau eines Einfamilienhauses ist die Art und der Umfang der Informationen ganz anders gelagert als bei einem Spitalneubau, bei dem sogar in der Phase Bewirtschaftung das Facility Management an das digitale Gebäudemodell angeknüpft wird.TEC21, Fr., 2015.10.16
16. Oktober 2015 Susanne Frank