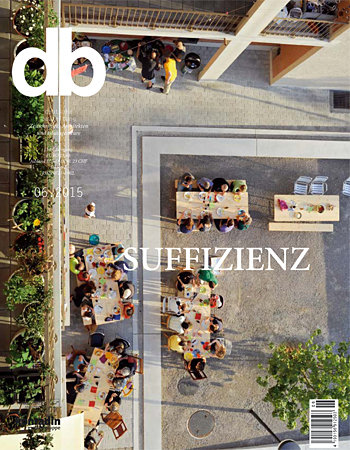Editorial
Etwa 10 000 Dinge besitzt ein Mensch in Deutschland im Schnitt und die Pro-Kopf-Wohnfläche ist laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung inzwischen auf durchschnittlich 45 m² angewachsen. Diogenes von Sinope, der Philosoph der Bedürfnislosigkeit, begnügte sich hingegen mit einer Tonne als Behausung und hatte lediglich einen Wunsch, als Alexander der Große vor ihm stand: Geh mir nur ein wenig aus der Sonne! Nun propagieren wir hier sicher nicht das Leben in einer Tonne, doch existieren ästhetisch überzeugende und gestalterisch anspruchsvolle Alternativen. Wohnmodelle, Arbeitswelten, Gewerbeeinheiten und Kleinstwohnungen, die intelligent, maßvoll und zurückhaltend mit Material und Fläche umgehen. Projekte, bei denen sich Bauherren und Architekten bereits vor Beginn des Planungsprozesses fragten: Wie viel Raum brauchen wir wirklich und wie können wir diesen optimal gestalten? Welche Bereiche und Funktionen können gemeinschaftlich genutzt werden, welche individuell? Was lässt sich vom Vorgefundenen erhalten, was wird sinnvoller Weise neu errichtet? Die aufgespürten und im Heft vorgestellten Projekte zeigen, wie suffizientes Bauen funktionieren kann und das, obwohl die meisten nicht unter dem Vorsatz des suffizienten Bauens entstanden sind. | Ulrike Kunkel
Einfach mehr
(SUBTITLE) Baugruppenprojekt R50 in Berlin-Kreuzberg
Effiziente Architektur und kostengünstiges Bauen zeichnen das Wohngebäude in der Berliner Ritterstraße 50 aus. Aber reicht ein niedriger Ausbaustandard und ein Mehr an Gemeinschaftsflächen, um einen Beitrag zur Suffizienz-Debatte zu leisten?
Ein kompakter, frei stehender Baukörper auf einem niedrigen Sockel und insgesamt sieben Geschosse gegliedert durch stählerne, umlaufende Balkonzonen vor einer hellen Holzfassade – das ist der erste Eindruck vor Ort. So ungewöhnlich wirkt das Projekt der Berliner Büros ifau und Jesko Fezer | HEIDE & VON BECKERATH nicht, als dass der Besucher hier neue Antworten auf Fragen nach der Zukunft des ressourcenschonenden Wohnungsbaus vermuten würde. Auf den zweiten Blick fällt jedoch auf, dass weder das Grundstück noch der Balkonumgang vor den Wohnungen fest markierte Grenzen haben. Privatheit scheint also weniger wichtig als Gemeinschaft und Begegnung. Außerdem fehlt die bei Neubauten immer noch übliche Tiefgarage und auch Materialwahl und Detaillierung erscheinen weniger prätentiös als bei anderen Neubauten in der Berliner Innenstadt.
Rohbau gleich Ausbau
»Robust angelegt und präzise detailliert«, so beschreibt Architekt Tim Heide beim Rundgang durch das Haus eine Idee des Entwurfskonzepts. Damit sollte zunächst kostengünstiger Wohnungsbau mit attraktiver Gestaltung verbunden werden. So legten die Planer gemeinsam mit den Bewohnern einen einheitlichen, niedrigen Ausbaustandard für das Gebäude fest. »Wir haben im Grunde überall die letzte Schicht weggelassen«, fasst Heide zusammen. Die Ästhetik der Wohnräume wird daher bestimmt von den rau wirkenden Oberflächen der Betondecken, des Kalksandsteinmauerwerks und des Heizestrichs im Kontrast zur warm wirkenden Kiefernholzfassade, die sowohl außen als auch innen Verwendung fand. Trotz des Verzichts auf den Glanz der Oberfläche wirken die Räume keineswegs »billig«. Einfach oder low tech, wie es Heide formuliert, trifft es tatsächlich ziemlich genau. Die Baukosten waren mit 2 150 Euro/m² tatsächlich sehr niedrig und senkten damit die Schwelle zum Eigentumserwerb deutlich. Aber bewirkt finanzielle auch ökologische Entlastung?
Geringere Wohnfläche effizient organisiert
Weniger Materialeinsatz, der auch mit einem schlanken Stahlbetonskelett und einer minimierten Stützenanzahl erreicht wurde, ist sicherlich ein wesentlicher Beitrag zur Ressourcenschonung, wenn auch nur schwer zu quantifizieren. Leichter zu bestimmen ist dagegen der Effekt, den die Größe der pro Kopf in Anspruch genommenen Wohnfläche auf den Ressourcenverbrauch hat. Eine Verringerung dieser Fläche ist tatsächlich einer der »Big Points« der Suffizienz im Haushalt, so das Freiburger Öko-Institut im Jahr 2013. In der Ritterstraße 50 sind im Verlauf der Planung 19 Wohnungen mit einer Größe von 80 bis 130 m² sowie ein kleineres Studio aus den zunächst drei Regelgrundrissen und einem optionalen Gemeinschaftsraum pro Etage entstanden, insgesamt 2 130 m² Wohnfläche für 62 Bewohner. Damit liegt die pro Kopf in Anspruch genommene Wohnfläche mit 34 m² ca. 20 % unter dem Berliner Durchschnitt – ein deutlicher Beitrag des Projekts zur dauerhaften Umweltentlastung und eine seltene Ausnahme vom immer noch anhaltenden Trend zu mehr Flächenverbrauch.
Eine der Voraussetzungen, um mit weniger Raum auszukommen – eine effiziente Nutzung der Wohnungen – ist hier im aufwendigen Planungsverfahren von Architekten und Nutzern gemeinsam erarbeitet worden. Dazu befragten die Architekten die zukünftigen Bewohner detailliert zu ihren Wohnbedürfnissen, diskutierten diese mit ihnen und entwickelten anschließend individuell maßgeschneiderte Grundrisse. Aufgrund der nicht-tragenden Innenwände können die Räume sich auch zukünftig wandelnden Lebensumständen anpassen und selbst Teilungen in zwei kleinere Apartments sind bei den Wohnungen auf der Nordseite möglich.
Temporär und gemeinsam genutzt
»Eine zweite Voraussetzung für ein Weniger an privater Wohnfläche wäre ein Mehr an gemeinsam genutzten Räumen«, führt Susanne Heiß, Architektin und selbst Bewohnerin, im Gespräch über das Gebäude aus. Anders als zunächst konzipiert, fielen zwar nach Diskussion in der Baugruppe die optionalen Gemeinschaftsräume auf den Etagen weg. Diese Flächen werden jedoch fast vollständig durch den 130 m² großen Gemeinschaftsraum im EG kompensiert, für den wiederum eine Wohnung aufgegeben wurde. Damit gibt es bei diesem Projekt deutlich mehr gemeinschaftlich genutzte Flächen als bei vergleichbaren Baugruppen, insgesamt ungefähr 20 m² pro Wohnung. Dazu zählt nicht nur der 70 cm breite, durchlaufende Umgang vor den Wohnungen, sondern auch eine Dachterrasse, Waschküche und Holzwerkstatt, der doppelgeschossige Raum im EG und nicht zuletzt der große Garten. »Das sei schon ein gewisser Luxus«, so Susanne Heiß weiter. V. a. die Kinder nutzen Umgang und Garten intensiv zum gemeinsamen Spielen und man könne sich leichter treffen, schneller seine Nachbarn besuchen. Außerdem wäre gerade der große Gemeinschaftsraum für verschiedene flexible Nutzungen gut geeignet – als temporäres Gästezimmer, zum gemeinsamen Kochen, Feiern oder Spielen. »Key Points« der Suffizienz nennt das Öko-Institut solche Änderungen des Lebensstils, die eine möglichst große gesellschaftliche Umgestaltung in Richtung Nachhaltigkeit anstoßen können. Einen Einstellungswandel hin zu mehr gemeinschaftlich genutzten Flächen kann die Baugruppe in der Ritterstraße 50 tatsächlich befördern, auch wenn längst nicht alle Ideen der Planer dahingehend aufgingen. So verzichten nur acht der zwanzig Eigentümer auf die Waschmaschine in der Wohnung und bevorzugen die gemeinsame Waschküche.
Vernetzung mit der Nachbarschaft
Auch in größerem Rahmen zeigt dieses Projekt Möglichkeiten, aber auch Grenzen gemeinsamer Nutzungen auf. So wird der Gemeinschaftsraum im EG neben den Bewohnern auch sozialen Initiativen zur Verfügung gestellt. Zweimal wöchentlich findet dort zurzeit eine Hausaufgabenhilfe statt. Das Gebäude leistet somit einen aktiven, kommunikativen Beitrag im Quartier. Der Garten, dessen Grenzen nur teilweise und auch nur weich durch Heckenpflanzungen markiert sind, soll den Nachbarn offen stehen und ist dennoch Teil des gemeinschaftlichen Raums der Baugruppe. Im Moment nutzen dieses Angebot v. a. Nachbarskinder zum Spielen und zwar so gut, dass die Kinder der Baugruppe sich schon beschwert haben, wie Susanne Heiß lachend anmerkt. Auch die Erdgeschosswohnungen wünschten sich mittlerweile ein wenig mehr Privatheit. Daher überlege man jetzt, den Freiraum durch Pflanzungen stärker in privatere und öffentlichere Flächen zu gliedern.
Auch städtebaulich ist Vernetzung das Freiraumthema. Die heterogene Bebauung der Umgebung – vom aufgelockerten Siedlungsbau der 50er Jahre bis hin zur Rekonstruktion des Berliner Blockrands in den späten 80er Jahren – wird über das neue Gebäude und den großen umgebenden Garten locker miteinander verknüpft. Einen Entlastungseffekt für die Umwelt bewirkt dabei die reduzierte Grundfläche des Gebäudes. Die Anlage einer großen Fahrradabstellfläche anstelle von Pkw-Stellplätzen ist dagegen ein fast schon selbstverständlicher Ausdruck eines bereits erfolgten Einstellungswandels.
Welche Maßnahmen suffizientes Bauen ermöglichen, wird bei R50 insgesamt sehr deutlich. Mit der intensiven Nutzerbeteiligung wurde eine optimierte, nutzerspezifische Grundrissplanung und ein großer Konsens über Gemeinschaftsnutzungen möglich. Dieser Umstand und die überdurchschnittlich großen Gemeinschaftsflächen ermöglichten hier tatsächlich geringere Wohnflächen ohne Qualitätseinbußen bei der Nutzung.
Andere Entscheidungen wie die für Eigentumswohnungen oder für die Ausführung des großen Gemeinschaftsraums außerhalb der energieeffizienten Gebäudehülle erscheinen in Hinblick auf Suffizienz ambivalent. Formen des gemeinschaftlichen Eigentums wie Genossenschaften oder das Modell des Mietshäuser-Syndikats wären vermutlich noch besser geeignet, um auch in Zukunft einen Konsens in der Hausgemeinschaft über umweltentlastende Veränderungen in Nutzung und Architektur zu finden. Das Genossenschaftsmodell wurde anfangs auch favorisiert, scheiterte jedoch an der zu geringen Größe des Projekts und der fehlenden öffentlichen Förderung. Und die weniger aufwendige Ausführung der Glasfassaden des Gemeinschaftsraums half zwar Baukosten zu sparen, erfordert jedoch ein dauerhaft diszipliniertes Heizverhalten, um nicht überdurchschnittlich viel Heizenergie zu verbrauchen. Bei allen Optimierungsmöglichkeiten ist das Baugruppenprojekt R50 dennoch ein sehr gutes Beispiel für einen nachhaltigeren Lebensstil und mehr Suffizienz in der Architektur.db, Mo., 2015.06.01
01. Juni 2015 Carsten Sauerbrei
Demut vor Omamas Mobiliar
(SUBTITLE) magdas Hotel Caritas in Wien (A
Das »magdas hotel« im Wiener Prater ist eine Oase abseits von Konsumsucht und ethnischen Vorurteilen. Das Social-Business-Projekt der Caritas ist ein Experiment, bei dem Touristen und Asylbewerber unter einem Dach wohnen. Die Architektur von AllesWirdGut orientiert sich an diesem ungewöhnlichen Programm und tischt dem Besucher so manchen Grund zum Schmunzeln auf. Der Luxus dieses Hauses liegt im neuen Blick auf alte Dinge.
Die Wände in den Korridoren erinnern an Omamas Wohnsalon. Auf taubenblauem Hintergrund hat ein Maler mit weiß-grauer Farbwalze propellerartige, längst vergessene Ornamente aufgebracht. Auch in den Zimmern dieses offiziell mit null Sternen ausgezeichneten Hotels taucht so manches Déjà-vu aus alten Tagen auf. Da steht eine alte Stehleuchte mit Stoffbespannung, da werden Opas Koffer zu einem Nachtkästchen voller Historie gestapelt, da scheint ein halber, ganz offensichtlich überlackierter Holzstuhl aus der Wand zu wachsen. Eine Ablage? Vielleicht.
»Das ist genau diese Art von Hotel, die man immer sucht und niemals findet«, sagt ein Ehepaar aus Deutschland. »Es gibt hier so viele schöne Details zu entdecken! In Wien waren wir schon öfter, aber nachdem wir von diesem Haus gehört haben, dachten wir uns, es sei wieder mal an der Zeit, die Stadt aus einem ganz neuen Blickwinkel kennenzulernen.« Im magdas, nur wenige Gehminuten vom Riesenrad entfernt, ist diese neue Perspektive garantiert. Und zwar nicht nur auf eine unkonventionelle und freche Hotellerie, sondern auch auf einen neuen Umgang mit baulichen, finanziellen und nicht zuletzt kulturellen Ressourcen.
Das magdas, der Name leitet sich von »ich mag das« ab, ist kein alltägliches Hotel. Es ist ein Social-Business-Projekt der römisch-katholischen Hilfsorganisation Caritas Österreich. An der Rezeption und in der Küche steht kein jahrelang ausgebildeten und auf aalglatt getrimmtes Personal, sondern Flüchtlinge und Asylbewerber aus insgesamt 16 Ländern. »Hier bekommen die Menschen die Chance, nach vielen Jahren im Wartezimmer des Lebens, ohne Job und ohne Aussichten, eine neue Aufgabe wahrzunehmen und sich für den Arbeitsmarkt zu wappnen«, sagt Michael Landau, Präsident von Caritas Österreich. »Unsere Vision ist, dass das Hotel ein Ort der Begegnung wird, an dem Vorurteile abgebaut werden.« Nationalflaggen von Algerien, Afghanistan, Guinea-Bissau, Syrien, Somalia, Iran und Irak, die im Treppenhaus und an den Balkonbrüstungen hängen, machen das ungewöhnliche Programm manifest.
Ein früher oder später zufälliges Gespräch zwischen Tourist und Asylbewerber scheint hier fast unausweichlich, denn man begegnet einander nicht nur an der Rezeption, man wohnt auch Tür an Tür: Der südliche Bauteil dieses ehemaligen Seniorenheims, das in den 60er Jahren errichtet wurde, steht den Mitarbeitern zur Verfügung, in den anderen beiden Trakten befinden sich die Zimmer und die Einrichtungen für die Gäste. 78 Zimmer gibt es insgesamt. Die Übernachtungspreise liegen zwischen 60 und 110 Euro. Für die Honeymoon-Suite im 4. OG mit Blick auf den Prater muss man etwas tiefer in die Tasche greifen – es ist für einen gleich mehrfach guten Zweck.
Die außergewöhnlichen Eckdaten dieses Projekts schlagen sich auch auf die Gestaltung nieder. Dem Wiener Architekturbüro AllesWirdGut (awg) ist es gelungen, die im Trend liegenden Ansätze Vintage und Recycling nicht nur als pseudo-soziales Feigenblatt zu interpretieren, wie dies allzu oft der Fall ist, sondern als ökonomische Notwendigkeit – und auch als Fundgrube für eine neue Form der Ästhetik. Sie animiert zu einer gewissen Demut.
»Das war ein außergewöhnliches Projekt, mit dem man als Architekt nicht alle Tage konfrontiert wird« sagt Herwig Spiegl, Generalplaner bei awg. »Wir mussten viel improvisieren und mit dem arbeiten, was da ist. Gelandet sind wir schließlich bei einem ziemlich wilden, aber doch stimmigen Stilmix aus Mid-Century, was zu diesem Haus sehr gut passt. Das ist weitaus nachhaltiger als der ganze modische Deko-Kitsch, den man in urbanen Hotels heute meist vorfindet.« Zu den alten Resopalmöbeln gesellen sich Stühle, Tische, Schränke und Betten aus dem Caritas-Archiv. Ein Teil der Einrichtung wurde privat gespendet. Und bei so manchem Möbelstück – wie etwa bei der alten Stahlgitter-Garderobe, die nun als skulpturales Betthaupt herhalten darf – erkennt man, welch riesiges Universum sich hinter der Idee des Upcycling auftut.
»Mit dem schonenden Umgang der Ressourcen haben wir einerseits das Budget reduzieren können, andererseits zeigen wir den Besucherinnen und Besuchern, welche Möglichkeiten es gibt, Altes und Vorhandenes wiederzuverwenden«, erklärt Projektleiterin Johanna Aufner. In gewisser Weise ist das magdas ein Appell an uns alle, uns unserer eigenen sozialen Verantwortung bewusst zu werden und ein Stückchen weit den Konsum zu unterbrechen und den Lebenszyklus der Gegenstände zu nutzen. Das Investitionsvolumen für die Revitalisierung des Hotels beläuft sich auf 1,5 Mio. Euro. Die Möbel und Einrichtungsgegenstände schlagen mit gerademal 10 bis 15 % der Gesamtkosten zu Buche. Von so einem niedrigen Anteil können andere Hotelbetreiber nur träumen.
Zahlreiche Details, die zum Schmunzeln anregen, lassen sich bei einem Rundgang entdecken. Viele davon sind quasi Null-Euro-Maßnahmen. So etwa die witzig gestalteten Piktogramme und Orientierungshinweise der Wiener Grafikagentur We Make. Schwarze Strichzeichnungen auf weißer Wand weisen einem den Weg zum Humor. Oder etwa die künstlerische Gestaltung der Suiten, in denen Studierende der Akademie der Bildenden Künste die Wandoberflächen als Leinwand nutzten. Auch die hölzerne Terrasse mit Tulpen- und Zwiebelbeeten, gestaltet nach einem Konzept von 3:0 Landschaftsarchitektur, überrascht als robust gezimmertes Langzeit-Provisorium. Wenig Geld, viel Nutzen. Das ist übrigens auch das Motto für die mittels Crowdfunding finanzierte Verschönerung des außen kaum veränderten 60er-Jahre-Hauses: Die beiden Künstler Marc Werner und Christian Gattringer laden die Hotelgäste dazu ein, quadratische Kupferplatten zu erwerben und die Loggien und Balkone auf diese Weise Stück für Stück zu veredeln. Architektur und Engagement gehen hier Hand in Hand.
Das magdas hotel ist ein temporäres Zwischennutzungsprojekt, anberaumt für fünf Jahre. Danach soll das Haus einem modernen Bau für pflegebedürftige Senioren weichen. Ob das wirklich der Fall sein wird? »Schauen wir mal«, sagt José Rodas, der Rezeptionist aus Kolumbien.db, Mo., 2015.06.01
01. Juni 2015 Wojciech Czaja
verknüpfte Bauwerke
HOP - magdas Hotel
Der Charme des Rationalen
(SUBTITLE) Gewerbehaus »Nœrd« in Zürich-Oerlikon (CH)
Das Gewerbe verlässt die Stadt, weil die Rendite von Gewerbeimmobilien für Investoren unattraktiv ist. Dass es auch anders geht, beweist das Gewerbehaus »Nœrd« in Zürich-Oerlikon. Architekten, Mieter, Totalunternehmer und ein Beratungsunternehmen der Immobilienbranche haben Hand in Hand ein Projekt realisiert, das architektonisch bemerkenswert und dabei kostengünstig ist – und sich zudem dem Suffizienz-Gedanken auf einer komplexen Ebene verpflichtet zeigt.
Das positive Image, das Zürich genießt, verdankt die Stadt schwerlich den Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen. Sondern denen, die heute gerne als »Kreativbranche« bezeichnet werden: den Künstlern, Architekten, Werbern, Grafikern, Modedesignern und Musikern. Viele von ihnen arbeiten als Ein-Personen-Betrieb im geteilten Atelier, einigen gelingt der große Durchbruch. Kaum eine Karriere ist bilderbuchreifer als die der Brüder Markus und Daniel Freitag, die in den frühen 90er Jahre einen »Messengerbag« aus gebrauchten Lastwagenplanen, Fahrradreifen und Autogurten erfanden. Das Accessoire, ebenso hip (urban und mobil) wie korrekt (Recycling) avancierte binnen kurzer Zeit zum globalen Trendartikel, der aufgrund der stets unterschiedlichen Planenfarben und -aufschriften dem Individualisierungswunsch entgegenkommt, ohne jedoch die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv zu ignorieren. 1993 hatten die Freitags ihr Unternehmen gegründet, und bald schon übersiedelten sie in das Quartier Zürich-West.
Gewerbe zurück in die Stadt
Doch die Transformation von Zürich-West forderte ihren Tribut: Für Gewerbe war einige Jahre später kein Platz mehr, und die Suche nach einer alten Industriehalle, die sich hätte umnutzen lassen, erwies sich als ergebnislos. Weil sie aber Zürich nicht verlassen wollten und der Bau einer Gewerbehalle irgendwo an der Peripherie keine Option darstellte, nahmen sie Kontakt zu Martin Hofer vom Immobilienberatungsunternehmen Wüest und Partner auf. Hofer war die treibende Kraft hinter einer Idee, die in boomenden Metropolen gemeinhin nicht als realistisch gilt: eine Gewerbehalle im städtischen Kontext neu zu errichten – und das zu Mietpreisen, welche die eines umgenutzten Altbaus nicht übersteigen.
Dass das Projekt gelang, ist das Verdienst aller Beteiligten – zu nennen sind auch Senn BPM als Totalunternehmer sowie der Architekt Beat Rothen, der in den letzten Jahren gerade im Bereich des Wohnungsbaus bewiesen hat, dass selbst in der Schweiz günstiger gebaut werden kann als gemeinhin angenommen.
Nœrd heißt das an der Binzmühlestraße entstandene »Gewerbegebäude der anderen Art«, wie es seine Erfinder nennen. Der vielleicht ein wenig allzu zeitgeistige Name ist indes nicht Resultat einer teuer bezahlten Brandingkampagne, sondern wurde von den Mietern selbst erfunden: Es handelt sich um eine Anspielung auf den Stadtteil Neu-Oerlikon, den Norden von Zürich und natürlich den Nerd. Und die abends leuchtenden, aus Neonröhren zusammengesetzten Buchstaben sind die einzige weithin sichtbare Schrift an der Fassade. Wer hier einzieht, und das sind neben den Ankermietern, der Freitag lab.ag und der Eventagentur Aroma, eine Reihe von kleinen Unternehmen, muss sich auf die Platzierung eines äußerst diskreten Schriftzugs an der Fassade beschränken. Ziel war ganz bewusst kein ikonisches, sondern ein generisches Bauwerk. Weil Freitag und Aroma bei der Planung von Anfang an dabei waren, ist das Gebäude zwar maßgeschneidert für deren Bedürfnisse – aber zugleich so flexibel, dass es problemlos an die Ansprüche weiterer und anderer Nutzer angepasst werden kann.
Flexibilität und Einfachheit
Das architektonische Konzept, das Beat Rothen entwickelte, basiert auf der Idee eines kompakten Volumens mit einer einfachen Tragstruktur. Eine 7 m hohe Fabrikationshalle mit Oberlichtern wird auf allen Seiten von Büro- und Dienstleistungstrakten umfasst, die oberhalb des Hallendachs, also in den oberen beiden Geschossen, in mäandrierender doppelter U-Form auf die gemeinsame und bepflanzte Dachterrasse ausgreifen. Das statische Konzept ist auf ein Minimum reduziert. Pro Fassade gibt es lediglich einen Erschließungskern. Die vier Kerne, die auch zugleich die Zugänge aufnehmen, dienen der Aussteifung einer modularen Struktur mit einem Stützenraster von 8,1 m. Diese Spannweite erlaubt eine möglichst flexible Bespielung der Räume und zudem die Nutzung von Flachdecken aus Beton; lediglich in bestimmten Bereichen der Halle erforderte eine doppelte Spannweite die Integration von Unterzügen.
Statik, Installation und Fassade sind unabhängig voneinander konzipiert, sodass auf die unterschiedliche Lebensdauer reagiert werden kann. Dabei wurde die Gebäudetechnik als üblicherweise kostentreibender Faktor ebenfalls minimiert. Die Schächte wurden indes so großzügig dimensioniert, dass eine bedarfsorientierte Nachrüstung für einzelne Mieter problemlos möglich ist. Vermietet werden die Flächen im Rohbau, wobei viele der Nutzer sich für die von Beat Rothen vorgesehenen Trennwandsysteme entschieden haben. Insgesamt wurde auf nachhaltige und einfache, nicht hybride und damit recycelbare Baustoffe geachtet: Bei der Struktur kam bis auf die tragenden Stützen Recyclingbeton zum Einsatz, an den als Holzkonstruktion ausgeführten Fassaden Mineralfaserplatten und Holzfenster. Metallarbeiten wurden in gelb chromatiertem Blech ausgeführt, Brüstungen in Maschendraht. Wie alles ineinandergreift, zeigt sich beispielsweise an den umlaufenden Balkonen. Sie fungieren einerseits als Außenräume und Putzbalkone für die Mieter und andererseits als Wetterschutz für die Fassaden. Alle Fenster lassen sich manuell öffnen und sind nicht mit einer Steuerungselektronik versehen. Wer ins Nœrd zieht, sollte ein Mindestmaß an Verantwortlichkeit mitbringen. Logischerweise verzichtete man auch auf eine Minergie-Zertifizierung, die hohe Investitionskosten nach sich zieht und gesellschaftliche, ökonomische und Standortfragen sowie deren Auswirkungen nicht berücksichtigt. Im Sinne des Suffizienzgedankens liegt dem Projekt ein ganzheitliches Denken zugrunde, das verschiedene Faktoren umfasst, so die Begrenzung der benötigten Nutzfläche dank einer effizienten Gebäudeorganisation, die Verwendung einfacher und recycelbarer Baumaterialien, die Minimierung der Haustechnik, nicht zuletzt aber auch die soziale Interaktion zwischen den unterschiedlichen Mietern, in der auch für externe Besucher geöffneten Dachkantine. Geheizt wird mit der Abwärme der nahen Kehrichtverbrennungsanlage, für das Waschen der Lkw-Planen wird das auf dem Dach gesammelte Regenwasser eingesetzt.
Gemeinsam planen
Gewerbebauten gelten für viele Investoren als unattraktiv, da sie aufgrund der geringeren Wertschöpfung pro Quadratmeter auch weniger Rendite abwerfen als Büro- oder Wohnimmobilien. Das führt dazu, dass das Gewerbe aus der Stadt gedrängt wird, was nicht nur zu funktionaler Entmischung führt, sondern auch zu verstärkten Pendlerbewegungen. Nœrd ist ein Glücksfall, weil es beweist, dass es auch anders geht. Neu-Oerlikon, einst als Sitz der Schwerindustrie ein fast unzugänglicher Stadtteil, wurde seit den späten 80er Jahren zu einem im Wesentlichen Wohnquartier transformiert, wobei Grundeigentümer, Stadt und Kanton im Zuge eines für die Schweiz pionierhaften »kooperativen Planungsverfahrens« zusammen agierten. Das wurde im Großen und Ganzen zum Erfolg, wenn auch die monofunktionale Ausrichtung auf das Wohnen nicht die erhoffte urbane Lebendigkeit hat entstehen lassen. Dass mit Nœrd nun auch neues Gewerbe eingezogen ist, darf als positives Zeichen gewertet werden. Entscheidend für das Zustandekommen war allerdings nicht nur das architektonische Konzept, sondern auch die Tatsache, dass die Ankermieter nach einer langfristigen Lösung suchten. Weil damit ständige Mieterwechsel, wie sie für Büroimmobilien typisch sind, nicht zu erwarten standen, wurde die Bruttorendite von 6 % auch für Investoren interessant, zumal für Büroflächen eine Sättigung in der Stadt Zürich erreicht ist. Außerdem waren die Erwerbskosten für das Land niedrig, weil der Totalunternehmer die Altlastensanierung übernahm. Was von Nœrd folglich zu lernen ist: Nichts hier ist Hexerei, es handelt sich auch nicht um revolutionäre Konzepte, die noch nirgends angewendet worden wären, sondern um intelligente Ideen, die dann zusammenfinden, wenn verschiedene Partner guten Willens sind und ein gemeinsames Ziel verfolgen.db, Mo., 2015.06.01
01. Juni 2015 Hubertus Adam