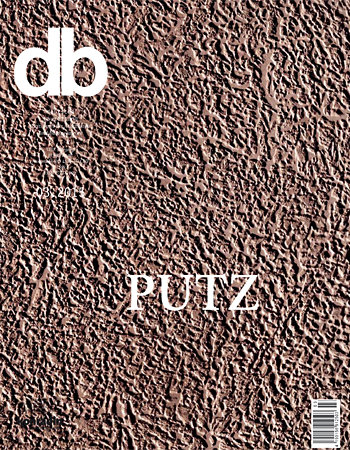Editorial
Langweiliges Massenprodukt oder vielfältig und kreativ einzusetzender Werkstoff? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Nicht zuletzt wegen des vielfach banalen Erscheinungsbilds verputzter Fassaden hat das Ansehen des Baustoffs gelitten. Dabei ist Putz – in seiner ursprünglichen Zusammensetzung aus Wasser, Sand und Kalk – so alt wie die Baugeschichte selbst und hat daher seine Qualitäten bereits über Jahrhunderte bewiesen (Abb.: Reste einer kunstvollen Putzoberfläche an einer antiken Ziegelwand in Pompeji). In dieser Ausgabe stellen wir Projekte vor, die beim Umgang mit Putz – von traditionell bis experimentell – zeigen, dass sich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Baustoff lohnt. Zudem warten einige der Verputztechniken und Putzarten aus der Übersicht auf S. 34 nur darauf, endlich wieder angewendet zu werden. | Martin Höchst
Klammer aus Kratzputz
(SUBTITLE) »PAN Interkulturelles Wohnen« in Wien, A
Die Wohnhausanlage »PAN Interkulturelles Wohnen« in Wien ist der kulturellen Vielfalt ihrer Bewohner gewidmet, die sich bei der Vergabe geförderter Mietwohnungen ganz von selbst einstellt. So beschloss Architekt Werner Neuwirth, das Projekt nicht allein abzuwickeln, sondern Partnerarchitekten aus Zürich und London einzuladen. Gestalterischen Zusammenhalt findet das gelungene Architekturensemble nicht zuletzt über seine wertigen Kratzputzfassaden.
»Das Haus, in dem ich wohne, ist so richtig 70er Jahre!«, sagt Sennur Aslantürk missbilligend. »Aber mich hat das Projekt sofort angesprochen. Ich habe mich hier um eine Wohnung beworben, weil ich die Ideen, die hier realisiert wurden, sehr gut finde.« Die türkische Hausfrau wohnt im Haus der Architekten von Ballmoos Krucker aus Zürich. Auch der kaufmännische Angestellte Michael Lenz wohnt hier und stellt ebenfalls die äußere Erscheinung der beige-braunen Häuser infrage, findet jedoch die Wohnungen »super«.
Die Wohnhausanlage »PAN Interkulturelles Wohnen« auf dem Areal des ehemaligen Wiener Nordbahnhofs spaltet die Gemüter. Sie zählt zu den beachtlichsten und eigenwilligsten geförderten Wohnbauprojekten der letzten Jahre. Schon seit 1995 gibt es in Wien das Modell des Bauträger-Wettbewerbs, bei dem ein Bauträger stets in Zusammenarbeit mit einem Architekturbüro ein Konzept ausarbeitet und sich damit um eine Förderung der Stadt Wien bewirbt (s. db 1/2012, S. 24). Und obwohl die Qualität dieser Bauten traditionell sehr hoch ist, bereichert das Kooperationsprojekt PAN des gemeinnützigen Bauträgers Neues Leben und des Architekten Werner Neuwirth die Reihe dieser Wettbewerbe nun noch zusätzlich.
Für Werner Neuwirth war von Anfang an klar, dass – wenn es um Wohnungsbau speziell für unterschiedliche Kulturen geht – auch Planer aus anderen Kulturen eingeladen werden müssen, um sich gemeinsam des Themas anzunehmen. Man könne nicht von einem einzigen Architekten erwarten, sich in verschiedene Kulturen hineinzudenken, sonst geriete das bauliche Resultat solch eines Unterfangens zur Karikatur.
Neuwirth überzeugte den Bauträger, für die Bebauung des Grundstücks nicht nur ihn, sondern noch zwei weitere Architekturbüros aus anderen Ländern zu engagieren. Und so konnte er schließlich gemeinsam mit von Ballmoos Krucker Architekten aus Zürich und Sergison Bates architects aus London ein heterogenes Gebäudeensemble mit insgesamt 90 sehr unterschiedlich gestalteten Wohnungen entstehen lassen. Die nationalen Handschriften aus Österreich, der Schweiz und Großbritannien sind dabei unverkennbar.
Doch warum gerade diese beiden Länder? Neuwirth schätzt die besondere Wohnkultur in der Schweiz, die dort seit der Nachkriegszeit gepflegt wird und die seiner Meinung nach mit ihren einzigartigen Grundrissen zum Weltbesten gehört. Großbritannien habe aufgrund seiner geografischen Distanz zu Kontinentaleuropa ebenfalls seine eigenen Gesetzmäßigkeiten beim Bauen und Wohnen entwickelt. Hier, am ehemaligen Wiener Nordbahnhof, wird man der Zusammenführung der architektonischen Welten mit all ihren einzigartigen Schnitten, Schiebetüren und Split-Levels gewahr.
In diesem gelungenen architektonischen Miteinander soll auch die Nachbarschaft der Nutzer, die bereits wie ein zartes Pflänzchen zwischen den Wohnungstüren gedeiht, weiterhin gestärkt werden. Dafür findet als aktive Unterstützung in regelmäßigen Abständen ein mehrstündiges Mediationsverfahren statt, zu dem alle Bewohner eingeladen sind; Ziel ist es dabei, Vorbehalte abzubauen und die Menschen miteinander bekannt zu machen.
Vielfalt und Einheit
Der Unterschied im Charakter der drei verputzten Stahlbeton-Bauten ist zwar augenfällig, aber nicht aufdringlich. So manches Detail erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Eine gewisse Heterogenität war den Planern wichtig. Um die Individualität nicht zu übertreiben, sollte das Ensemble jedoch auch ein gewisser Zusammenhalt auszeichnen, gerade in einer Stadt wie Wien mit ihrer typischen Blockrandbebauung und ihren zahllosen Putzfassaden. So unterschiedlich die drei Gebäude bei genauerer Betrachtung sind, so sehr sind sie durch die Kratzputzfassaden am Ende wieder vereint. Für den Architekten ist Kratzputz eine »zutiefst österreichische«Technik, weil sie sehr robust und langlebig ist. Umso mehr bedauert er, dass sie in den letzten Jahrzehnten aufgrund ihrer Arbeitsintensität in Vergessenheit geriet. Im Gegensatz zu normalem Dünnputz, der meist organisch gebunden und nicht dicker als 2-3 mm ist, handelt es sich beim eingesetzten Material um einen mineralischen, sehr grobkörnigen Dickputz mit 15-20 mm Dicke. Man sieht den Unterschied nicht nur, man hört ihn auch: Die Fassade klingt dumpf und schwer.
Gegenüber organischen Putzen hat der mineralische Kratzputz auch bauphysikalische Vorteile. Er bildet keine geschlossene Haut, sondern eine offene, poröse Textur mit unendlich vielen Mikrorissen. »Bei organischen Putzen entstehen in der Regel lange, große Risse, wenn die zusammenhängenden Flächen zu groß dimensioniert sind, da die geschlossene Oberfläche nur bis zu einem gewissen Grad Spannung aufnehmen kann«, erklärt Neuwirth. »Hier jedoch wird diese Spannung bereits vom Putzkörper aufgenommen.«
Die Verarbeitung des Kratzputzes fand in zwei Phasen statt. Zunächst wurde er auf die Mineralwolle- bzw. XPS-Platten aufgetragen und verrieben. Am darauffolgenden Tag, sobald er zur Hälfte eingetrocknet war, wurde er dann mit einem Nagelspachtel nochmals aufgerissen. Das ergibt die charakteristische, unverwechselbare »Elefantenhaut«-Oberfläche, die je nach Tageszeit und Lichteinstrahlung mal weich und ineinander fließend, mal hart und voller Kontraste erscheint.
Anspruchsvolle Handarbeit
Soll die materielle Qualität der Oberflächen stimmen, kommt es beim Aufkratzen des halb »angezogenen« Putzes auf die richtige Temperatur, die richtige Luftfeuchtigkeit und nicht zuletzt den richtigen Zeitpunkt an. Ein abrupter Witterungswechsel mit Schnee und Regen während der Trocknungsphase kommt einer Katastrophe gleich, daher wird der Winter für diese Tätigkeit tunlichst gemieden. Hinzu kommt, dass der Vorgang des Aufkratzens möglichst gleichmäßig und in einem Zug ohne größere Unterbrechungen erfolgen soll. Ein mobiler Autokran ist für diese Arbeit dienlicher als ein Baustellengerüst, das die geschossweise Bearbeitung der Fassade erzwingt und zumeist zu horizontalen Streifen führt.
»Ein paar Grad Unterschied, das falsche Wetter am nächsten Morgen und vielleicht zu viele Handwerker, die alle eine unterschiedliche Handschrift haben, und die Schäden sind nicht mehr wegzubringen«, so berichtet Neuwirth, der sich die Putzexpertise selbst angeeignet und bei diesem Projekt erstmals angewandt hat. Das macht die Methode aufwendig und kostspielig – gut das Doppelte der Kosten für einen handelsüblichen Dünnputz.
Abgesehen von der Tatsache, dass es kein einfaches Unterfangen war, Firmen zu finden, die diese Putztechnik überhaupt noch beherrschen, bereitete das Fassadenmaterial auch den Behörden und Ausführenden Schwierigkeiten: Kratzputz wiegt ein Vielfaches von Materialien, die in Österreich heute marktüblich und somit auch in der Norm berücksichtigt sind. Die nötige Tragfähigkeit pro Fassadenanker (bei 18 cm Stahlbeton, 16 cm Wärmedämmung) war daher weitaus höher als die in der Norm festgehaltene Maximallast. Dies führte dazu, dass die Tragwerksplaner die Lasten individuell berechnen mussten, die Behörden hatten Genehmigungen zu erteilen und die Baufirmen mussten die Haftungsrichtlinien der Putzarbeiten mit Bauträger und Architekt individuell vereinbaren. ›
Durchgefärbt
Die Kritik vieler Bewohner an der Architektur gilt v. a. der vermeintlich einheitlichen Farbgebung der drei Gebäude. Tatsächlich jedoch sind es drei unterschiedliche Beigetöne, die nah beieinander liegen: einmal mit etwas höherem Grauanteil, einmal mit einem Braunstich und einmal mit mehr Grün. Dabei bleibt die Farbgebung bewusst sehr nah an natürlichen Erd- und Lehmfarben, um den körperlichen Eindruck der Architektur zu betonen, statt einen kolorierten Eindruck zu hinterlassen. Dazu trägt auch bei, dass der Kratzputz durchgefärbt wurde. Ein Anstrich kam nicht infrage, um nicht die mühsam hergestellte offenporige Oberfläche wieder zu versiegeln. Der Architekt meint sogar: »Einen Kratzputz anzumalen, wäre ein Fauxpas.«
Als wären die ungewöhnliche Putzfassade und die vielfältigen Wohnungszuschnitte nicht schon genug des Überdurchschnittlichen, verfügen die drei Niedrigenergiehäuser über Fußbodenheizung und Dreischeiben-Verglasung. Das ist ein beinahe schon luxuriöses Gesamtpaket. Ob der hohe Aufwand und die entsprechend hohen Kosten in Relation zu der Idee des geförderten und zu bezahlenden Wohnens stehen, ist für Werner Neuwirth nicht die Frage, da es bei den Baukosten gelang, innerhalb des förderbaren Budgetrahmens zu bleiben.
Wenn ein Bauwerk sozialen und kulturellen Wert hat, wenn es über so etwas wie Charakter und Identität verfügt, wenn es darüber hinaus auch noch Ästhetik und Sinnlichkeit besitzt, dann wird es die nächste Generation gerne übernehmen und weiternutzen. Davon kann man beim Projekt »PAN Interkulturelles Wohnen«, in dem Bewohner aus mehr als 20 Nationen zu Hause sind, ohne jeden Zweifel ausgehen.db, So., 2015.03.01
01. März 2015 Wojciech Czaja
verknüpfte Bauwerke
PaN-Wohnpark
Eine Ode ans Handwerk
(SUBTITLE) Staatliche Musikinstrumentenbauschule in Mittenwald
Der neue Lehrsaaltrakt der Musikinstrumentenbauschule zeigt mit seinen markanten Putzfassaden deutlich Präsenz und bezieht sich dabei gleichzeitig auf die lokale Bautradition. Insgesamt 145 Schülern der Fachbereiche Geigenbau, Zupfinstrumentenbau, Holz- und Metallblasinstrumentenbau bietet er jene Funktionalität und Atmosphäre der Geborgenheit, die sie zum Erlernen ihres traditionsreichen Handwerks benötigen.
Schwer zu sagen, ob Mittenwald heute über Südbayern hinaus bekannt wäre, wenn es den Geigenbauer Matthias Klotz nicht gegeben hätte. Mit seiner hier um 1680 eröffneten Werkstatt gilt er als Begründer einer Geigenbautradition, deren Meisterschaft mit kaum einer anderen in Deutschland vergleichbar ist. Weshalb er sich nach seiner Ausbildung bei italienischen Lehrern gerade hier niederließ, liegt sicherlich an den guten Absatzmöglichkeiten entlang der durch den Ort führenden Handelsstraße, die Augsburg und Bozen verband, insbesondere aber an den Bergwäldern des Karwendel- und Wettersteingebirges. Die auf den kargen Böden langsam und gleichmäßig wachsenden Bäume lieferten nämlich schon damals nicht nur hochwertiges Bau- und Möbelholz, sondern auch ganz besondere Tonhölzer – v. a. Fichte und Bergahorn –, wie sie für den Geigenbau unerlässlich sind.
Trotz der großen Bedeutung, die der Rohstoff Holz für den Ort bis heute zweifellos hat, entschied sich das im Wettbewerb zur Erweiterung der Mittenwalder Geigenbauschule einstimmig zum Sieger gekürte Büro abp architekten für Putzfassaden. Zum einen, weil Putzfassaden für fast alle historischen und neueren Häuser Mittenwalds prägend sind, zum anderen, weil sie den neuen Lehrsaaltrakt mit Mensa möglichst selbstverständlich in den Kontext der bestehenden Schulgebäude integrieren wollten – sowohl die einfachen Nachkriegsbauten als auch das im Zuge des Wettbewerbs von den Architekten liebevoll restaurierte ehemalige Forstamt von 1910 verfügen über Putzfassaden.
Brückenschlag
Die 1858 gegründete Geigenbauschule hatte zum Zeitpunkt der Wettbewerbsauslobung bereits einen Komplettumzug und zahlreiche Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am aktuellen Standort nördlich des Ortszentrums hinter sich. In den 70er Jahren waren außerdem neue Fachbereiche hinzugekommen, sodass die staatliche »Berufsfachschule für Musikinstrumentenbau Mittenwald« neben dem Geigenbau inzwischen auch Ausbildungen zum Bau von Zupfinstrumenten, Holz- und Metallblasinstrumenten anbot. Das Gelände der aus allen Nähten platzenden Schule verfügte zwar über keinerlei eigene räumliche Ressourcen mehr, erhielt aber die einmalige Chance, das weitgehend unbebaute Grundstück und das schmucke Gebäude des unmittelbar benachbarten ehemaligen Forstamts mit in den Campus einzubeziehen. Mithilfe der Um- bzw. Neubaumaßnahmen konnte die Fläche der Schule nicht nur auf rund 7 000 m² verdoppelt, sondern auch der Lehrbetrieb völlig neu geordnet werden: Das repräsentative Forstamt beherbergt nun die Schulverwaltung und eine Bibliothek; die bisher gemischt genutzten Schulgebäude wurden zum reinen Werkstatttrakt, und im dazwischen liegenden Neubau – der mit beiden Bereichen über gläserne Verbindungsgänge verbunden ist – befinden sich die Lehrsäle für den Theorieunterricht, eine Mensa sowie ein resonanzarmer Raum zur präzisen akustisch-physikalischen Vermessung der neu gebauten Instrumente.
Das Ziel der Architekten, mit dem Neubau eine unaufgeregte, aber unverkennbar zeitgenössische Brücke zwischen allen Bestandsgebäuden zu schlagen, ist unmittelbar nach Betreten des Campus am ehemaligen Forstamt spürbar. So erhebt sich das neue Gebäude aus drei traufseitig aneinandergebauten Baukörpern mit Satteldach weder arrogant über das architektonisch eher belanglose Ensemble aus Nachkriegsgebäuden, noch versucht es mit dem denkmalgeschützten Altbau in Konkurrenz zu treten. Dennoch macht der hinter einem alten Torbogen erkennbare zweigeschossige Neubau mit großflächigen Holzfenstern sofort neugierig. Während der eine Baukörper respektvoll die Bauflucht des Forstamts aufnimmt, schiebt sich ein anderer so weit in den neu entstandenen Innenhof, dass die Besucher unwillkürlich auf den an einer leicht erhöhten Terrasse platzierten Haupteingang zusteuern.
Leiser Kanon
Im Gebäudeinnern bestimmen v. a. drei Materialien das Bild: Mit Bezug auf die beiden älteren Gebäudeteile erhielten auch die Fußböden des EG Solnhofener Platten, während verputzte Wände und Decken einheitlich in zurückhaltendem Hellbeige erscheinen. Eher in den Vordergrund spielen sich dagegen die in dunkel geöltem Eichenholz gehaltenen großflächigen Türumrahmungen und Türnischen der Unterrichtsräume. Der insgesamt eher leise Farb- und Materialkanon bestimmt prinzipiell auch das OG – einziger Unterschied sind die durchgängig schwarzen Linoleumböden und das dunkle Holzparkett des Musiklehrsaals.
Kennzeichnend für die Unterrichtsräume sind ansonsten besonders die großen Schiebefenster aus Lärchenholz, deren innenseitig mit dunklen Farbpigmenten geölte Oberflächen mit den Zimmertüren harmonieren. Sie sorgen einerseits für hervorragende Tageslichtverhältnisse und wunderbare Ausblicke auf die umliegende Bergwelt, andererseits sind sie Teil einer Fassadenkomposition, die im Wesentlichen aus zwei unterschiedlichen Fenstertypen mit oder ohne weiße Putzfaschen besteht. Untergeordnete Räume zeichnen sich in der hellgrauen Putzfassade grundsätzlich durch rahmenlose, unregelmäßig gesetzte Quadratfenster ab, die mit weißen, glatt verputzten Faschen optisch hervorgehoben werden. Im Gegensatz hierzu sorgen die gleichmäßig angeordneten und außen mit einer dunklen Pigmentlasur versehenen Schiebefenster der Unterrichtsräume für warme Farbakzente. Deren breite Holzrahmen sind mit den jeweils seitlichen »Holztaschen«, in die die Fenster beim Öffnen geschoben werden, flächenbündig in die WDVS-Fassade eingebaut. Anstatt die Rahmen allerdings mit umlaufenden Silikonfugen in die Putzfläche einzupassen, entwickelten die Architekten ein elegantes Schattenfugendetail. Möglich wurde diese Lösung mit zurückversetzter und daher nicht sichtbarer Dichtebene durch die Verwendung einer monolithischen Dämmung aus formstabilen Mineralschaumplatten. Diese Platten sind nicht nur ökologisch vorteilhafter als etwa Styropor- oder Polyurethanschäume, sie ermöglichen auch einen zusätzlichen Schallschutz sowie Wandaufbauten aus Materialien mit ähnlichen bauphysikalischen Eigenschaften – Stahlbetonwände, Dämmung und Putz bestehen allesamt aus mineralischen Stoffen.
Lokale Reminiszenzen
Die leider erst bei genauem Hinsehen deutlich erkennbare unregelmäßige Oberflächenstruktur der Putzfassade (Waschlputz) – entstanden durch das Bürsten des noch nicht trockenen Putzes – hätte zwar auch auf jedem anderen WDVS-Fassadensystem aufgebracht werden können, vor dem Hintergrund des dahinter gewählten Wandaufbaus zeugt sie hier allerdings von einer Haltung, die einerseits Bezüge zur regionalen Baukunst sucht und andererseits auf dezente Weise das Handwerkliche in den Vordergrund rückt. Von der Liebe zum Detail erzählt nicht zuletzt auch die Tatsache, dass viele maßgeschneiderte Einbauten, Möbel und Tische, z. B. in der Mensa oder der Bibliothek, aber auch die Schiebefenster nicht industriell, sondern nach Plänen der Architekten von einem ortsansässigen Schreiner gefertigt wurden. Dies erleichterte nicht nur die Entwicklung optimaler Anschlussdetails, sondern stellte sich zudem auch als kostengünstiger heraus. Der handwerklich geprägte Einsatz robuster, natürlicher Materialien ermöglicht einen visuell und funktional langlebigen Neubau, der so zeitlos erscheint wie viele andere Projekte von abp architekten. In diesem Fall wirkt das Konzept v. a. deshalb so überzeugend, weil es klare Parallelen zur Philosophie des Instrumentenbauens aufweist. Geht es Instrumentenbauern im Wesentlichen darum, Holz- und/oder Metallbauteile so zu formen und zu fügen, dass virtuose Musiker damit sinnliche Klangwelten erschaffen können, entwarfen und realisierten die Architekten ein Gebäude, das es den Schülern ermöglicht, sich voll und ganz auf das Erlernen des Instrumentenbaus zu konzentrieren. Dass sorgfältig ausgewählte Materialien mit viel Gefühl und handwerklicher Präzision zu einem Objekt verschmolzen werden, das in erster Linie seinen Zweck zu erfüllen hat, ist für Instrumentenbauer und Architekten ebenso selbstverständlich wie die angemessene Berücksichtigung optischer und haptischer Qualitäten.db, So., 2015.03.01
01. März 2015 Roland Pawlitschko
Alles auf Rot
(SUBTITLE) Mehrfamilienhaus in Sterzing, I
Einfache Form, einheitliche Farbgebung: In der heterogenen Umgebung am Stadtrand von Sterzing wirkt das neue »Pfarrmesnerhaus« zunächst wie ein beinah fremdartiger Solitär – doch die Putzfassade in Porphyrrot stellt den Bezug zur Region her.
Laut Eigenwerbung ist Sterzing ist nicht irgendeine Stadt, sondern die »Alpinstadt«, die »Fuggerstadt«, die nördlichste Stadt Italiens mit »einer der schönsten Altstädte« des Landes. Wer den gleich unterhalb des Brennerpasses gelegenen Ort, der im Italienischen Vipiteno heißt, vom Bahnhof aus zu Fuß erkundet, stellt jedoch zunächst einmal ernüchtert fest, dass es hier ist wie überall: Vor lauter Häusern sieht man die Stadt nicht. Der Weg ins Zentrum führt durch öde Gewerbeparks und mittelprächtige Wohnsiedlungen, es geht vorbei an verlassenen Kasernen, marktschreierischen Hotels und nichtssagenden Zweckbauten. Leider währt auch die Freude an den historischen Putzfassaden der kompakten Innenstadt nicht lang, weil diese, ehe man sich’s versieht, durchschritten ist und das vielgestaltig-eintönige Drumherum von Neuem beginnt.
In solch einem Umfeld fällt jedes qualitätvolle Gebäude aus dem Rahmen. Hier am südlichen Stadtrand sind dies die vor wenigen Jahren errichtete Grundschule von Calderan Zanovello Architetti, die alte Pfarrkirche »Unsere Liebe Frau im Moos«, das noch ältere Ordenshaus der Deutschherren – und seit Neuestem ein monolithischer, viergeschossiger Quader in Porphyrrot.
Das 2014 fertiggestellte Mehrfamilienhaus beherbergt vier Wohnungen unterschiedlichen Zuschnitts. Die größte nimmt fast die gesamte südliche Hälfte des Baukörpers ein und erstreckt sich über alle vier Geschosse. Dort wohnt der Bauherr Helmut Zingerle mit seiner Frau und seinen drei Töchtern. Als die Familie das Grundstück von der Pfarrei erwarb, stand noch das in den 60er Jahren errichtete Mesnerhaus darauf, das zuletzt Bedürftigen als Notunterkunft diente. Der Abriss war von Anfang an beschlossene Sache. Um finanzielle Möglichkeiten und ästhetische Ansprüche in Einklang zu bringen, entschied man sich gegen das klassische Eigenheim und plante stattdessen ein Mehrfamilienhaus, dessen Bau sich durch den Verkauf dreier Wohnungen teilweise refinanzieren ließ.
Bis die Läden hochgehen
Von Beginn an waren Armin und Alexander Pedevilla, die im nahen Bruneck ein Architekturbüro betreiben, in die Planungen involviert. Zingerle kennt und schätzt die Brüder seit Langem. »Sie bauen kompromisslos modern und beziehen sich mit ihren Entwürfen zugleich auf den Ort und seine Geschichte«, sagt der Geometer, der sich mit seiner Firma auf Dienstleistungen für Architekturbüros spezialisiert hat. »Außerdem verstehen sie sich auf einfache und robuste Detaillösungen, die ästhetisch überzeugen.«
Das große Ganze wird dabei nie außer Acht gelassen, so wurden allen Wohnungen wegen des rauen Klimas Loggien als geschützte Außenbereiche zugeordnet. »Die individuellen und heterogenen Grundrisseinteilungen sollten«, so Alexander Pedevilla, »in einer einheitlichen Fassadengestaltung einen gemeinsamen Nenner finden.« Um den monolithische Charakter des Gebäudes zu betonen, das als Massivbau mit Stahlbetontragwerk und WDVS errichtet wurde, erhielten die Metalloberflächen der Blenden, Rollläden und Geländer jeweils Beschichtungen in exakt demselben Farbton wie der Anstrich des Außenputzes. Zudem wurden die Rollläden bündig mit den Außenwänden montiert, sodass sich bei geschlossenem Zustand das Bild eines vollkommen homogenen Quaders ergibt. Gehen die Jalousien nach oben, ändert sich der Eindruck. Denn die Öffnungen der Fenster und Loggien, die zwar jeweils auf einer Geschossebene liegen, aber unterschiedlich groß und unregelmäßig verteilt sind, brechen die geometrische Strenge des Baukörpers und beleben die Fassade ungemein.
Die Farbe zu Füssen
Um die plastische Qualität des Entwurfs optimal zur Geltung zu bringen, bedurfte es einer möglichst glatten Oberfläche. Für die Bauherren schieden Sichtbeton, Holz oder andere Fassadenmaterialien von vornherein aus. Putz sollte es sein, gern in Farbe, aber nicht mit »fleckiger« oder »wolkiger« Struktur. Die Architekten griffen die Wünsche ihrer Auftraggeber bereitwillig auf. Sie lieben Putzfassaden. 2012 überzogen sie die Schule in Rodeneck mit einem groben Putz, der wie ein Wollpullover anmutet; 2007 bereits gaben sie dem Rathaus in St. Lorenzen mit einem ausgewaschenen Putz den letzten Schliff; und auch beim aktuellen Wohnhausprojekt in Sand in Taufers ist die Putzfassade bestimmend.
Hinsichtlich der Farbgebung des Sterzinger Hauses plädierten die Architekten für einen erdigen Ton, der einen Bezug zur Region hat. Dass man die passende Farbe in dem rötlich-violetten Schimmer des Porphyrgesteins fand, ist wenig verwunderlich: Neben Quarzit und Dolomit zählt Porphyr zu den am häufigsten verwendeten Baumaterialien in Südtirol – nahezu jeder Gehweg ist damit gepflastert. Das Gestein selbst verwendeten die Architekten dann zwar nicht für den Fassadenputz, aber für die mannshohe Betonmauer, die das Grundstück zur Straße hin abgrenzt: Eine Beimischung von zermahlenem Porphyr verleiht dem ausgewaschenen Beton einen ungewöhnlichen, zwischen Purpur und Flieder changierenden Unterton. Die Mauer passt farblich hervorragend zum Haus, doch mit ihrer rauen Oberfläche bildet sie zugleich einen deutlichen Kontrast zur ebenmäßigen Fassade und ihren Metallteilen, die wiederum vollkommen glatt sind.
Modelliert von der Sonne
Während die Architekten bislang bevorzugt mit Kalkputzen gearbeitet hatten, entschieden sie sich in Sterzing für einen organischen Putz. Zum Einsatz kam ein feinkörniger Modellierputz, gefärbt mit der eigens entwickelten Sonderfarbe »Porphyr«. Ein auf die 20 cm dicke Mineralwollschicht des WDVS gespachteltes Trägergewebe bildet den Untergrund für den Putz. Die nach dem Putzauftrag geglättete Oberfläche erhielt durch die Bearbeitung mit einer Malerrolle eine feine Netzstruktur, deren Grate abgeschliffen wurden. Eine farblose Imprägnierung komplettiert die Oberfläche. Laut Bauherr und Architekt hat die Versiegelung auch den ästhetischen Effekt, dass die Fläche dadurch noch gleichmäßiger erscheint.
Besonders bei diffusem Licht wirkt die Wand völlig homogen. Bei Sonnenschein wird die Oberfläche durch den Schattenwurf der erhabenen Teile der Netzstruktur modelliert und gewinnt dann, v. a. aus einiger Entfernung betrachtet, an Tiefe. Im Hinblick auf ihre Witterungsbeständigkeit machen sich Bauherr und Architekten keine Sorgen. Zwar ist das Klima im 950 m über dem Meer gelegenen Sterzing rau, aber auch nicht arktisch; die äußere Haut des Gebäudes wurde daher lediglich hydrophobiert. Sollte sich die Oberfläche wider Erwarten verfärben, müsste sie erneut gestrichen werden. »Eine Patina ist unerwünscht«, sagt der Bauherr. »Die Fassade ist nicht auf Alterung hin konzipiert.«
Letztlich steht die harmonische Wirkung im Vordergrund: Sowohl die Deutschordenskommende und Teile der Pfarrkirche als auch die Wohnblöcke der Umgebung haben Putzfassaden – die Oberfläche schafft also eine Verbindung zwischen den disparaten Gebäuden des Viertels. Insofern fällt das neue Pfarrmesnerhaus gar nicht so sehr aus dem Rahmen, wie es zunächst scheint. Mit ihrer Vorliebe für den Putz bekennen sich die Pedevilla-Brüder zu einer Tradition, die italienische Stuckateure einst in Südtirol heimisch machten. In Sterzing zeigen sie erneut das große Potenzial dieser Art der Fassadengestaltung auf – und bereichern die Alpinstadt dadurch.db, So., 2015.03.01
01. März 2015 Klaus Meyer