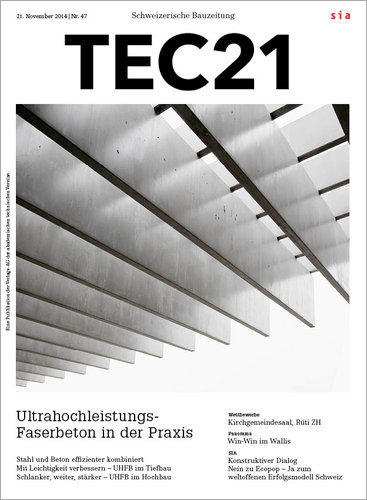Editorial
Ultrahochleistungs-Faserbeton ist kein neues Baumaterial: Hierzulande wird seit 15 Jahren auf diesem Gebiet geforscht. Bemerkenswert ist aber, dass er mittlerweile in grösseren Bauprojekten eingesetzt wird und dass in absehbarer Zeit Normenwerke für seinen Einsatz im konstruktiven Ingenieurbau veröffentlicht werden. Kurz gesagt: UHFB hat sich bewährt, und die Ingenieure und Architekten werden in Zukunft zunehmend mit diesem Material entwerfen.
Nach einem Einblick in die Konstruktion und die Technologie des Materials (vgl. «Stahl und Beton effizienter kombiniert, S. 20») stellen wir zwei Bauten aus der Westschweiz vor. Dort hat sich UHFB im Tiefbau und im Hochbau gegenüber konventionellen Baumaterialien durchsetzen können: Das Chillon-Viadukt bei Montreux (vgl. «Mit Leichtigkeit verbessern», S. 23) konnte so mit geringer Zunahme des Eigengewichts verstärkt und abgedichtet werden. Die Terrasse des Olympischen Museums in Lausanne (vgl. «Schlanker, weiter, stärker», S. 27) bekam eine elegante und dauerhafte Überdachung, die
zugleich Fragen bezüglich der künftigen Entwicklung des Materials aufwirft.
Diese Beispiele zeigen einmal mehr, dass neue Materialien das Potenzial in sich tragen, das Repertoire an konstruktiven Lösungen grundlegend zu erweitern.
Inhalt
AKTUELL
07 WETTBEWERBE
Stadtreparatur im Klostergarten
12 PANORAMA
Win-Win im Wallis
16 KONSTRUKTIVER DIALOG
Nein zu Ecopop – Ja zum weltoffenen Erfolgsmodell Schweiz
19 VERANSTALTUNGEN
20 STAHL UND BETON EFFIZIENTER KOMBINIERT
Eugen Brühwiler
Das Material zu verstehen ist die Prämisse dafür, es richtig einzusetzen.
23 MIT LEICHTIGKEIT VERBESSERN
Hartmut Mühlberg, Eugen Brühwiler et al.
Die Chillon-Viadukte wurden mit einer dünnen UHFB-Schicht dauerhaft verstärkt und abgedichtet.
27 SCHLANKER, WEITER, STÄRKER
Thomas Ekwall
Der UHFB wird beim Olympischen Museum bis an seine Grenzen gefordert.
AUSKLANG
32 STELLENINSERATE
37 IMPRESSUM
38 UNVORHERGESEHENES
Stahl und Beton effizienter kombiniert
Ultrahochleistungs-Faserbeton eröffnet neue Möglichkeiten für Ingenieure und Architekten. Aber was ist UHFB, und wieso ist er als Baustoff geeignet? Ein anschauliches Beispiel anhand der Bemessung einer Bahnbrücke.
Seit jeher führen neuartige Baustoffe zu Fortschritten im konstruktiven Ingenieurbau. Ihre Anwendung beschränkt sich nicht einfach darauf, die herkömmlichen Baustoffe zu ersetzen. Vielmehr basiert die wirtschaftlich effiziente und qualitativ hochstehende Anwendung neuer Materialien auf einem kreativen Tragwerkskonzept und einem tiefen Verständnis ihrer Eigenschaften. In den letzten 20 Jahren wurden die Eigenschaften faserverstärkter, zementgebundener Verbundbaustoffe deutlich verbessert, woraus die sogenannten Ultrahochleistungs-Faserbetone (UHFB)[1] entstanden sind. Die Grundidee des Bauens mit UHFB besteht darin, das Beste der Betonbauweise, d. h. Zement, Bewehrungsstahl, Vorspannung und vielfältige Formbarkeit, und der Stahlbauweise, d. h. leichte, dünne und vorgefertigte Bauteile und schnelle Baumethoden, möglichst optimal zu kombinieren. Die EPFL erforscht und entwickelt den neuartigen Baustoff UHFB seit 15 Jahren, und seit zehn Jahren wird er vorwiegend für die Verstärkung und Abdichtung von Brücken- und Hochbauplatten eingesetzt.[2]
UHFB ist weder Beton noch Stahl, sondern ein neuer Verbundbaustoff (Abb. S. 20): UHFB enthält eine zementgebundene Matrix aus reaktiven Feinstoffen (Zement) und feinen Quarzsanden mit einer Korngrösse von maximal 1 mm. Diese Matrix wird durch schlanke Kurzfasern in hoher Dosierung verstärkt. Diese Fasern sind in der Regel aus Stahl, höchstens 15 mm lang und 0.2 mm dick und machen mindestens 3 % des Volumens aus. Bauteile aus UHFB werden als «Bleche» und «Rippen» bezeichnet, mit üblichen Stärken von 30 bis 80 mm. Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben, da die Zentimeterpräzision des Betonbaus nicht mehr hinreichend ist.
Bei Tragwerken aus UHFB werden wegen ihres hohen Elastizitätsmoduls Stahlfasern eingesetzt. Um die Tragfähigkeit und Robustheit von UHFB zusätzlich zu erhöhen, wird er mit Betonstahl oder Spannstahl bewehrt, der aber nur in der Haupttragrichtung eingelegt wird. In Anlehnung an den Begriff «bewehrter Beton» spricht man in diesem Fall von «bewehrtem UHFB». Flächenelemente wie Bleche enthalten in der Regel keine Bewehrung. Für mechanisch wenig beanspruchte Bauteile wie Fassadenverkleidungen wird UHFB häufig mit synthetischen Fasern hergestellt, und das Einbringen von Bewehrung ist in diesem Fall kaum erforderlich.
Ein grosses Entwicklungspotenzial der UHFB besteht im Verbund mit Stahl, Holz oder Beton. Dieser Bereich bedarf noch weiterer Forschung und Entwicklung, doch in erster Näherung können die bestehenden Regeln für Verbundbauweisen übernommen werden.
UHFB-Bauweise im Brückenbau
Auf Anfrage der SBB wurde eine Überführung aus UHFB mit 15 m Spannweite geplant (Abb. oben), ein häufiger Bauwerkstypus, der hohen Nutzlasten ausgesetzt ist.
Dieser Ersatzneubau einer bestehenden Strassenunterführung im städtischen Raum erfüllte bestens die örtlichen Rahmenbedingungen: Wegen der Lichtraumprofile der Bahn und der Strasse war die Tragwerkshöhe auf 1.35 m begrenzt. Der Standort im städtischen Gebiet liess zudem wenig Platz für eine Baustelle, und der Bahnbetrieb durfte höchstens eine Nacht lang unterbrochen werden. Diese Rahmenbedingungen sprachen gegen eine Betonkonstruktion, die drei- bis viermal schwerer gewesen wäre.
Die UHFB-relevanten Baukosten sind wie folgt geschätzt: Herstellung der neun Fertigteile inklusive Bewehrungsstahl: 45 000 Fr. (9 m³ bewehrter UHFB à 5000 Fr./m3); Amortisation der beiden Schalungen: 50 000 Fr.; Transport und Montage inkl. Vorspanneinheiten: 100 000 Fr. Eine Stahlkonstruktion hätte ein ähnlich grosses Eigengewicht, wäre aber aufgrund der aufwendigen Schweissarbeiten hinsichtlich der Ermüdungsbeanspruchung kostspieliger.
Die Konstruktion besteht aus sieben Normalsegmenten von 2.0 m Länge und zwei Auflagersegmenten von 0.8 m Länge. Planmässig sollten diese vorgefertigten Segmente zur Baustelle transportiert und mittels der Vorspannkabel in Längsrichtung und mit einer Schicht Epoxidharzkleber in den Segmentfugen zusammengespannt werden. Mit einem Kran wird der fertige Brückenträger mit einem Eigengewicht von insgesamt 22.5 t eingebaut. Dieser Arbeitsschritt lässt sich in kurzer Zeit und ohne wesentliche Nutzungseinschränkung von Bahn und Strasse ausführen.
Erkenntnisse aus der Bemessung
Die vorgefertigten Elemente werden mittels Vorspannung durch geradlinig geführten Spannkabel im Ober- und Unterflansch des Trogträgers zusammengefügt. Die Vorspannkraft ist so gewählt, dass im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) der Querschnitt im Bereich der unteren Spannkabel keine Zugspannung bekommt. Im Grenzzustand der Tragsicherheit (GZT) übernimmt einzig der Vorspannstahl die Zugkräfte in Längsrichtung, da keine Längsbewehrung in Form von Betonstahl vorhanden ist und die Tragfähigkeit des UHFB erschöpft ist. Die Querschnitte werden nach den Vorgaben des Merkblatts SIA 20523 bemessen und führten zu folgenden Ergebnissen:
Um die von den Vorspannkabeln verursachte Exzentrizität der Normalkräfte in Feldmitte auszugleichen, erzeugen sechs 8-Litzen-Spannkabel in den Unterflanschen und zwei in den Oberflanschen eine Druckspannung von durchschnittlich 18 MPa im Querschnitt. Im GZG beträgt die maximale Zugspannung im UHFB des Unterflanschs 6.1 MPa und bleibt damit unter der elastischen Grenzzugfestigkeit fUte. Das heisst, der Querschnitt bleibt homogen (ungerissen) und elastisch. Die maximale Durchbiegung im GZG liegt bei 10.5 mm und damit knapp unter der zulässigen Durchbiegung von 1/1400 (11 mm).
Im GZT entfallen 80 % des Bemessungsmoments in Feldmitte auf die Nutzlast (Bahnlasten), 14 % auf die Auflast (Schotterbett und Gleis) und lediglich 6 % auf das Eigengewicht der UHFB-Konstruktion. Dieser hohe Quotient aus Nutzlast und Eigengewicht ist charakteristisch für eine Leichtbauweise.
Im GZT entsteht infolge Biegung ein Kräftepaar in den Flanschen von 9.4 MN, die durch eine Druckspannung von 130 MPa im Oberflansch und eine Zugspannung in den sechs Kabeln des Unterflanschs aufgenommen wird. Der Bemessungswert der Querkraft wird zu 45 % durch den Tragwiderstand des UHFB und zu 55 % durch eine vertikale Querkraftbewehrung in den Stegrippen aufgenommen. Dank der vollen Vorspannung in Brückenlängsrichtung bleiben im Grenzzustand der Ermüdung die maximalen Zugspannungsdifferenzen im Vorspannstahl und im UHFB gering. Der Bemessungswert infolge Ermüdungslasten für die maximale Druckspannung im UHFB der Druckflansche liegt bei 70 MPa und erreicht damit weniger als 50 % des Mittelwerts der Druckfestigkeit von UHFB, womit der UHFB unter der Dauerfestigkeit ermüdungsbeansprucht wird.
Die maximale Ermüdungsspannung des Betonstahls der Rippenplatte bleibt unter dem Bemessungswert von 108 MPa der Dauerfestigkeit.
Neuer Baustoff, neue Perspektiven
Diese UHFB-Konstruktion mit einem aus Blechen und versteifenden Rippen zusammengesetzten Querschnitt ist vom Stahlbau inspiriert, setzt jedoch die Vorspanntechnologie und gegossene Verbindungen ein.
Der Baustoff UHFB eröffnet neue Perspektiven und ressourcenschonende Anwendungen. Wegen seiner hohen Festigkeit ist er insbesondere für hochbeanspruchte Bauten wie Überdachungen mit grossen Spannweiten (vgl. «Schlanker, weiter, stärker» S. 27), für Decken, Stützen und Rahmen im Hochbau sowie für Kunstbauten wie Brücken und Stützmauern geeignet. Mit der UHFB-Technologie lassen sich neue Fassadenformen und -verkleidungen entwickeln. Dank der geringen Dicke der UHFB-Bleche können grössere Elemente vorfabriziert und montiert werden, was der Kreativität von Architekten, Ingenieuren und Designern neue Impulse verleihen kann (Abb. S. 22 unten).
Wegen seiner Leichtigkeit wird er zunehmend auch für die Verbesserung bestehender Bauwerke bevorzugt: Im Verbund mit Stahlbetonbauten können erhöhte Nutzungsanforderungen mit geringem zusätzlichem Gewicht erreicht werden (vgl. unten, «Mit Leichtigkeit verbessern»).
Heute geht es vor allem darum, die Errungenschaften der Baustoff- und Ingenieurwissenschaften zusammen mit Produktions- und Baufachleuten umzusetzen. Es dürfte sich denn auch schon bald eine spezifische Bau- und Baustoffindustrie[4] für UHFB bilden.
[Eugen Brühwiler (Prof. Dr. dipl. Ing. ETH/SIA/IVBH) ist Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Erhaltung, Konstruktion und Sicherheit von Bauwerken an der ETH Lausanne (EPFL).]
Artikel in originaler Sprache und Länge: vgl. «Construire en BFUP», TRACÉS 13/2014.
Anmerkungen:
[01] Das «B» von UHFB steht für Beton, obwohl UHFB kein Beton gemäss der Definition in der Norm SN EN 206 oder im Wörterbuch («Als Baustoff verwendete Mischung aus Zement, Wasser und Sand, Kies o. Ä. [...]») ist. UHFB sollten als faserverstärkte, zementgebundene Verbundbaustoffe oder kurz als «faserbewehrte Zemente» bezeichnet werden. Es ist augenfällig, dass UHFB und Beton unterschiedliche Baustoffe sind.
[02] E. Brühwiler, E. Denarié: Rehabilitation and strengthening of concrete structures using Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concrete. Structural Engineering International, Vol. 23, Nr. 4, 2013, S. 450–457.
[03] Die Arbeitsgruppe UHFB der Kommission SIA 262 erarbeitet momentan das Merkblatt SIA 2052 «Ultra-Hochleistungs-Faserbeton (UHFB) – Baustoffe, Bemessung und Ausführung», das voraussichtlich im Frühjahr 2015 veröffentlicht wird.
[04] Zurzeit bieten folgende Zementhersteller UHFB-Produkte in ihrem Sortiment an: Holcim/CH (Holcim 707 bzw. 710), Lafarge/FR (Ductal), Eiffage/FR (BSI) und Vinci/FR (Vifort).TEC21, Fr., 2014.11.21
21. November 2014 Eugen Brühwiler
Mit Leichtigkeit verbessern
Am Chillon-Viadukt bei Montreux erfolgte mit 2400 m³ die weltweit bisher grösste Instandsetzung mit UHFB. Die Projektbeteiligten berichten über die Materialwahl und ihre Erkenntnisse bei Planung und Ausführung.
Die Fahrbahnplatte des 1969 eröffneten Viadukts der Autobahn A9 sollte ursprünglich mit herkömmlichen Baustoffen instandgesetzt werden. Doch bei den 2012 ausgeführten Hochdruckwasserstrahlarbeiten wurden Anzeichen einer Alkali-Aggregat-Reaktion[1] (AAR) im Beton entdeckt, sodass das Bundesamt für Strassen (Astra) sein Erhaltungskonzept revidieren musste.
Der Schadensmechanismus der AAR befindet sich noch im Anfangsstadium und war im Vorfeld nicht visuell erkennbar. Die fortschreitende AAR wird jedoch über die Jahre zu einer Abnahme der Druck- und Zugfestigkeit sowie des Elastizitätsmoduls des Betons führen. Die Prüfergebnisse des Chillon-Viadukts ergaben, dass der vorliegende Beton eine gegenüber anderen Bauwerken hohe Reaktivität aufweist. Die für den Beton verwendete Gesteinskörnung aus der Rhonemündung am Genfersee zeichnet sich durch lange Inkubations- und Latenzzeiten aus, die mehrere Jahrzehnte umfassen.
Der Beton der Fahrbahnplatte entspricht heute einer Druckfestigkeitsklasse C60/75. Die Tragsicherheit der am stärksten querkraftbeanspruchten Bereiche der Fahrbahnplatten ist somit gerade noch erfüllt. Es ist aber zu erwarten, dass die Betondruckfestigkeit infolge der AAR in 30 Jahren nur noch der Klasse C40/50 entsprechen wird. Laboruntersuchungen haben zudem gezeigt, dass die Latenzzeit der AAR erreicht ist und somit die Gefahr einer beschleunigten Schadensentwicklung besteht. Die UHFB-Lösung setzt sich durch Aufgrund dieser Erkenntnisse standen drei Erhaltungsmassnahmen zur Diskussion: Als Erstes sollte die Tragfähigkeit der Fahrbahnplatte in Querrichtung durch eine herkömmliche Stahlbetonverstärkung erhöht werden. Das Eigengewicht hätte aber derart zugenommen, dass die Tragfähigkeit des Bauwerks in Längsrichtung deutlich überschritten worden wäre; ausserdem wären zusätzliche unwirtschaftliche Verstärkungsmassnahmen ausgelöst worden. Die zweite Variante sah das Aufkleben von Kohlenstofffaserlamellen auf der Ober- und Unterseite der Fahrbahnplatte vor. Auch diese Lösung war unbefriedigend, denn die Lamellen hätten zwar das Biegeverhalten der Platten verbessert, aber nicht den Querkraftwiderstand.
Mit der dritten Variante konnte man die Schwächen der ersten beiden vermeiden: Eine 40 mm dicke Schicht aus schlaff bewehrtem Ultrahochleistungs-Faserbeton (UHFB, vgl. «Stahl und Beton effizienter kombiniert», S. 20) bildet mit der bestehenden Fahrbahnplatte aus Beton einen monolithischen Verbundquerschnitt, der die Tragfähigkeit hinsichtlich Biegung, Querkraft und Ermüdung deutlich erhöht. Diese Schicht wirkt zugleich als Abdichtung gegenüber einem weiteren Wassereintritt in den Beton, womit sich die Schadensentwicklung durch AAR begrenzen lässt. Auch die vergleichsweise geringen Kosten, die kürzere Bauzeit und die vorhandene, noch intakte Oberfläche der Fahrbahnplatte sprachen für diese Lösung.
Versuche und Bemessung
Anhand von Bruchversuchen an Prüfkörpern im Labor konnte der Tragwiderstand des Verbundquerschnitts nachgewiesen werden. Die Versuche wurden unter der Leitung von Professor Daia Zwicky an der HTA Freiburg durchgeführt. Diese Erkenntnisse wurden mithilfe einer Finite-Element-Tragwerksanalyse überprüft. Das Tragverhalten in Längsrichtung wurde anhand von Stabwerkmodellen untersucht. Der bestehende Beton wurde mit einer reduzierten Festigkeitsklasse C40/50 und der UHFB mit einer Zugfestigkeit von mehr als 7 N/mm2 und einer Verfestigungsdehnung von über 2 ‰ berücksichtigt.[2]
Die UHFB-Schicht erhöht die Fahrbahnplattenstärke von 180 auf 220 mm. Dank dieser Schicht konnte aber zugleich eine reduzierte Belagsdicke von 85 mm anstatt der bestehenden 100 mm realisiert werden, womit sich die ständigen Lasten nur geringfügig erhöhten. Die Längsfugen zwischen den vier Einbauetappen wurden gezielt dort positioniert, wo der UHFB auf Biegedruck beansprucht wird (Abb. ganz oben).
Die UHFB-Schicht wurde in Querrichtung schlaff bewehrt (ø 12 mm alle 100 mm), um die Fahrbahnplatte in dieser Richtung tragfähiger auszubilden. Im Bereich der Pfeiler erwies sich der Biegetragwiderstand in Längsrichtung als knapp ungenügend. Eine erhöhte UHFB-Schichtstärke von 50 mm über 25 % der Feldlänge sowie zusätzliche Längsbewehrung genügten aber, um auch diesen Nachweis zu erfüllen.
Flüssig oder fest? – Thixotrop
Die UHFB-Variante stellte hohe Anforderungen an die Ausführung. In den letzten zehn Jahren sind in der Schweiz über 25 Projekte mit UHFB-Verstärkungen von Brückenplatten und Gebäudedecken umgesetzt worden. Bisher wurden jedoch relativ kleine Volumen von maximal 110 m³ realisiert, die manuell eingebracht wurden. Pro Viadukt wird hier auf einer Fläche bis 25 400 m² rund 1200 m³ UHFB gegossen. Auf dem ersten Viadukt erfolgte dieser Einbau zwischen dem 25. Juli und dem 3. September 2014. Diese kurze Zeitspanne wurde durch den maschinellen Einbau des UHFB ermöglicht. Der Unternehmer entwickelte dafür drei unterschiedlich thixotrope[3] UHFB-Rezepturen, die auf die spezifischen Bedingungen wie Einbautemperatur, Längs- und Quergefälle abgestimmt waren: Der Frisch-UHFB konnte sowohl einwandfrei eingebaut werden als auch Oberflächengefällen bis zu 7 % standhalten.
Eigenentwickelte Einbaumaschinen
Der UHFB musste in weniger als sechs Wochen eingebaut werden, was einer durchschnittlichen Leistung von 40 m³ pro Tag entspricht. Aus logistischen Gründen installierte das Unternehmen eine UHFB-Mischanlage direkt vor dem Viadukt. Somit konnten die Verarbeitbarkeit, die Produktionsleistung sowie der Transport des UHFB auf die Witterungsverhältnisse abgestimmt werden. Der Unternehmer entwickelte die Einbaumaschine ausgehend vom Fahrgestell eines Fertigers, der für den Bau der Betonplatten am Flughafen Zürich im Einsatz war (Abb. oben S. 26).
Die Nachbehandlung dauerte fünf Tage und erfolgte unmittelbar nach dem Einbau des UHFB mit einer Kunststofffolie als Abdeckung. Obwohl UHFB wasserdicht ist, wurde die gesamte Oberfläche mit Polymerbitumen-Dichtungsbahnen (PBD) abgedeckt, damit die Haftung des Gussasphalts auf dem UHFB und eine sichere Abdichtung der UHFB-Arbeitsfugen garantiert werden konnten.
Eine effiziente neue Technologie
Der sorgfältigen Vorbereitung und dem Engagement aller am Projekt Beteiligten ist es zu verdanken, dass die Verstärkung der Fahrbahnplatte des ersten Chillon-Viadukts mithilfe einer bewehrten UHFB-Schicht in der gesetzten kurzen Frist und ohne nennenswerte Schwierigkeiten erfolgreich ausgeführt werden konnte. Diese in diesem Umfang erstmalige Anwendung bestätigt, dass sich UHFB für die Verstärkung und Verbesserung von Tragwerken aus Stahlbeton eignet. Die Kosten der UHFB-Arbeiten beliefen sich auf ca. 230 Fr./m2 Fahrbahnoberfläche, was angesichts der vielfältigen Anforderungen wirtschaftlich ist. Durch die vergleichsweise sanfte Intervention mit UHFB bleiben auch die kulturellen Werte der als Denkmalobjekt inventarisierten Chillon-Viadukte erhalten.
[Hartmut Mühlberg (Dipl. Ing. REG A) ist Projektleiter bei Monod-Piguet Associés Ingénieurs Conseils AG in Lausanne.
Stéphane Cuennet (Dipl. Ing. FH) ist Fachspezialist für Kunstbauten der Astra-Zentrale in Ittigen.
Eugen Brühwiler (Prof. Dr. dipl. Ing. ETH/SIA/IVBH) ist Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Erhaltung, Konstruktion und Sicherheit von Bauwerken an der ETH Lausanne (EPFL).
Bernard Houriet (Dr. Ing. ETH/SIA) ist Projektleiter und Teilhaber des Büros GVH in Tramelan.
Frédéric Boudry (Dipl. Ing. ETS) ist Bauleiter bei der Firma Walo Bertschinger in Eclépens.
Blaise Fleury (Dipl. Ing. ETH/SIA) ist Bauherrenberater für UHFB bei OPAN Concept in Neuenburg.]
Artikel in originaler Sprache und Länge: vgl. «2400 m³ de BFUP sur un pont autoroutier», TRACéS 19/2014.
Anmerkungen:
[01] Die Alkali-Aggregat-Reaktion (AAR) ist ein über Jahrzehnte ablaufender chemisch-physikalischer Prozess im Beton. Die alkalische Porenlösung reagiert mit Bestandteilen der Gesteinskörnung, wobei es zu einer Volumenzunahme und zur Rissbildung kommt. Das Thema ist im Merkblatt SIA 2042 normativ behandelt.
[02] Merkblatt SIA 2052 «Ultra-Hochleistungs-Faserbeton (UHFB) – Baustoffe, Bemessung und Ausführung», Schlussfassung vor der Publikation, November 2014.
[03] Eigenschaft bestimmter kolloidaler Mischungen, sich bei mechanischer Einwirkung zu verflüssigen. Die Thixotropie von Frisch-UHFB wird durch die Beigabe bestimmter Zusatzmittel erhalten.TEC21, Fr., 2014.11.21
21. November 2014 Frédéric Boudry, Hartmut Mühlberg, Bernard Houriet, Eugen Brühwiler, Stéphane Cuennet, Blaise Fleury