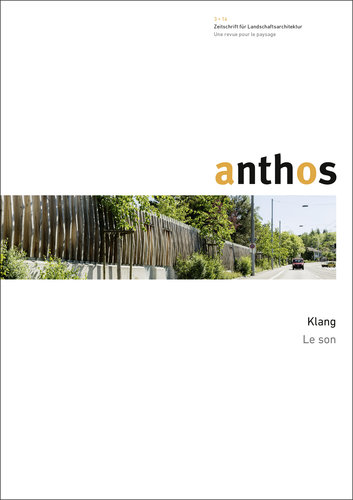Editorial
Es ist ein interessantes Experiment, für einen Moment die Augen zu schliessen und sich die Umgebung nur aufgrund des Höreindrucks vorzustellen. Stimmen die Kopfbilder mit dem überein, was wir sehen, wenn wir die Augen wieder öffnen? Wie klingt ein Wald in der Einflugschneise eines Flughafens, wie die Einfallstrasse in die Grossstadt, wenn ein Amselmännchen seinen Abendgesang anstimmt – und welche Räume imaginieren wir?
Eduard Mörike hörte im 19. Jahrhundert den Frühling nahen «Horch, von fern ein leiser Harfenton!», noch ehe er ihn sah, und Alfred Döblin machte Berlin Anfang des 20. Jahrhunderts zur Weltstadt, indem er dem grossen Stadtumbau des Alexanderplatzes mit dem gewaltigen «Rumm rumm» der Dampframme eine lautliche Dimension gab. Akustische Reize prägen unsere Wahrnehmung weit stärker, als uns häufig bewusst ist.
Der Klang der urbanen wie auch der ruralen Landschaft – und vielmehr noch sein Wandel – vermag eine akustische Kulturgeschichte zu erzählen, welcher die heute vielfach so sehr gesuchten ortsspezifischen Besonderheiten immanent sind. Das Wissen um Raumgestaltung durch Klang, heute als Soundscape-Forschung wieder en vogue, scheint zwischenzeitlich in modebedingte Abhängigkeiten geraten zu sein. Wie anders ist es zu erklären, dass es so in den Hintergrund geraten konnte? Ist dies alleine einer Technikgläubigkeit geschuldet, welche die Natur – und mit ihr offensichtlich den Klang – als beherrschbar annahm, den Klang zum Lärm erklärte und ihn mit technischen Verbauten plump bekämpfte? Lärmschutzungetüme säumen Autobahnen und Bahntrassen, Gärten ducken sich hinter Gabionenwänden. Wir sind bereit, uns die Aussicht zu verbauen, anstatt darüber nachzudenken, wie wir geschickte gestalterische Antworten auf unerwünschte Geräuschimmissionen finden können.
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein waren akustische Elemente wesentliche Teile der landschaftsarchitektonischen Gestaltung.
Klingende Becken lotsten Besucher an entlegene Orte in den Parkanlagen von Versailles bis Wörlitz, die Konstruktionen von Äolsharfen und Wasserrauschern wurden publiziert und kopiert, Umgebungsgeräusche maskiert oder betont. Es erstaunt nicht, wenn es heute vielfach die Hochschulen sind, welche das verlorene Wissen aufarbeiten und in aktuellen Projekten als Forschungs- und Umsetzungspartner eine wichtige Rolle spielen. An internationalen Hochschulen entstehen derzeit hoch interessante Studien (siehe dazu auch den Beitrag von Yvonne Christ in anthos 4/2010 «Der Klang der Landschaft»), welche die urbane wie die rurale Landschaft über ihren Klang erkunden, sich mit Mess- und Erhebungsmethoden auseinandersetzen und zeitgemässe gestalterische Ansätze erarbeiten. Es besteht Hoffnung!
Sabine Wolf
Inhalt
Köbi Gantenbein: Bergsturztosen, Krähenruf und Glockenschall
Kilian Jost: Von Wasserrauschern und Naturtönen
Elise Geisler: Indikatoren für Klangqualität
Nadine Schütz: Landschaftsakustik: Wahrnehmung und Gestaltung
Andreas Kurz: Zur Qualität komplexer Klanglandschaften
Doris Tausendpfund: Oranger Garten
Jan Dietrich: Soundscape IGS Hamburg 2013 – fünf Stimmen für 80 Gärten
Emma Blanc, Louis Dandrel: Der Klanggarten
Huggenbergerfries: Lärmschutzwand Forchstrasse, Zürich
Barbara Willecke: Meeresrauschen im Grossstadtgetöse
Andres Bosshard: Klangraumgestaltung
Stefanie Krebs: Natur und Landschaft übers Ohr
Anette Graupe, Regina Bucher: Stadt hören in Basel
Thomas Kusitzky: Auditive Langzeitbeobachtung Schlieren
Justin Winkler: Soundscape
Joachim Wartner, Raphael Aeberhard: Landschaft mit Ruhequalität
Landschaft mit Ruhequalität
Das Gebiet Belchen-Passwang gehört zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung BLN. Im Zentrum seiner Aufwertung steht die Frage, wie Wert und Charakter des Gebiets für künftige Nutzungsansprüche und Potenziale zu seiner Entwicklung erhalten werden können.
«Die Ruhe und teilweise Abgeschiedenheit erhalten», lautet eines der Schutzziele für das BLN-Gebiet Belchen-Passwang. Dabei geht es um die visuelle ebenso wie um die auditive Ruhe. Zugrunde liegt die Vorstellung einer unberührten, nicht zerschnittenen Landschaft, die weitgehend frei ist von Siedlungsstrukturen und technischen Lärmquellen. Ist die Ruhe einer Landschaft als identitätsstiftendes Qualitätsmerkmal ein mess- und darstellbarer Faktor für eine grossmassstäbliche Landschaftsentwicklung? Wie kann diese Qualität für Aufgabenstellungen der Landschaftsplanung adäquat abgebildet werden? Mit diesen Fragestellungen setzten wir uns im Teilprojekt «Raumkonzept Landschaft» auseinander. Vor dem Hintergrund der diversen Schutz- und Erhaltungsziele sollte das Konzept eine räumlich differenzierte Aussage zu landschaftsverträglichen Entwicklungen treffen.
Räumliche Einheiten
Das Amt für Raumplanung des Kantons Basel-Landschaft stellte zur Bewertung der Ruhequalitäten zwei GIS-Datensätze zur Verfügung. Im Grundlagendatensatz waren bereits alle Strassenklassen und Gebäudetypen als störende zivilisatorische Elemente markiert und herausgefiltert. Wir betrachteten das Modell differenzierter und überprüften es mit Luftbildern sowie anhand der Gebäudetypen. So fügten wir zum Beispiel Feldscheunen und Bienenhäuschen ebenso wie die wenig befahrenen Rückegassen, Feld-, Wald-, Velo- und Fusswege (Strassenklassen 5 und 6) als nicht-störende Elemente dem Datensatz wieder hinzu.
Für ein schlüssiges und flächendeckendes Raumkonzept bildeten wir räumliche Einheiten. Dabei berücksichtigten wir neben landschaftlichen Kriterien die aus einer Landschaftsbewertung hervorgegangenen Qualitätsmerkmale. Für jede Einheit schlugen wir eine anzustrebende räumliche Entwicklung vor. Insgesamt erarbeiteten wir sechs Vorranggebietstypen, beispielsweise «Natur-» oder «Meditations-Landschaft», welche auf die jeweiligen Nutzungspotenziale und Ausprägungen der BLN-typischen Schutzgüter Bezug nehmen.
Wertgebender Aspekt Ruhe
Das Vorranggebiet «Natur-Landschaft» im Bereich des Bogentals zeichnet sich durch eine hohe Ruhequalität aus. Es glänzt durch die beinahe vollständige Abwesenheit zivilisatorischer Einflüsse, was der Zielvorstellung der auditiven Ruhe ohne weiteres Zutun in hohem Masse entspricht. In dem heterogenen Muster von Wald und offenem Weideland kann einzig durch den eindringlichen, fernen Klang der Kuhglocken ein Bezug zum Menschen hergestellt werden.
Schwieriger sieht die Situation für den Aspekt der visuellen Ruhe aus: In den letzten 100 Jahren geriet das räumliche Muster der Wald-Offenlandverteilung durch eine signifikante Waldzunahme arg unter Druck. In den Schutzzielen des Bundes für das BLN-Gebiet heisst es, dass dieses charakteristische, kleinräumige Mosaik erhalten werden soll. Unser Raumkonzept schlägt vor, dass in Teilgebieten, welche nur mit viel Mühe offengehalten werden können, eine Fortsetzung der Verwaldung zugelassen werden kann.
Damit werden die weiteren BLN-Schutzziele für das Gesamtgebiet nicht infrage gestellt. Im Gegenteil, es können finanzielle Mittel verstärkt dort eingesetzt werden, wo das Wald-Offenland-Mosaik noch weitgehend dem Referenzzustand der historischen Kulturlandschaft entspricht. Diese Strategie unterstützt auch das Ziel der visuellen Ruhe, da sich kleinteilige Nutzungsmuster als Spuren menschlicher Präsenz zunehmend auflösen werden.
Das Vorranggebiet «Meditations-Landschaft» definiert sich durch Grosszügigkeit mit introvertiertem Charakter bei gleichzeitig starker kleinräumlicher Differenzierung und hoher visueller wie auditiver Ruhe. «Meditations-Landschaften» sind bislang unbewusst gestaltete Teilräume der Kulturlandschaft, die sich durch raumbildende Gehölzgruppen, geschwungene Wegeführungen und staffagenartige kleine Bauwerke auszeichnen und im Sinne der Gestaltungsintension des Englischen Landschaftsparks weiterentwickeln lassen. Die vorhandenen landschaftlichen Potenziale sollen ausgeschöpft und die Landschafts- und Erholungsqualität in einer integralen Planung erhöht werden. So soll diese idyllisch-arkadische Landschaft durch kontemplative Erholungsformen zur Entschleunigung und damit zur Wohlfahrt der Bevölkerung beitragen.
In Zukunft
Die Entwicklungstendenzen und -szenarien für die Vorranggebiete definierten wir als Leitbilder zur räumlichen Entwicklung für die nächsten 30 Jahre. Heute haben wir die Chance, das BLN-Gebiet mit einer progressiven Landschaftsentwicklung aufzuwerten und damit auch eine bessere Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. Die heutigen reinen Schutz- und Erhaltungsstrategien führen an vielen Orten zu einer Abwehrhaltung und gefährden letztlich sogar die Schutzziele. Aber auch die neue Strategie verlangt ein Umdenken: Mit der Aufgabe der herkömmlichen Nutzung würden sich im Bogental zweifellos wilde und abgeschiedene Landschaften entwickeln, die nicht zwingend auf Verständnis stossen, welche aber im Entwicklungsprozess des BLN-Gebiets durchaus möglich wären.
Wenn es gelingt, die Qualitätsziele räumlich differenziert und konsequent umzusetzen, entsteht ein Mehrwert für alle Nutzer.anthos, So., 2014.09.14
14. September 2014 Joachim Wartner, Raphael Aeberhard