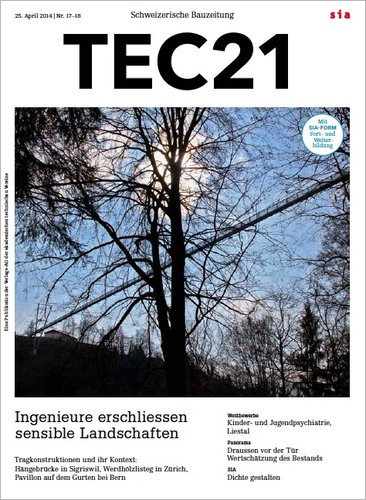Editorial
In sensiblen Landschaften können Bauwerke rasch zu markant oder gar störend wirken, weil die Materialisierung, die konstruktive Ausbildung oder die Lage unangemessen zu sein scheint. Aber «unangemessen» ist ein dehnbarer Begriff. Was für die einen unpassend, ist für andere passend. Oft gehen die Meinungen auseinander, auch weil die Hintergründe der ausgeführten Bauwerke unbekannt sind. Die Kenntnisse über die Entstehungsgeschichte eines Bauwerks verändern seine Wertschätzung.
Anhand von drei Projekten zeigt diese Ausgabe die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, mit denen Bauingenieure konfrontiert sind, wenn sie sensible Orte erschliessen. Welche Grundsätze sie in solchen Situationen befolgen und welche Tragwerkskonzepte sie entwickeln, ist von Fall zu Fall und von Bauingenieur zu Bauingenieurin unterschiedlich. Mitunter weichen sie von den gestalterisch reinen und technisch einwandfreien Konzepten ab und gehen (schmerzhafte) Kompromisse ein. Teilweise werden sie durch behördliche oder finanzielle Rahmenbedingungen so eingeschränkt, dass sich daraus die Lösung ergibt. Manchmal ist auch der Respekt vor der Umgebung zu gross, und aus Zurückhaltung muss erst Mut werden.
Wie das Bauwerk letztlich auf einen wirkt, ist individuell. Wenn die beteiligten Bauingenieure wie in diesen Beispielen aber konstruktiv und gestalterisch sorgfältig entwerfen, so wird ein Kompromiss zum Mehrwert für die Situation.
Clementine van Rooden
Inhalt
AKTUELL
06 WETTBEWERBE
Klinik ohne Spitalatmosphäre
14 PANORAMA
Draussen vor der Tür | Walter Mair vs. 03 Arch. | Bücher | Sind wir fit für die Energiewende?
22 VITRINE
Weiterbildung
26
Beitritte zum SIA | Kurzmitteilungen | Dichte gestalten | SIA-
Form Fort- und Weiterbildung
31 VERANSTALTUNGEN
THEMA
32 «SIE WIRD AN GLANZ VERLIEREN»
Clementine van Rooden
Wir sprechen mit Martin Dietrich, der die Hängebrücke in Sigriswil geplant hat.
36 WIDER DIE VERNUNFT
Clementine van Rooden
Warum ist der Zürcher Werdhölzlisteg aus Holz, wenn GFK dauerhafter und nachhaltiger ist?
40 ÜBER DIE KANTE GESCHOBEN
Clementine van Rooden
Der auskragende Pavillon auf dem Gurten nimmt Rücksicht auf die bestehende Topografie.
AUSKLANG
45 STELLENINSERATE
53 IMPRESSUM
54 UNVORHERGESEHENES
Wider die Vernunft
Nicht immer sind die technologisch besten Materialeigenschaften an einem Ort auch die besten aus emotionaler Sicht. Staubli, Kurath & Partner konstruierten deshalb den Werdhölzlisteg in Zürich Altstetten aus Holz – obwohl Kunststoff hier nachhaltiger und dauerhafter gewesen wäre.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Limmat kanalisiert, und während dieser 130 Jahre gingen die auentypischen Lebensräume und Landschaften sukzessive fast vollständig verloren. Diesem Verlust wollte der Kanton Zürich entgegenwirken.[1] Grün Stadt Zürich beschloss deshalb, die Limmatauen im Rahmen der Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Renaturierung der Limmatufer zwischen dem Stauwehr Zürich-Höngg und der Autobahnbrücke bei Oberengstringen wiederzubeleben.
Weichholzauen sind Uferbereiche von Bächen und Flüssen, die wiederkehrend von Hochwasser überflutet werden und mit dem Grundwasser verbunden sind. Sie zeichnen sich durch «weiche», biegsame Baumarten wie die Silberweide aus, die länger anhaltende Überschwemmungen und starke Strömungen aushalten. Auch das Werdhölzli war bis vor 200 Jahren eine Weichholzaue, die mehrmals pro Jahr überschwemmt wurde. Als die Limmat in ihren engen Lauf gezwängt wurde, verlor sie an Dynamik und überflutete das Werdhölzli nur noch bei extremen Hochwassern. Es entwickelte sich zunächst zu einer Hartholzaue. Deren Baumarten, wie beispielsweise Eschen und Ulmen, zeichnen sich durch ein «hartes» Holz aus. Da das Werdhölzli in den vergangenen Jahrzehnten immer seltener überflutet wurde, trocknete auch die Hartholzaue weiter aus und veränderte sich allmählich zu einem Laubmischwald.
Die renaturierte Limmat ist nun wieder mit dem Werdhölzli vernetzt. Ein Rohr schwemmt durchschnittlich 18-mal pro Jahr Flusswasser in den geschützten Landschaftsbereich ein. Es entsteht wieder ein Lebensraum für typische Arten der Hartholzauen.
Holz ist hier weder dauerhaft noch nachhaltig
Um diese Landschaft zugänglich zu machen, ohne sie zu beeinträchtigen oder gar zu beschädigen, liess Grün Stadt Zürich die Auenlandschaft mit einem Steg erschliessen. Von ihm aus lässt sich das Gebiet beobachten. Die Materialisierung war dabei von Anfang an klar: Holz musste es sein; es ist nachhaltig und fügt sich optisch und gefühlsmässig ansprechend in die Landschaft ein. Allerdings, so gibt der verantwortliche Bauingenieur Josef Kurath zu bedenken, sei Holz aus technischer und ökologischer Sicht in diesem feuchten Auenlandwald nicht das richtige Konstruktionsmaterial für den Steg – auf 400 m ü. M., bei Luftfeuchtigkeiten von meist über 80 % im Mittellandklima, sei es nicht nachhaltig und dauerhaft. Bewittertes Holz hat hier eine Lebensdauer von nur acht bis zehn Jahren, dann muss es ersetzt werden. Baumstämme, die neben dem Steg liegen, zeigen die Verhältnisse auf: Ungeschützt verfaulen sie in nur wenigen Jahren. Man wird ungeschütztes oder schlecht geschütztes Holz in der Konstruktion deshalb immer wieder ersetzen müssen, ausser man verwendet Tropenholz wie Teak oder Iroko. Diese häufigen Unterhaltsmassnahmen erfordern viel graue Energie, die im Transport und in der Verarbeitung steckt.
Glasfaserverstärkter Kunststoff ist geeignet
Eigentlich, so Kurath, wäre glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) in dieser feuchten und sonnenarmen Umgebung konstruktiv und bezüglich Nachhaltigkeit geeigneter gewesen. Dies zeigt auch eine Ökobilanz, die im Rahmen der EXPO.02 gemacht wurde, relativ deutlich (vgl. «Ökologischer Vergleich», S. 38). Das Erdöl ist bei GFK-Bauten in grossen Bauelementen gebunden, diese sind zwar naturfremd, verrotten aber nicht und haben gerade in dieser Umgebung eine hohe Lebensdauer. Entsprechend einer Kaskadennutzung können sie später weiterverwendet werden und lassen keine Spuren im Wald zurück. Doch dem Menschen, so sinniert Kurath weiter, widerstrebt es optisch und gefühlsmässig, «Plastik» in der Natur zu verwenden. Dies haben auch die Diskussionen im Planungsteam gezeigt. Viele Besuchende würden diese Materialien hier nicht schätzen und den Einsatz als falsch empfinden. «Was begreiflich ist», fügt er schliesslich an. Der Mensch soll sich hier wohl fühlen, und der Steg soll den Besuchern Freude bereiten.
Kompromisse für die Holzlösung
Naturwissenschaftliche und emotionale Aspekte müssen vereinbar sein. Das Vergnügen der Besuchenden sollte im Vordergrund stehen, allerdings innerhalb klarer Grenzen. Die Konstruktion des Werdhölzlistegs ist ein Kompromiss, den sich die Beteiligten erarbeitet haben, wobei die Planenden vor allem drei Grundsätze befolgten: Der Förster des Waldreviers Nord Grün Stadt Zürich, Emil Rhyner, und sein Team sollten den Steg erstens selber und zweitens mit möglichst viel eigengeschlagenem Holz bauen können.
Der Anspruch, eine unaufgeregte Stegkonstruktion zu bauen, schlug sich positiv im Budget nieder: Normalerweise setzt man für einen Fussgängersteg 2500 bis 4500 Fr. pro m2 ein; hier waren es 1500 Fr./m2. Drittens sollte der Holzsteg dem Ort entsprechend eine ökologische und nachhaltige Bauweise aufweisen. Folglich verwendeten die Planenden grundsätzlich Material aus den städtischen Wäldern, das ohne weite Transportwege in die Betriebe der Försterei gelangte – einzige Ausnahme bilden die Tragpfähle. Das Holz wurde zwei Jahre zuvor in den Wintermonaten geschlagen, gesägt und an der Luft getrocknet. So konnte einer frühzeitigen Pilzbildung vorgebeugt werden, und der Energieaufwand für die übliche Ofentrocknung entfällt.
Wichtig für die Energiebilanz dieses Bauwerks ist ein guter Holzschutz, damit der Steg eine hohe Lebensdauer aufweist und nicht viel Energie für eine häufige Instandsetzung verwendet werden muss. Auf einen chemischen Schutz wurde trotz des unwirtlichen Klimas für den Holzsteg verzichtet, denn dieser hätte ausgewaschen werden können und hätte die Natur belastet. Man strebte darum einen konstruktiven Schutz des unbehandelten Holzes an. Die beste Schutzvariante wäre eine Überdeckung des gesamten Stegs. Um die Aussicht nicht zu beeinträchtigen, verzichteten die Beteiligten darauf. Der ungeschützte Brückenbelag muss deshalb voraussichtlich in acht bis zehn Jahren instandgesetzt oder ersetzt werden. Um trotz allem eine möglichst dauerhafte Brücke erstellen zu können, muss die Konstruktion sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
Holzkonstruktion in feuchter Umgebung
Der 320 m lange Holzsteg fügt sich in einer Zickzacklinie in die Auenlandschaft ein. Er besteht aus einzelnen Einfeldträgern, die auf Rundhölzern lagern, welche mit einem kleinen Bagger in den Boden gerammt wurden; es sind FSC-zertifizierte Robinien aus Ostdeutschland. Die Pfähle konnten mit einer maximalen Länge von zwei bis drei Meter geliefert und dadurch nur einen Meter tief in den Boden eingebunden werden. Ihre Belastung musste deshalb gering gehalten werden. Dies und die Länge des für die Tragbalken verwendeten Rundholzes ergab die obere Grenze für die Spannweiten; mit sechs bis zehn Meter belassen sie den Boden trotzdem möglichst frei.
Die Hauptträger sind nicht unter, sondern über dem Laufsteg angeordnet. Der Raum unter der Brücke wird so besser durchlüftet, was für den Belag und die darunter liegenden Sekundärträger in Eiche vorteilhaft ist. Die oben liegenden Hauptträger sind gut umlüftet und sichtbar, können phasenweise wieder austrocknen und von Unterholz freigeschnitten werden. Ausserdem kann sich die Vegetation unter der aufgestelzten Brücke hindurch entfalten.
Im rohen Förstersteg stecken die Finessen in den Details
Jeder Hauptträger besteht aus einem unverleimten Brettschichtholzträger, der mit einem rohen Stahlblech abgedeckt ist. Vorgespannte Schrauben ziehen die Konstruktion zusammen und bewerkstelligen den Verbund. Die Anzahl der Vorspannschrauben ist auf die Grösse der Querkraft abgestimmt; mit abnehmender Querkraft nimmt auch die Anzahl Schrauben ab – es entsteht eine auf die Statik abgestimmte Komposition. Über Reibung gibt der Brettschichtholzträger den Schub weiter an die Trägerenden und vor dort auf die Pfähle. Das Stahlblech ist breiter als die Holzbretter, was eine umlaufende Wassernase an der unteren Kante ermöglicht. Das Stahlblech hat also mehrere Funktionen:
Es beteiligt sich an der Quervorspannung und schützt den Holzträger vor der Witterung. Zudem trägt es zur Steifigkeit der Brückenkonstruktion bei und übernimmt die Widerlagerfunktion. Und schliesslich sind darauf die Handläufe aufgeständert.
Der Abstand zwischen den Hauptträgern und dem Gehbelag beträgt etwa 30 cm – ausreichend, um die Konstruktion vor Spritzwasser zu schützen. Einzig bei der Überspannung des Mäanders ist das nicht der Fall. Um den Handlauf durchgehend auf derselben Höhe zu behalten, erweiterte man den Träger, der wegen der Spannweite eine grössere statische Höhe erforderte, gegen unten – auf Kosten des Spritzschutzes. Auch an den Brückenenden und in den Aufenthaltsbereichen weicht die Konstruktion vom Grundprinzip ab: Die Brückenenden sind mit einem Gitterrost bedeckt. Er sorgt für eine bessere Durchlüftung unter der Brücke und verhindert, dass an diesen heiklen Stellen Holzelemente verfrüht faulen. Die Aufenthaltsbereiche – grundsätzlich Verbreiterungen der normalen Rhythmen der Einfeldträger – erfordern quer zur Brückenachse grössere Spannweiten, weshalb zusätzliche Träger montiert werden mussten; sie sind zugleich Sitzgelegenheiten und laden zum Verweilen ein (Abb. S. 36).
Der konstruktive Schutz muss stets greifen
Die Brücke muss gepflegt werden, damit der konstruktive Schutz wirkt. Die Wassernasen an den Stahllaschen müssen funktionieren und die Hauptträger von Unterholz befreit sein. Alle Abstände zwischen den Holzteilen müssen frei bleiben, damit die Stellen durchlüftet werden und nirgends auch nur wenig Wasser liegen bleibt. Nur auf diese Weise wird die Brücke die geplanten 40 Jahre halten. Wenn denn doch einmal einzelne Bretter, Latten oder Träger ausgewechselt werden müssen, kann die Instandsetzungsarbeit innerhalb des Brückenquerschnitts erfolgen; es ist nicht erforderlich, die Auenlandschaft zu betreten. So bleibt die geschützte Landschaft mit ihrer Flora und Fauna noch lang unbeschadet bestehen.
Anmerkung:
[01] Der Limmat-Auenpark Werdhölzli ist ein Projekt der Baudirektion des Kantons Zürich, unterstützt von der Stadt Zürich, der Gemeinde Oberengstringen, dem naturemade-star-Fonds von ewz, dem WWF in Kooperation mit der Zürcher Kantonalbank sowie dem Bundesamt für Umwelt.TEC21, Fr., 2014.04.25
25. April 2014 Clementine Hegner-van Rooden