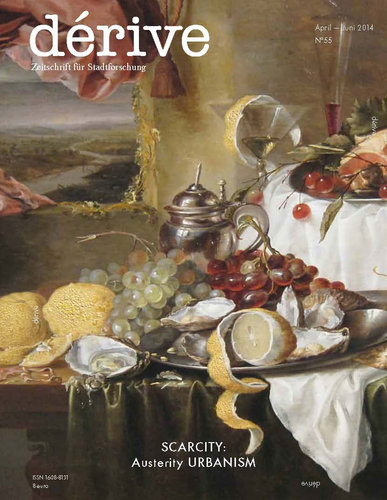Editorial
Obwohl sich das kapitalistische System vor allem seit der Finanzkrise von 2007 einer selbst in bürgerlichen Medien formulierten Kritik ausgesetzt sieht, gelten seine ideologischen Grundpfeiler als quasi naturgegebene Wahrheiten, deren Infragestellung in der politischen Alltagsdiskussion nicht vorkommt.
Die gerne paraphrasierte Textstelle aus der Einleitung zu Fredric Jamesons 20 Jahre altem Buch The Seeds of Time, wonach es leichter scheint, uns die Zerstörung der Welt und der Natur vorzustellen als den Zusammenbruch des late capitalism, hat nach wie vor seine Gültigkeit. So werden die Vorkommnisse mit Vorliebe als Auswüchse und Skandale thematisiert und der Finanzkapitalismus kritisiert, immer in der Hoffnung, mit sauberen und ehrlichen PolitikerInnen und weniger gierigen Bankern wäre das Problem gelöst. Die vorliegende dérive-Ausgabe nähert sich der Thematik mit einem grundsätzlicheren Anspruch: Ihr Schwerpunkt hinterfragt einen der erwähnten Grundpfeiler des Kapitalismus, der momentan Hochkonjunktur feiert, und unterzieht ihn einer deutlichen Kritik: Scarcity, die Knappheit, steht im Fokus der beiden Schwerpunktredakteure Michael Klein und Andreas Rumpfhuber, die ihre Forschungen im Rahmen des HERA-Projektes SCIBE – Scarcity and Creativity in the Built Environment tätigten. Wie die beiden in ihrem einleitenden Artikel schreiben, gilt im Kapitalismus die Grundkonstante, dass die menschlichen Wünsche – unabhängig vom Grad der Befriedigung der Bedürfnisse – unendlich, »die Mittel dafür jedoch nur begrenzt verfügbar sind. Knappheit wird damit zum universellen Problem.« Klein und Rumpfhuber argumentieren, dass Knappheit »als das fundamentale Argument gegenwärtiger Spar- und Austeritätspolitik« keineswegs »natürlich« ist, sondern erst durch »soziale Prozesse von Zugriffs- und Verteilungsentscheidungen produziert« wird.
So kritisiert Costas Panayotakis in seinem Beitrag Scarcity at a Time of Capitalist Crisis die unhinterfragten Annahmen und Voraussetzungen der Knappheitsideologie und zeigt ihre Auswirkungen auch am Beispiel der aktuellen Situation in Südeuropa. Jamie Peck analysiert den Austerity urbanism, the American way. Er zeigt auf, wie die Auswirkungen der Austeritätspolitik genau von jenen Bevölkerungsschichten getragen werden müssen, denen stets versprochen wurde, dass sie vom angeblichen Trickle-Down-Effekt der neoliberalen Wirtschaftspolitik profitieren würden. Ein Versprechen, das nie eingelöst wurde. Der Text von Erik Swyngedouw und Maria Kaika holt weit aus und stellt die »galloping planetary urbanization«, ihren Raubbau an den weltweiten Ressourcen, die sozio-ökologischen Ungleichheiten und »the depth and extent of environmental degradation« ins Zentrum seiner Analyse. Loïc Wacquant zeichnet in seinem Artikel für den Austeritäts-Schwerpunkt die Verbannung und Verdrängung der Armen in den letzten Jahrzehnten in Europa und den USA bis zum Status quo der Gegenwart nach, den er als »fortgeschrittene Marginalität« bezeichnet.
Das Kunstinsert im Mittelteil der Ausgabe stammt von Katrin Hornek, die sich ausgehend von einem Zitat Heinrich von Kleists mit dem Verhältnis von Zusammenbruch und Stabilisierung beschäftigt. Der daran anschließende Magazinteil widmet sich der aktuellen Neuauflage von Henri Lefebvres Revolution der Städte (La révolution urbaine). Es ist eines der wenigen Bücher Lefebvres zur urbanen Gesellschaft, das auf deutsch erschienen ist und das erstmals bereits knapp nach der französischen Originalausgabe von 1970. Selbst wenn das Werk trotz vielfacher Kritik an der deutschen Übersetzung auch diesmal nicht neu übersetzt worden ist, gewinnt die Ausgabe doch deutlich an Qualität durch einen ausführlichen Einleitungsartikel von Klaus Ronneberger. In dieser dérive-Ausgabe stellt Ronneberger die unterschiedlichen Dimensionen des Textes und seinen gesellschaftspolitischen Kontext vor und fragt nach, inwieweit Lefebvres Klassiker noch einen wichtigen Referenzpunkt für die kritische Stadtforschung darstellt.
Manfred Russo widmet sich in seiner Serie Geschichte der Urbanität ein weiteres Mal der Stadt als Archipel der Kapseln und thematisiert den Zusammenhang von Heterotopie und der Privatisierung des öffentlichen Raumes.
Last but not least steht auch die Architekturbiennale in Venedig, 2014 kuratiert von Rem Koolhaas, wieder einmal ins Haus. dérive hat Christian Kühn, den Kommissär des österreichischen Biennale- Beitrags, zum Interview getroffen. Die durch ihn kuratierte Ausstellung steht unter dem Titel Plenum. Orte der Macht und präsentiert 200 nationale Parlamentsgebäude weltweit als Modelle im Maßstab 1:500. Sie thematisiert Fragen zu Demokratie, Legitimität, Symbolik, Identität und natürlich zum Stellenwert und zur Rolle von Architektur in diesem Feld.
Noch ein paar dringende Hinweise in eigener Sache: Klaus Ronneberger startet mit der Neuauflage von Henri Lefebvres Revolution der Städte im Gepäck eine kleine Österreichtournee: Zu sehen und zu hören am 7. Mai im afo Linz, am 8. Mai als Gast von dérive in der Akademie der bildenden Künste Wien und am 10. Mai 2014 in Graz.
Einen Monat später, am 11. Juni, veranstaltet das World-Information Institute in Kooperation mit dérive und dem Architekturzentrum Wien das Symposium Stadt als Informationssystem, bei dem wir als Gast u.a. Adam Greenfield er- warten, der das wunderbare Pamphlet Against the Smart City verfasst hat. Dem Thema Smart Cities widmen wir uns auch in der Sommerausgabe von dérive, die rechtzeitig zum Symposium erscheinen wird.
Doch zuvor zieht es uns nach Venedig, wo am 7. Juni die Architekturbiennale eröffnet wird und dérive aus diesem Anlass als Medienpartner hocherfreut die Eröffnung einer neuen temporären Verkaufsstelle vermelden kann: Sie finden sie von 7.6. bis 23.11. im österreichischen Pavillon (das ist der ganz hinten links) in den Giardini.
Ci vediamo! die dérives
Inhalt
01 Editorial Christoph Laimer
Schwerpunkt
04 — 09 Knappheit, Austerität und die zeitgenössische Stadt
Michael Klein & Andreas Rumpfhuber
10 —14 Scarcity at a Time of Capitalist Crisis
Costas Panayotakis
15 — 20 Radical urban political-ecological imaginaries: planetary urbanization and politicizing nature
Erik Swyngedouw & Maria Kaika
21 — 24 Austerity urbanism, the American way
Jamie Peck
25 — 31
Die Rolle von Klasse, Ethnizität und Staat bei der Produktion von Marginalität. Eine Neubetrachtung von Territorien städtischer Verbannung
Loic Wacquant
Kunstinsert
32 — 36 It stands, because all the components want to collapse at the same time
Katrin Hornek
Magazin
37 — 42 Henri Lefebvre und die urbane Revolution
Klaus Ronneberger
43 — 51
Serie: Geschichte der Urbanität, Teil 43
Postmoderne IX: Die Stadt als Archipel der Kapseln (Teil 3). Heterotopie als Chance oder Bedrohung? Kapsel, Heterotopie und Privatisierung des öffentlichen Raumes
Manfred Russo
52 — 54 »Architektur ist ein Medium gesellschaftlicher Veränderung.« Interview mit Christian Kühn
Besprechungen
55 — 67
55 Hype um die Zwischennutzung?
56 Wandern auf der Autobahn
57 Wem nützt die Architektur?
58 Ein unverzichtbarer Atlas zur olympischen Region Sotschi. A Creative City @ afterglow.
59 Ein kleiner Streifzug durch Berlin und die Transmediale 2014
60 Berlin Contested
61 Street Art: Straße und Marktplatz
63 Die Kartographie des urbanen Aufstands
65 Kulturhistorische Streifzüge durch Wien
68 — 76 Stadt der Gewinner, Stadt der Verlierer www.derive.at
Backissues Impressum
dérive – Radio für Stadtforschung
Jeden 1. Dienstag im Monat von 17.30 bis 18 Uhr in Wien auf ORANGE 94.0 oder als Webstream http://o94.at/live. Sendungsarchiv: http://cba.fro.at/series/1235
»Architektur ist ein Medium gesellschaftlicher Veränderung.«
Christian Kühn, Kommissär der Architekturbiennale 2014 in Venedig, im Gespräch mit Christoph Laimer und Elke Rauth über den Österreichbeitrag Plenum. Orte der Macht. Die Ausstellung im österreichischen Pavillon präsentiert 200 nationale Parlamentsgebäude weltweit und thematisiert Fragen zu Demokratie, Legitimität, Symbolik, Identität und natürlich dem Stellenwert sowie der Rolle von Architektur.
dérive: In den Texten zum österreichischen Biennale-Beitrag finden sich zwei Zitate, die widersprüchlich erscheinen: »Architektur spiegelt Gesellschaft wider« und »Die Räume der Macht werden architektonisch nicht mehr erfasst«. Wie ist das zu verstehen?
Christian Kühn: Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir die Ausstellung Räume der Macht oder Orte der Macht, also Spaces of Power oder Places of Power nennen sollen. Die traditionellen parlamentarischen Institutionen als Gebäude sind natürlich places. Heute würde man aber viel eher von Spaces of Power sprechen und damit auch ganz andere Räume inkludieren, wie den virtuellen Raum oder den Freiraum rund um ein parlamentarisches Gebäude. Trotzdem wäre es eine völlig unsinnige Aussage, dass Architektur und Städtebau Gesellschaft nicht mehr widerspiegeln. Auch die neuen sozialen Bewegungen suchen sich sehr gezielt ihre Orte im öffentlichen Raum und versuchen, diese Räume anders zu besetzen und damit andere Machtstrukturen zu erzeugen: Sehr oft als Gegenposition zu einem gebauten Parlament, zu einem Ort der Macht, der sich mit Mauern umgeben hat. Natürlich sehr oft auch mit dem Ziel, diese gebauten Orte der Macht für sich zu erobern.
Auch das Ausstellungskonzept scheint die in diesen Krisenjahren deutlich hervortretenden Macht- Verhältnisse wiederzugeben: Im Innenraum des österreichischen Pavillons werden 200 Modelle von Parlamentsgebäuden präsentiert, während im Außenraum ein landschaftsarchitektonisch dichter Wildwuchs entstehen soll, der mit einer Klang-Installation aus Protest-Tweets bespielt wird. Wie nahe können die neuen sozialen Bewegungen der Macht kommen?
Sehr weit kommen die Bewegungen in unserer Gestaltung tatsächlich nicht. Wir wollen natürlich darstellen, dass etwas von außen diese Mauer überwindet, diese existierende Mauer auch bricht und sich der Monumentalarchitektur nähert. Das ist eine dynamische Geste, die geplanten Bäume wachsen ja tatsächlich weiter. Aber natürlich bleibt das auf einer symbolischen Ebene. Wir weisen auf ein Phänomen hin und versuchen es mit dem Medium einer Architekturausstellung erfahrbar zu machen. Selbstverständlich ist geplant den Diskurs hineinzulassen, in Form von Veranstaltungen, mit denen dieses Parlament der Parlamente belebt wird. Aus diesem Blickwinkel ist das Diskursprogramm natürlich ein wichtiger Teil des Ganzen, vielleicht wichtiger als das Bühnenbild, das wir aufbauen.
Wie zeigt sich bei den 200 Beispielen von Parlamentsgebäuden das Verhältnis von Neubauten und bestehenden Gebäuden? Gibt es eine Art Kanon, einen Fundus, aus dem die jeweiligen Zeichen der Repräsentation stammen?
Der überwiegende Teil der Parlamente stammt aus dem 20. Jahrhundert, viele sind Neubauten. Die Recherche bringt natürlich interessante Dinge ans Licht: So haben die kolonialisierten Staaten bald nach ihrer Befreiung vielfach Parlamentsgebäude gebaut und in der Regel verständlicherweise auf Architekten aus Ländern zurückgegriffen, die mit dem Kolonialismus nichts zu tun hatten. Auch in Afrika hat man lieber schwedische oder finnische Architekten beauftragt, als englische oder französische Planer. Man könnte jahrelang Forschung betreiben auf der bauhistorischen, architektonischen, politik- und kulturwissenschaftlichen Seite – da gibt es noch vieles zu entdecken und aufzuarbeiten.
Was die Zeichensprache betrifft, dominiert ganz eindeutig der Klassizismus, bis in die Gegenwart. Es gibt wenige kleinere Staaten, die versuchen autochthone Formen einzuführen, das geht manchmal gut, manchmal wird es katastrophal. Dann natürlich die klassische Moderne, die in einer Phase die Chance hatte, zeitgemäße Architekturen zu realisieren. Gerade bei afrikanischen Parlamentsgebäuden aus der Phase nach der Unabhängigkeit wurde gerne auf die Formensprache der Moderne zurückgegriffen, mit der Idee autonom an den Fortschritt anzuschließen. Heute finanziert China, ein selbst mehr oder weniger demokratisches bis diktatorisches Regime, in Afrika Parlamentsgebäude, neben vielem anderen. Es ist beispielsweise hoch interessant, dass die Afrikanische Union strukturell zwar nach dem Vorbild der EU modelliert ist, mit Kommission, mit Parlament – also genau dieselbe Idee. Aber das 400 Mio. Dollar Gebäude in Addis Abeba, das vor zwei Jahren eröffnet wurde, ist von China geplant, finanziert und zum Teil sogar von chinesischen Arbeitern gebaut worden. Und dann gibt es in einigen überaus reichen Ländern katastrophal kitschige, geradezu unfassbare Gebäude, die eben nicht auf demokratische, sondern auf autokratische Systeme zurückführen.
Im Bewusstsein der Diskussion um die Auflösung der Zeichen, der Rede vom »ornamentalen Setzkasten Architektur«: Kann an der Gebäudesprache die politische Verfasstheit des jeweiligen Staates überhaupt abgelesen werden?
Wenn man genau hinsieht und recherchiert – ja. Wenn nur die Oberfläche betrachtet wird, sieht man gar nichts. Die Knesset in Israel stellt beispielsweise ein Monumentalgebäude dar, dessen erster Entwurf ausgesehen hat wie NS-Architektur – geschuldet der Idee, dauerhafte Strukturen zu schaffen. Und der Klassizismus ist usurpiert worden von totalitären Regimen, ist aber natürlich per se keine totalitäre Geste. Wenn man Architektur als Prozess auffasst und sagt, Architektur ist alles was passiert plus das bauliche Resultat, dann erkennt man sehr viel. Schließlich müssen in diesem Prozess Aufgabenstellungen definiert und Selbstbilder hinterfragt werden. Da kommt einiges zum Vorschein. Im Falle des österreichischen Parlaments kommt ja gerade zum Vorschein, dass man sich einer Debatte nicht stellen möchte. Hier wird hinter einer Sanierung die Frage versteckt, wie eine zeitgemäße parlamentarische Maschinerie aussehen müsste. Ich glaube, dass Architektur tatsächlich ein Medium gesellschaftlicher Veränderungen darstellt, wenn auch ein relativ zähes und langsames. Architektur ist in meinem Verständnis nicht nur Kulisse und nicht nur Spiegel der Gesellschaft, sondern es ist ein Medium, in dem die Gesellschaft sich ausdrückt. Das aktuelle Ziel der österreichischen Politik ist: möglichst keine Veränderung; und das drückt sich auch in der Art und Weise aus, wie mit diesem Sanierungsprozess umgegangen wird, der de facto ein massiver Umbauprozess ist: Nach außen wird die Illusion verkauft, dass alles bleibt wie es ist – man pflegt das Parlament als Bau-juwel von Theophil Hansen und alles andere läuft unter der Bezeichnung kleinere Maßnahmen. Dabei werfen gerade letztere die entscheidenden Fragen auf: Wie geht man in Zukunft hinein in dieses Gebäude als Bürger und Bürgerin? Wie bringe ich eine Arbeitsatmosphäre zustande, die nicht im 19. Jahrhundert oder den 1950er Jahren steckt, sondern modernen Anforderungen entspricht? Das sind wichtige Fragen, die in der Öffentlichkeit gar nicht gestellt werden.
Inwiefern will diese Ausstellung selbst eine Aussage über den Zustand der Institution Parlament treffen?
Wir arbeiten hier mit dem Medium der Ausstellung, es ist keine Konferenz oder Publikation. Was wir versucht haben, ist den Übergang vom Monument zum Ornament darzustellen. Wir bauen diese Modelle im Maßstab 1:500, aber wir stellen sie nicht wie üblich aus, sondern hängen sie wie Schmetterlinge an die Wand. Damit verändern sie sich, es entsteht ein Effekt, als ob die Wand sich aufblähen würde. Die Modelle werden ornamental und darin steckt natürlich auch eine Botschaft von uns als Kuratoren: Man könnte zu überlegen beginnen, wie viel Ornament in dieser Institution Parlament steckt und wie viel reale Macht. Damit will ich nicht sagen, dass alles Ornament ist, aber es ist sehr viel mehr Ornament als noch vor 20 Jahren. Das hat gute Gründe. Das Nachdenken über supranationale Strukturen, die getragen werden von den nationalen Strukturen, wäre das eigentliche Thema, das uns in den nächsten 20 Jahren beschäftigen sollte.
Ein wenig klingt das auch in der Gegenüberstellung der zwei Projekte von Coop Himmelb(l)au an, die ebenfalls präsentiert werden: Zum einen der Entwurf für das albanische Parlament in Tirana, dessen Realisierung auf Eis liegt, zum anderen das Konferenzzentrum in Dalian/China, eine asiatische Ausgabe des Weltwirtschaftsforums Davos.
Das Weltwirtschaftsforum in Davos ist keine politisch legitimierte Struktur, besitzt aber enorme Macht, die von Politikern auch genutzt wird. Die tauchen dort auch reihenweise auf, treffen auf andere Menschen, und natürlich werden dort Netzwerke geknüpft, Entscheidungen vorbereitet und getroffen, die über das Nationalstaatliche deutlich hinausgehen. Ich finde in diesem Zusammenhang den Begriff des »Davos Man«, geprägt durch den Politikwissenschaftler Samuel Huntington, sehr interessant: Die Beschreibung einer eigenen Spezies, die keine nationale Grenzen kennt und sich den Nationen auch nicht verantwortlich fühlt, deren Interesse darin liegt, das Kapital in alle Richtungen hin und her zu verschieben. Es ist uns wichtig gewesen, das in dieser Ausstellung zu zeigen und auch die Dimension sichtbar zu machen, in der dieses Gebäude verwirklicht worden ist. Das ist natürlich ein Versuch, etwas auszudrücken.dérive, Mo., 2014.04.07
07. April 2014 Christian Kühn
Stadt der Gewinner, Stadt der Verlierer
Hamburg, die Perle an der Elbe, das Tor zur Welt, die Hafenstadt mit Metropolanspruch. Hamburg ist rau, aber schön – verregnet, aber schön – rot, aber schön.
Soweit die Klischees und Gemütsbewegungen, die mit der Hansestadt verbunden werden. Hamburg ist aber auch: eine Stadt, in der die Schere zwischen Reichtum und Armut extrem weit auseinander klafft. Tiefe Spaltungen bei Einkommen und Vermögen, bei Chancen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt und im Gesundheitswesen, ungleich verteilter Zugang zu (Aus-)Bildung, Pflege, Ernährung und, wie auch der Klappentext des Buches verrät, Spaltungen „zwischen den Geschlechtern, im Bereich der Migration, innerhalb der Generationen sowie zwischen sozialen Schichten und Klassen – und in den Stadtteilen und Quartieren“ kennzeichnen den städtischen Alltag. Im bundesweiten Vergleich der residentiellen Segregation nimmt Hamburg regelmäßig einen der obersten Plätze ein: Arm und Reich, diese Gegensätze liegen hier dicht beieinander.
Die zunehmende räumliche und soziale Polarisierung schafft neue urbane (Armuts-)Realitäten innerhalb der Hansestadt, die sich oftmals auch räumlich lokalisieren lassen. Aus dem Stadtgeflecht werden diese Problemstadtteile und –quartiere herausgeschält, definiert und bearbeitbar gemacht für die Stadtentwicklungspolitik.
Diese setzt in Hamburg nur fragmentär an – bisweilen gelingt es gar nicht, Armut und soziale Spaltung nachhaltig zu bekämpfen – und ist zu stark auf die Stärkung der lokalen Wirtschaft ausgerichtet, konstatieren die AutorInnen des Buches Hamburg: Gespaltene Stadt? Soziale Entwicklungen in der Metropole und fordern mehr soziale Gerechtigkeit, zivilgesellschaftliches Engagement, politische Regulierungen und eine gezielte Armutsbekämpfung.
Das Buch, das schon auf seinem Umschlag die Frage: „Warum ist die Metropole Hamburg trotz des Wirtschaftsaufschwungs der letzten Zeit sozial gespalten?“ aufwirft, versucht in elf Texten aktuelle Tendenzen und Entwicklungen in den Bereichen Armut, Chancengleichheit, soziale Verdrängung und Stadtentwicklungspolitik darzustellen und den aktuellen Forschungsstand zum Thema zu fassen.
Herausgeber des Sammelbandes sind Gerd Pohl (Sozialwirt und Soziologe) und Klaus Wicher (Betriebswirt und Handelslehrer), die zwei Jahre zuvor den Band Armes Reiches Hamburg –
in dem sie bereits auf die sozialen Schieflagen und Fehlentwicklungen in der Stadt „mit den meisten Millionären Deutschlands“ eingingen – aufgelegt haben.
Nicht nur thematisch bietet der Sammelband einen Querschnitt deutschlandweit relevanter sozialpolitischer Probleme; auch die Perspektiven und Standpunkte der einzelnen Texte sind von unterschiedlicher Qualität, was aufgrund der verschiedenen Hintergründe der AutorInnen jedoch wenig überrascht.
Unter der Überschrift „Kalkulierbare Segregation?“ beleuchtet Simon Günther, Professor für Sozialwissenschaften/Sozialpolitik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg/HAW, drei Perspektiven der sozialräumlichen Polarisierung (Sozialstatistik, Wohnungsmarkt, Integrationsleistung der Wohnquartiere), erläutert Eckpunkte einer sozialen Stadtentwicklung und versteht seinen Text als Plädoyer „für eine soziale Stadtpolitik [...], die ihr Verhältnis zur residentiellen Segregation klärt und sich nicht mit der oberflächlichen Bearbeitung von Symptomen zufrieden gibt“.
Der Text von Laura Crcic, Cordula Tillmann, Nicole Wegener und Johanna Wessels (alle im Arbeitskreis Angewandte Sozialpolitik der HAW) zu Menschen in Erwerbsarmut hingegen nimmt insbesondere deren Lebenslagen, die Armutssituation und Teilhabechancen am Wohnungsmarkt in den Blick und versucht die Frage zu klären, wie diese verbessert werden können.
Im Beitrag „Mittelschicht in Abstiegsangst?!“ der sozialpolitischen Sprecherin der Grünen Bürgerschaftsfraktion Katharina Fegebank setzt sich die Autorin zunächst neutral mit Ängsten vor Armut und Statusverlust auseinander, bewirbt in abschließenden Kapiteln jedoch ihr Parteiprogramm. Auch Heike Sudmanns (Sprecherin der Bürgerschaftsfraktion Die Linke für Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnungspolitik) Analyse der Leitbilder der Stadt Hamburg seit 1983 und deren Zusammenhangs mit den Entwicklungen des Wohnungsmarktes und den Aufwertungs- und Verdrängungsprozessen in Hamburg ist politisch gefärbt und übt massive Kritik an der Stadtentwicklung des SPD-Senats.
Gerd Pohls Ausführungen zu Ernährungsarmut betrachten diese aus einer wissenschaftlichen Perspektive – der Sozialwissenschaftler übt Kritik an Hamburgs „unsozialer Sparpolitik“. Ingrid Breckner, Professorin für Stadt- und Regionalsoziologie an der HafenCity Universität Hamburg/HCU, ruft in ihrem Beitrag zu Effekten auf Spaltungsprozesse, die vom Stadtteil HafenCity ausgehen, zu konstruktiver und offener Kritik auf. Und Marion Fisch fordert eine sozial orientierte Stadtteilpolitik auch für den Osten Hamburgs.
Insgesamt liefert der Sammelband, der außerdem noch auf die Themen Sozialstaatsgebot und Schuldenbremse, seniorengerechte Stadt, Chancengerechtigkeit in der Bildung und soziale Verdrängung in Hamburg-St. Georg eingeht, einen fundierten Überblick über die Themen und Probleme der Stadtteil- und Sozialpolitik in Hamburg.
Teilweise ist jedoch die Grenze zwischen wissenschaftlicher Auseinandersetzung und Information, eigener Meinung und politischen Zielen schwer zu definieren. Dennoch zeugen die Texte von einem (Armuts-)Problem, das in Hamburg nicht erst seit der letzten Finanzkrise Blüten treibt und auf unterschiedlichen Ebenen wahrgenommen wird. Die Verbindung dieser Perspektiven innerhalb eines Bandes macht definitiv deutlich, dass es Veränderungen und neuer Wege in der Stadtpolitik und -entwicklung Hamburgs bedarf, um alle BewohnerInnen an der Stadt teilhaben zu lassen.
Gerd Pohl, Klaus Wicher (Hg.) Hamburg: Gespaltene Stadt?
Soziale Entwicklungen in der Metropole Hamburg: VSA, 2013
204 Seiten, EUR 16.80dérive, Mo., 2014.04.07
07. April 2014 Katharina Held