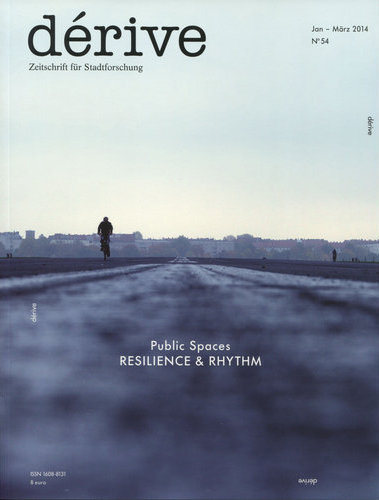Editorial
Zwei Monate sind seit der 4. Ausgabe unseres urbanize!-Festivals schon wieder vergangen und während wir noch von Citopia träumen, beschäftigen wir uns im Schwerpunkt dieser Ausgabe mit öffentlichen Räumen als »spatial catalysts for social change, seeking to foster an understanding of robustness of places by revisiting the resilience debate through the focus on rhythm.« wie Aglaée Degros, Sabine Knierbein und Ali Madanipour, die RedakteurInnen des Schwerpunkts, in ihrem Einleitungsartikel schreiben.
Resilience hat als Begriff seit einiger Zeit ja eine bemerkenswerte Konjunktur zu verzeichnen. Ursprünglich aus den Naturwissenschaften stammend, macht Resilience als Konzept nun in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Karriere und ist – wie obiges Zitat andeutet – nicht ganz unumstritten. Von politisch Verantwortlichen wird Resilience gerne als Allheilmittel angesehen und von manchen nicht zuletzt deswegen angepriesen, um den Rückzug des Staates zu rechtfertigen und die Verantwortung der Kommunen abzuschieben. Mehr darüber und über ein ganz konkretes Brüsseler Beispiel (Kessels’ space) erfahren Sie im Einleitungsartikel zum Schwerpunkt.
Um der Debatte über Resilience eine andere Perspektive zu geben und der dem Begriff anhaftenden Vorstellung von Kontinuität, Dauer und Wiederherstellung der Verhältnisse etwas entgegenzusetzen, versieht dieser Schwerpunkt den Begriff der Resilience mit der Komponente »Rhythm«. Dabei beziehen sich die AutorInnen des Schwerpunks auf die im Buch Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life posthum erschienenen Thesen Henri Lefebvres.
Die vielfältigen Texte des vorliegenden Schwerpunktes beschreiben und analysieren nicht nur unterschiedliche Situationen, sie rücken dafür auch jeweils eine andere Stadt ins Zentrum der Betrachtung. So beginnt die Reise in Brüssel und bei den Geschehnissen rund um Kessels’ space, bevor der Atlantik überquert wird, um mit Stéphane Tonnelat am Pier 84 in Manhattan zu ankern. Zurück in Europa geht es an den Schauplatz Athen, wo Richard Woditsch die beeindruckende Adaptionsfähigkeit der Polykatoikia bzw. Le Corbusiers Maison Dom-ino analysiert. Von dort reisen wir weiter auf das Tempelhofer Feld in Berlin, dessen Atmosphäre Nikolai Roskamm mittels eines Fotoessays visuell einfängt. In Budapest drängelte sich die Népszínház utca als Studienobjekt geradezu auf, wie Ian Cook in seinem Beitrag schreibt. Seine Studie ist schlussendlich eine Art Liebeserklärung an die Straße und ihre Menschen geworden. Die vorletzte Station der urbanen Forschungsreise bildet Istanbul. Im Zentrum des Beitrags von Susanne Prehl and Senem Zeybekoglu Sadri steht der Versuch, der Erdbebengefahr in der Megacity zu begegnen, was durch den Immobilienboom nicht gerade erleichtert wird. Der Abschluss des umfangreichen Schwerpunkts findet in Priština statt. Karin Norman zeigt eine Stadt, deren Bevölkerung mit Kriegszerstörung, Arbeitslosigkeit, Migration und der preistreibenden Anwesenheit der Internationals konfrontiert ist. Sie beschreibt die ganz unterschiedlichen Strategien – im Speziellen auch jene der Kinder – den Alltag zu bewältigen und verweist auf die vielen Schichtungen der wechselhaften Geschichte der Stadt.
Das Kunstinsert dieser Ausgabe stammt von Martin Krenn, dessen Arbeiten wir in dérive schon öfter vorgestellt haben. Thema seines als World’s End betitelten Beitrags ist ein Ort in Nordirland, der auf Landkarten nur als weißer Fleck existiert, weil dort die britische Armee seit Jahrzehnten stationiert ist.
Der Magazinteil bringt nach langer Zeit wieder einmal einen literarischen Text. Wir freuen uns über den Abdruck eines Auszugs aus Thomas Ballhausens jüngst erschienenem Roman Lob der Brandstifterin. Der ethnographische Essay von Robert Rothmann über Architektur, Graffiti und Überwachung setzt sich in Bild und Text mit jenen Nischenorten in Wien auseinander, die sich durch das Vor- und Zurückspringen der alten Häuserfluchten ergeben. Das Thema von Peter Neitzkes Text ist eine Straßenbeobachtung ganz anderer Art: Er beschreibt sozusagen eine Beobachtung der Nicht-Beobachtung – verursacht durch den ständigen und allgegenwärtigen Blick auf das Smartphone und seine virtuell vermittelte Wirklichkeit.
Angeblich, und wie wir meinen völlig überflüssigerweise, gibt es sogar Stadterforschungs-Apps, die manche Menschen offenbar benötigen, um sich durch die Stadt treiben zu lassen. Wir setzten hier klar auf analog und haben die Utensilien zur Durchführung des von uns entwickelten Stadterforschungsspiels laboratoire dérive in einen handlichen Spiele-Karton gepackt. 50 Stück der in Handarbeit produzierten laboratoire dérive Edition legen wir auf – komplett old school und Stück für Stück im dérive-headquarter hergestellt. Wenn Sie eines davon zusammen mit einem Jahres-Abonnement zum wohlfeilen Preis von 39 Euro (plus Versandkosten) erwerben wollen, dann schreiben Sie uns – schnell.
Wie vorteilhaft es immer wieder ist, dérive-Abonnent zu sein, zeigt sich diesmal an einem besonderen Extra, das alle AbonnentInnen als Geschenk bekommen haben: Ein Exemplar der Publikation Urbanity – The Discreet Symptoms of Privatization and the Loss of Urbanity mit Beiträgen von Slavoj Žižek, Jennifer Friedlander, Robert Pfaller, Elke Krasny, u.v.m. Sollten Sie Ihr langgehegtes Vorhaben ein dérive-Abo zu bestellen jetzt in die Tat umsetzen wollen, werfen Sie einen Blick auf die nächste Seite. Wenn Sie zusätzlich planen Ihre dérive-Sammlung zu vervollständigen: Bis Ende Jänner gibt es 6 Hefte Ihrer Wahl um sensationelle 25 Euro (plus Versandkosten), ausgenommen sind natürlich die vergriffenen und fast – vergriffenen Hefte 3, 10, 14, 23, 25, 30, 31, 37, 39, 40/41, 46, 49, 50. Nun aber genug der Werbedurchsagen, Sie wissen, was Sie zu tun haben.
Und wir?
Wir wünschen Ihnen ein gutes, neues Jahr!
Christoph Laimer, Elke Rauth