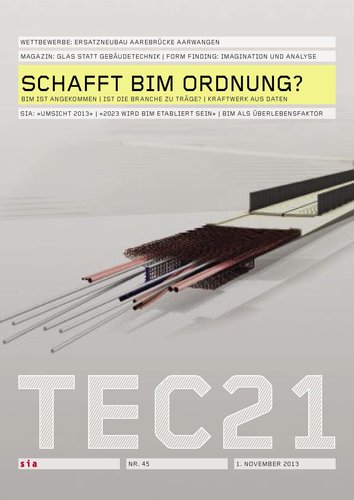Editorial
Diese Ausgabe begann mit einem Chaos, einem geordneten zwar, aber dennoch: An der Wand unseres Büros klebten viele blassgelbe Post-its, von Hand beschriftet. Mit analoger Heftplanung versuchten wir, ein digitales Thema in den Griff zu bekommen: Was ist dieses BIM überhaupt? Ausformuliert heisst es «Building Information Modeling» – aber das hilft noch nicht wirklich weiter. Was genau kann es? Wer benutzt es in der Schweiz und wofür?
Die Argumente, die für die ganzheitliche digitale Planung sprechen, sind vielfältig: Bei der Jahrestagung der Berufsgruppe Technik des SIA bemängelten Auftraggeber wie Betreiber die Qualität der Pläne fertiger Bauwerke – sie taugten nur teilweise für ein effizientes Facility Management. Weil General- oder Totalunternehmungen auch dank digitalen Technologien ihre Planungen wirtschaftlicher organisieren und Projekte hinsichtlich der Kosten optimieren, laufen sie traditionellen Planungsbüros – die oft einen grösseren Gestaltungswillen einbringen würden – vor allem bei Grossbauten den Rang ab. Dauernde Normenänderungen verlangen geradezu nach beschleunigten Bauprozessen. Die Baubranche hat bislang bei Weitem nicht im selben Masse von neuen digitalen Werkzeugen profitiert und an Effizienz zugelegt wie andere Wirtschaftszweige. Ein Grund hierfür dürfte sein, dass Normen und Regelungen zu BIM noch fehlen.
Aber es drängt sich auch der Verdacht auf, dass verschiedene Planer eine Art «Vogel-Strauss-Taktik» verfolgen, wenn es um BIM geht. Dabei verspricht die Technologie einige Erleichterungen, die auf der Wunschliste vieler Planer stehen dürften; ein Beispiel ist die Automatisierung von Routineaufgaben, sodass mehr Zeit und Energie für Gestaltung und Planung bleibt. Das sind verlockende Aussichten. Wieso also hat sich die neue Art des digitalen Planens in der Schweiz bislang nicht flächendeckend durchgesetzt, obwohl sie angesichts des mittlerweile chronischen Personalmangels und immer komplexer werdender technischer Vorgaben eine hilfreiche Alternative zu aktuellen Arbeitsweisen wäre? Dieser Frage geht ein Gespräch verschiedener Baufachleute nach, die sich bereits mit digitalen Bauwerksmodellen beschäftigt haben. Einer der Interviewten, Jobst Willers, ist nicht nur Gebäudetechniker, sondern auch Präsident der SIA-Berufsgruppe Technik. In dieser Funktion antwortet er auf den SIA-Seiten auf Fragen zur Zukunft der Technologie. Und schliesslich erläutert ein im Bau befindliches Beispiel, das Kraftwerk Hagneck am Bielersee, welche Potenziale BIM für die Zusammenarbeit der verschiedenen Planer und Gewerke bringt.
Barbara Hallmann, Daniela Dietsche
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Ersatzneubau Aarebrücke Aarwangen
09 MAGAZIN
Glas statt Gebäudetechnik | Imagination und Analyse | Struktur als Gebäude
16 BIM IST ANGEKOMMEN
Manfred Breit
Was ist BIM und welche Chancen bietet es? Wo liegen die Stolpersteine? Und macht die digitale Planung die Zusammenarbeit der einzelnen Planer wirklich einfacher?
20 IIST DIE BRANCHE ZU TRÄGE
Barbara Hallmann und Daniela Dietsche
Skeptiker halten BIM harte Argumente entgegen – zum Beispiel, die digitale Planung passe nicht in die Schweiz. Vier Praktiker antworten.
23 KRAFTWERK AUS DATEN
Barbara Hallmann
BIM vereinfacht, automatisiert und prüft. Am Beispiel des Kraftwerks Hagneck am Bielersee sind die Potenziale digitaler Modelle erkennbar.
27 SIA
Auszeichnungsfeier «Umsicht 2013» | SIA-International | «2023 wird BIM etabliert sein» | BIM als Überlebensfaktor | Veranstaltungen
33 PRODUKTE
Tekla | Graphisoft | Autodesk | Nemetschek Allplan
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
BIM ist angekommen
Seit einigen Jahren taucht der Begriff immer wieder auf – und doch bleibt er unklar: Building Information Modeling, kurz BIM. Ist es lediglich eine neue Planungssoftware? Was genau kann es, wozu dient es? Braucht man es wirklich? Doch nun ist in Ausschreibungen beispielsweise im Spitalbau auch in der Schweiz die Position eines BIM-Koordinators enthalten. Der Leiter des CAS Digitales Bauen an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Manfred Breit, erläutert die Grundlagen des Building Information Modeling.
Was ist BIM? Einfach gesprochen, handelt es sich um Bauinformationsmodelle oder um die Tätigkeit, Bauinformationen digital zu modellieren. BIM bietet die Grundlage für ein signifikant besseres Informationsmanagement über den gesamten Lebenszyklus von Bauwerken. BIM verbindet Menschen, Prozesse und Technologien. Dank BIM können Entscheidungen wesentlich früher im Projekt getroffen werden, und zwar auf der Basis verlässlicher Informationen. Das Ziel ist eine neue Form der Kommunikation zwischen den am Bau Beteiligten, sodass Informationen zum grössten Teil über digitale Bauwerksmodelle ausgetauscht werden. BIM ist die erste Technologie für das Bauwesen, die Daten und Visualisierung verbindet. Die Visualisierung bildet die soziale Kommunikationsschnittstelle für die verschiedenen am Projekt Beteiligten, von der Bauherrschaft über die einzelnen Planer und Unternehmer bis hin zu den Betreibern und Nutzern. Über das gemeinsame Sehen, Explorieren und Verstehen von BIM lässt sich das Projekt von den Beteiligten gemeinsam entwickeln, bewerten und koordinieren. Die Daten bilden dagegen die Schnittstelle von den Modellierungswerkzeugen zu denverschiedenen Design-, Ingenieur-, Projektsteuerungs- und Managementsystemen und ermöglichen Analysen, Simulationen, Prognosen, Verifizierungen und Validierungen.
Mit traditionellen CAD-Programmen wurde im Prinzip nur die Arbeit vom Zeichenbrett in den Computer verlagert, die Abläufe wie das Erstellen und Nachführen von Grundrissen, Ansichten, Schnitten und Details sind gleich geblieben oder haben sich nur wenig verändert. Dagegen werden mit BIM nicht nur die gestalterischen Ausprägungen modelliert, sondern auch die gewünschten Eigenschaften, wie Nutzbarkeit, Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz oder Nachhaltigkeit. Man konzipiert, entwirft, plant, baut, koordiniert und ändert gemeinsam virtuell mit Informationssystemen und sucht mit Simulationen nach optimierten Lösungen. Gebaut wird anschliessend nach dem getesteten Modell, weitgehend ohne unliebsame Überraschungen. Nach der Bauübergabe steht das 3-D-BIM mit allen notwendigen Informationen – genauso wie das Projekt gebaut wurde – für die Bewirtschaftung und das Facility-Management zur Verfügung. Bauherren sollten daher mit Vorteil gleich zwei Bauwerke bestellen, zusätzlich zum realen auch ein digitales.
Der Nutzen von BIM
Der Nutzen von BIM wurde in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen. So hat die Anwendung von BIM folgende Vorteile gezeigt:
– bessere Performance der Bauwerke, grössere Genauigkeit und Qualität
– niedrigere Kosten
– kürzere Fristen, verlässliche Termine
– verbesserte Kommunikation
– verbesserte Sicherheit auf der Baustelle
In den USA, Skandinavien, Australien, Singapur und weiteren Ländern gehört BIM bereits zur täglichen Praxis vieler Büros und Baufirmen. In Dänemark setzte sich die Planung mit BIM ab 2008 durch, da seit diesem Zeitpunkt für alle öffentlichen Bauten über 4 Mio. Euro die Verwendung von BIM gesetzlich vorgeschrieben ist. In den Niederlanden müssen seit 2011 bestimmte Bauten, die im Public-Private-Partnership erstellt sind, mit BIM geplant werden. Und in Grossbritannien läuft derzeit eine Regierungsinitiative, die die britische Bauindustrie innovativer und effizienter machen soll. Bis 2016 müssen bei allen öffentlichen Bauten sogenannte «as-built» 3-D-BIMs mit allen Projektinformationen bereitgestellt werden. Auch in Deutschland und Frankreich gewinnt BIM in der Baupraxis an Bedeutung.
Digitale Bauinformationsmodelle als Kern der Planungsarbeit
BIMs können in allen Phasen des Planungs-, Bau- und Nutzungsprozesses auf unterschiedlichste Weise eingesetzt werden. Passend zum Verwendungszweck benötigen wir Modelle mit unterschiedlicher Struktur und Leistungsfähigkeit. Die systematische Gestaltung der Arbeitsabläufe bei der Modellerstellung und der Modellnutzung bestimmt den Erfolg des BIM-Einsatzes.
Je nach Aufbau und Werkzeug besitzen digitale Modelle spezifische Fähigkeiten, die Planungen wesentlich beschleunigen, Entscheidungen eine breitere Grundlage und damit Sicherheit geben, die Kommunikation innerhalb des Projekts und nach aussen unterstützen oder den Rahmen möglicher Lösungen ausweiten. Sie können für Simulationen, Visualisierungen, Variantenbildung und für eine Vielzahl automatisierter Arbeitsschritte eingesetzt werden. Besonders vielfältig sind die Möglichkeiten der Automatisierung. Das Spektrum reicht von einfachen Dingen, wie der Erzeugung von Massenauszügen bis zur parametrisch gesteuerten Erzeugung komplexer Formen. Der Erfolg resultiert jedoch nicht aus der Verwendung möglichst vieler Hilfsmittel, sondern aus dem gezielten Einsatz geeigneter Verfahren für spezifische Aufgaben.
Zusammenarbeit auf der Grundlage von digitalen Technologien Digitale Bauwerksmodelle eröffnen neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Diese reichen vom einfachen Datenaustausch über die zentrale Bewirtschaftung von Modellen bis zur simultanen Entwicklung. Damit sind aber auch Probleme verbunden, die herkömmlichen Planungsprozessen fremd sind. Zusammenarbeit auf der Grundlage digitaler Modelle erfordert einen strikten organisatorischen Rahmen und formal standardisierte Prozesse. Kostenplanung und Kostensteuerung sind Beispiele für die Anwendung digitaler Bauwerksmodelle mit hohem und offensichtlichem Nutzen. Bauwerksmodelle können fast alle kostenrelevanten Daten, insbesondere in Mengen, liefern, sofern sie richtig aufgebaut sind. In Verbindung mit entsprechenden Datenbanken sind präzise Kostenvorhersagen möglich. Der praktische Nutzen ist aber an einige Voraussetzungen gebunden: Kostenmodelle müssen so aufgebaut sein, dass sie schon in frühen Planungsphasen – bevor alle Konstruktionslösungen definiert sind – relevante Informationen liefern und Entscheidungsprozesse unterstützen. Sie müssen nicht nur der Kostenplanung dienen, sondern auch der Kostensteuerung, und vor allem sollen sie helfen, Erfahrungen systematisch zu sammeln und in künftige Projekte einzubringen.
Die unterbrechungsfreie digitale Kette vom Computer des Entwerfers bis zur CNC-Produk-tionsanlage wird als Vision oft und intensiv diskutiert. Beeindruckende Experimente weisen auf ein hohes Potenzial solch automatisierter Produktionsprozesse im Bauwesen hin. Was im Modellbau problemlos funktioniert, stösst in der Baupraxis aber sehr rasch an Grenzen. Wer ein Bauprojekt plant, hat keinen Zugriff auf die Produktionsanlagen, und wer den Produktionsprozess steuert, hat selten Einfluss auf die Planung. Das Bauwesen ist traditionell nach Gewerken organisiert, und die Planung koordiniert die Produktion. Nun haben Planer allerdings kaum Zugriff auf das Know-how der Unternehmer und diese wiederum nicht auf das Wissen der Komponentenhersteller. Neuere Planungs- und Beschaffungsmethoden versuchen, diesen Mangel auszugleichen. BIM und strukturierte Prozesse können diesen Ansätzen zum Durchbruch verhelfen.
Auf die Prozesse kommt es an
BIM berühren alle Phasen im Lebenszyklus von Immobilien. Die Technik ist deshalb im Gesamtrahmen des Planungs-, Bau- und Nutzungsprozesses zu betrachten. Sie kann beispielsweise dem Auftraggeber helfen, die Machbarkeit seines Vorhabens zu überprüfen und daraus präzise Anforderungen an die beauftragten Planer zu formulieren. In der Projektierung erleichtern BIM die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fachplanern. Mit angepassten Beschaffungsmethoden wird es möglich, das Know-how der ausführenden Unternehmer frühzeitig in die Planung einfliessen zu lassen. Im Betrieb schliesslich kann ein digitales Bauwerksmodell alle Belange des Facility-Managements unterstützen, von der strategischen Raumplanung über das Energiemanagement bis zur Unterhaltsplanung.
Diese Potenziale nutzbar machen heisst aber in den meisten Fällen, etablierte Prozesse zu modifizieren, Arbeitsmethoden oder einfache Gewohnheiten zu verändern. Zwischen digitalen Modellierungstechniken und adäquaten Arbeitsprozessen besteht ein enger Zusammenhang. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit neuzeitlichen Problemlösungsmethoden und Produktentwicklungsprozessen. Neue Technologien werden nur dann einen Mehrwert stiften, wenn sie mit den Arbeitsweisen, der Kultur und den Prozessen der Unternehmen übereinstimmen. Die Entscheidung für den Einsatz neuer Methoden und Verfahren führt zu Veränderung, in fast allen Fällen. Das Management von Veränderungen in Planungs- und Bauunternehmen ist eine notwendige Voraussetzung und eine Schlüsselkom-petenz, um den Schwierigkeiten und Risiken bei der Einführung neuer Technologien zu begegnen und die gebotenen Chancen nutzen zu können. Wie die neuen Prozesse aussehen können, zeigen nachfolgend einige Beispiele aus dem Ausland.
Das Architekturbüro Sera Architects Inc. aus Portland, Oregon, untersuchte den Zeitaufwand für die Planung und den Bau von 20 bereits abgeschlossenen Wohn- und Geschäftsbauten. Die Projektabwicklungsmethoden reichen dabei von der alten 2-D-CAD-Welt mit getrennt arbeitenden Disziplinen (Typ A) über die BIM-Anwendung nur in der Planung (Typ B) bis zur hoch kollaborativen integrierten Projektabwicklung, die auch die Arbeitsvorbereitung und Vorfertigung auf der Basis eines dreidimensionalen Bauwerksmodells mit BIM beinhaltet (Typ C). Die Planung nach Typ C erlaubte massive Einsparungen bei der Entwurfs- und Bauzeit, was sicher auch an der geringeren Zahl von Informations-, Klärungs- und Änderungsaufträgen lag (Abb. 01). Und nicht zuletzt: Die Anzahl der E-Mails rund um die Projekte sank massiv. Dabei erscheint bemerkenswert, dass sogar die Planung nach Typ B, auch als «little bim» bezeichnet, signifikante ökonomische Auswirkungen zeigt: Wenn nur eine der am Bau beteiligten Disziplinen – in diesem Fall das Architekturbüro – mit BIM arbeitete, resultierte daraus eine beachtliche Reduktion der Planungs- und Bauzeit. Ein weiteres Beispiel: Beim Bau eines Spitals in Castro Valley nahe San Francisco einigten sich die Beteiligten auf eine neue Form der Zusammenarbeit. Grundlage war ein gemeinsamer Vertrag aller elf Planungs- und Ausführungsfirmen mit der Bauherrschaft. Er regelte die Projektabwicklung und die geteilte Verantwortung für die Risiken sowie die Partizipation am Gewinn. In Kalifornien müssen Spitäler hohe Auflagen erfüllen und auch bei schweren Erdbeben zuverlässig funktionieren. Um die behördlichen Anforderungen einzuhalten, war schon in der Planung eine hohe Präzision notwendig: Buchstäblich alles, was grösser als ein Zentimeter war, wurde mit BIM entworfen, modelliert und koordiniert. Die Beschaffung, Fabrikation und Installation gab man erst auf der Basis vollständiger Kosten- und Zeitplaninformationen frei; so minimierte sich das Risiko für Änderungs- und Ausbesserungsarbeiten. Und man konnte der Bauherrschaft den Leistungsumfang, das Budget und den Zeitplan verlässlich zusichern. Dies gelang nur, weil in der Planung erstmalig neue Methoden – wie BIM-basiertes «Design to Cost» – zum Einsatz kamen. Das komplexe, insgesamt 320 Millionen Dollar teure Spital konnte 2012 nach dreieinhalbjähriger Bauzeit termingerecht übergeben werden – und zwar ohne wesentliche Kompromisse hinsichtlich der Leistungsvorgaben und ohne Gewinneinbussen für die Beteiligten. Für eine solch hoch kollaborative Zusammenarbeit hat das American Institute of Architecture (AIA) 2010 einen Leitfaden für das sogenannte «Integrated Project Delivery (IPD)» samt Musterverträgen herausgegeben.
Literatur:
Harvey M. Bernstein Ed., The Business Value of BIM in North America: Multi-Year Trend Analysis and User Ratings: (2007–2012). Smart Market Report, McGraw-Hill Construction, New York 2012.
Martin Fischer, You Thought BIM was Innovative – You Ain’t Seen Nothing Yet: A Peek over the Construction Technology Horizon. Invited Keynote Paper, Forum for the Construction Industry, American Bar Association, 2013 Annual Meeting, Dana Point (CA) 2013.
Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Liston: BIM Handbook. A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors. Wiley Publishing, Hoboken 2011.
Willibald Günthner, André Borrmann: Digitale Baustelle – innovativer Planen, effizienter Ausführen: Werkzeuge und Methoden für das Bauen im 21. Jahrhundert. Springer VDI, Düsseldorf 2011.TEC21, Fr., 2013.11.01
01. November 2013 Manfred Breit
Ist die Branche zu träge?
Ganz im Unterschied zu den USA oder Skandinavien hat die digitale Planungsmethode Building Information Modeling (BIM) in der Schweiz bisher noch nicht recht Fuss gefasst. Warum ist das so, und was müsste sich ändern? TEC21 hat Vertreter verschiedener Fachrichtungen mit sechs Thesen konfrontiert, die Kritiker gegen BIM anführen. Ein Vertreter aus einem Ingenieurunternehmen, ein Gebäudetechniker, ein Architekt und der Leiter Normen des SIA, die sich allesamt im Alltag mit der Technologie beschäftigen, halten manchmal vehement dagegen – und stimmen manchmal zu.
TEC21: Wir möchten Sie im Gespräch mit verschiedenen Thesen konfrontieren, die man gegen BIM vorbringen könnte. These 1 lautet: BIM lohnt sich nur für komplexe Projekte. Ansonsten ist der Zusatzaufwand zu gross. Was sagen Sie dazu?
Rolf Mielebacher (R. M.): BIM nur für grosse Projekte zu nutzen wäre für den Anfang der falsche Ansatz: Das Projekt ist komplex und die Software nicht ganz einfach. Für den Einstieg ist ein normales Projekt sinnvoll.
Markus Gehri (M. G.): Ich finde, es kann auch bei kleinen Projekten nützen. Auch für ein normales Sechsfamilienhaus müssen viele Nachweise geführt werden – da bringt BIM Vorteile.
Jobst Willers (J. W.): Ich bin überzeugt, BIM wird nur bei komplexen Projekten wie Spitälern oder Industriebauten kommen, weil dort der Lebenszyklusnutzen massiv zum Tragen kommt.
M. G.: Da hat jetzt der Gebäudetechniker gesprochen, der Gebäude mit ausgeklügelter Technologie ausstatten möchte. Aber BIM fängt schon früher an, bei der Schalung, bei den Fenstern. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Sechsfamilienhaus ohne aufwendige Gebäudetechnik mit BIM projektiert wird.
Andreas Derrer (A. D.): Ich finde, nicht die Projektgrösse entscheidet, sondern der Detaillierungsgrad. Bei einem kleinen Ladengeschäft geht es nicht um die gleichen Themen wie bei einem Spital. Das Wichtigste ist für mich immer die Frage nach den Schnittstellen: Wie sammle ich die Informationen, wie bereite ich sie auf, und wie halte ich sie à jour?
R. M.: Gerade bei kleinen Projekten kann BIM Bauprozesse standardisieren. Die Bauwirtschaft möchte immer Unikate erschaffen. BIM könnte bei Käuferausbauten leicht Kosten sparen, wenn man beispielsweise Steckdosen und Wände zusammen verschieben kann, statt aufwendig alles einzeln anzupassen.
TEC21: These 2: Mit BIM entsteht für die Planer ein Zusatzaufwand, der nicht honoriert wird.
J. W.: Unsere bisherige Denkart in sechs SIA-Phasen steht uns im Weg. Wir sind das Arbeiten vom Groben ins Feine gewohnt.
M. G.: Ich glaube, die Leistung wird einfach zeitlich nach vorn verschoben. Im Idealfall entsteht im Vorprojekt bereits ein virtuelles Gebäude, bis hin zur letzten Schraube. Später gleicht sich das aus – sagt man –, weil bei der Realisierung weniger Kosten entstehen. Wie aber dieser Zusatzaufwand am Anfang mit den gesparten Kosten gegen Ende ausgeglichen und aufgeteilt wird, ist noch offen. Einfacher ist die Situation für einen GU oder TU.
J. W.: Ausserhalb dieser Unternehmen sieht es doch so aus: Wir haben oft ein Planerteam von acht oder mehr Ingenieurparteien. Drei davon haben von BIM keine Ahnung. Was macht man mit denen? Der Markt regelt das hoffentlich: Entweder verschwinden die Unkundigen, oder sie wenden BIM an.
A. D.: Viele sind sich nicht recht bewusst, was sie mit BIM erreichen möchten. Bei Spitalprojekten in Kalifornien ist das Modellieren bis zur letzten Schraube unter anderem ein Grund dafür, den Genehmigungsprozess zu beschleunigen – weil der Ort, an dem die Schraube gesetzt wird, Einfluss auf die Erdbebensicherheit der abgehängten Decke hat. Dafür existiert dort eine Norm. Solange wir das in der Schweiz nicht haben, definieren wir selbst, wie detailliert modelliert werden soll – und folglich, welchen Zusatzaufwand wir generieren. Wir sehen das heute als eine Phase des Lernens an, die wir selbst steuern können.
R. M.: Wir haben bei uns jetzt einen BIM-Master angestellt. Die Chance, dass er vom Kunden separat vergütet wird, ist bei null. Man muss diverse Abmachungen treffen und überlegen, wer wann welche Information braucht, damit es für alle ein bisschen einfacher geht. Man bekommt nicht mehr Zeit dank BIM.
M. G.: Es besteht die Gefahr, dass die Bauherrschaft schon im Wettbewerb zu viel erwartet. Manchmal wird zum Beispiel gefordert, dass der behördliche Brandschutznachweis erbracht ist. Dafür muss man bereits im Wettbewerb wissen, welches Gerät eingesetzt wird und wo. Ein grosser Schweizer TU hat mir gesagt, dass bei ihm kein Wettbewerbsentwurf ohne Energienachweis angenommen wird. BIM kann das zwar, aber das bedeutet auch, dass der Aufwand im Wettbewerb quasi beliebig gross werden kann. Wird am Ende doch nicht gebaut, sieht es mit der Honorierung des bereits erbrachten Zusatzaufwands schlecht aus.
TEC21: Die dritte These lautet: Die Kommunikation über BIM zu organisieren passt nicht zu den gewohnten Abläufen in der Schweizer Baubranche mit ihren speziellen Bewilligungs- verfahren.
M. G.: Das ist momentan noch richtig. Die positiven Beispiele für BIM-Projekte kommen derzeit noch aus den USA und Skandinavien, aber dort sind ganz andere Vertragsformen üblich. Der SIA plant ein Arbeitspapier, das hierzulande übliche Zusammenarbeitsmodelle auflistet. Mit dieser Basis kann man nachdenken, wie BIM bei uns Erfolg haben könnte.
R. M.: Für die hiesigen Bauherren ist klar: Das wird heute noch angepasst, auch wenn ich morgen einziehe. Aber wenn du einer Ziegelei sagen kannst, dass du in 18 Monaten baust, bekommst du einen guten Preis. Das ist auch für den Kunden interessant. Nur: Die Gefahr von unzähligen Varianten und Änderungen verschiebt sich mit BIM nach vorn.
M. G.: Da machen unsere Gepflogenheiten ein Problem von BIM deutlich: Bei der Arbeit mit dem Modell muss man Änderungen direkt dort nachführen, bei der Arbeit mit Papierplänen geht das recht unkompliziert mit Rotstift.
TEC21: These vier lautet: BIM behindert im Entwurf, weil die Software zu früh zu viele Informationen verlangt.
M. G.: Die frühe Phase, in der man entwickelt, dürfen wir nicht verlieren. Ein gutes BIM-Programm sollte zulassen, dass ich summarisch anfange und dann ins Detail gehe.
A. D.: Wenn im Wettbewerb verlangt würde, dass man ein Projekt schon in diesem Stadium mit 3-D komplett durchgeplant haben muss, dann wird das für uns zu einem Problem. Aber wenn es nur darum geht, Elemente als 3-D abzuliefern, die ohnehin zu einem Wettbewerbsprogramm gehören, dann geht das schon. Das Problem liegt eher darin, dass man sich anders organisieren muss, wenn man mit BIM statt mit 2-D arbeitet. Aber wir arbeiten in einem ersten Stadium noch immer auch mit Handskizzen.
R. M.: Beim Neubau sehe ich weniger Probleme. BIM ist nur so gut wie die Grundlage. Im Umbau müssen wir bei der Genauigkeit zulegen. Ist der Bestand so gut aufgenommen, dass das Modell funktioniert?
TEC21: These 5: Schweizer Bauherrschaften haben, anders als in Skandinavien oder den USA, kein Interesse an BIM.
J. W.: Wir sind eine träge Branche! Wenn der Bauherr nicht bestellt, passiert nichts. Aber vielleicht kommt jetzt die Wende, wenn selbst Stararchitekten per Stellenanzeige einen BIM-Koordinator suchen. In anderen Ländern verlangt der Gesetzgeber nach der Planung mit BIM. Unsere KBOB für öffentliche Bauten äussert sich vorläufig noch nicht dazu.
M. G.: Die Energiedirektoren könnten Treiber sein, wenn sie beschliessen, dass gewisse Nachweise bereits frühzeitig erbracht werden müssen.
R. M.: Der Druck auf die Branche wird kommen, wenn es sich herumspricht, dass man ein digitales Modell bestellen kann – oder wenn die Facility-Management-Branche darauf drängt. Aber seien wir ehrlich: Die Baubranche könnte diesem Druck auch zuvorkommen.
TEC21: Die letzte These: Vielerorts wird behauptet, die Technologie sei nicht ausgereift.
J. W.: Die Software ist sehr kompliziert. Wir brauchen eine Aus- und Weiterbildung. Die Ausbildung machen zurzeit aber hauptsächlich die Softwarelieferanten.
R. M.: Die Software selbst ist nicht das Problem, sondern ihre Anwendung. Und ich merke: Die Jungen in unserer Firma wollen BIM. Unser BIM-Master kommt aus der Softwareindustrie. Er ist damit beschäftigt, Informationen so zu übersetzen, dass wir sie darstellen können.
A. D.: Ich glaube, die Technologie ist nicht die grosse Frage. Es geht vielmehr darum, wie diese Methode unsere Abläufe neu organisiert. Wie kontrolliere ich das Modell? Und wie findet der Austausch statt? Schicke ich Formate wie pdf und dwg, dann weiss der andere, was er erwarten kann. Aber wenn ich ein Modell schicke? Wie bekommen wir welche Informationen wohin, und wie bekommen wir sie wieder raus? Wir können nicht so weiterarbeiten wie die letzten 20 Jahre, aber die jeweilige spezifische Software der einzelnen Disziplinen muss weiterhin einsetzbar bleiben. Sonst würde BIM eine massive Einschränkung bedeuten. Aber der Zwang zu einer intensiveren Zusammenarbeit und das grössere Vertrauen, das vorausgesetzt wird, könnten noch ein Hindernisgrund für den Einsatz von BIM sein. Denn ich muss meine Daten nicht nur abschicken, sondern mich auch dafür interessieren, wie sie angekommen sind. Kurz: Ich muss die Motivation haben, mich mit dem Blick der anderen Fachplaner darauf einzulassen.
M. G.: Aus meiner Sicht geht die Entwicklung dahin, dass weiterhin mit dem weichen Bleistift entworfen und die Dinge anschliessend im virtuellen Arbeitsraum fixiert werden. An dieser Stelle muss ein Umdenken stattfinden: Das BIM-Modell ist ab einem gewissen Zeitpunkt fix und kann nicht auf der Baustelle wieder verworfen werden. Ich sehe das virtuelle Modell als Zwischenstufe zwischen Handskizze und fertigem Bauwerk. Der Zusatzaufwand, der dafür entsteht, muss sich wieder einspielen, weil die Endphase reibungsloser und fehlerfreier stattfinden kann.TEC21, Fr., 2013.11.01
01. November 2013 Barbara Hallmann, Daniela Dietsche