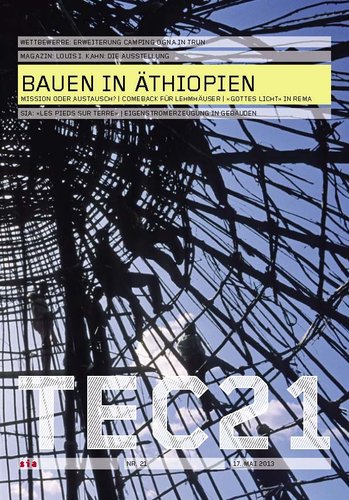Editorial
Wie und wer in der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) Wissen austauscht und welche Faktoren das eine gegenüber dem anderen Projekt auszeichnen, das sind Themen unserer Heftreihe «Wissensaustausch». Bi- und multilaterale Organisationen wie die schweizerische Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) oder die Vereinten Nationen messen die Qualität mittels Monitoringprogrammen. Wie schwierig das ist, zeigt bereits die vergleichsweise einfache Frage nach dem Nutzen einer neuen Strasse: Wie viele Autos darauf fahren, lässt sich zählen, inwieweit sie aber die wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen für einen nahen Markt verbessert, ist weitaus komplexer zu erheben.
Bestimmt aber sind in einem multikulturellen und disziplinären Umfeld Kommunikation und Koordination besonders wichtig.
Fehlentscheide, wie sie die UN-Habitat in Äthiopien beim Bau von Siedlungen weitab von Arbeitsplätzen und Stadtzentren getroffen hat, wären damit zu vermeiden gewesen. Manche europäischen Fachleute halten Holz nach wie vor für einen geeigneten Baustoff in Afrika oder foutieren sich um das Klima. Davon zeugen zahlreiche verglaste Hochhaustürme in afrikanischen Innenstädten, aber auch Projekte wie der in europäischen Architekturzeitschriften viel gerühmte niederländische Botschaftsbau[1] in Addis Abeba, in dem die Angestellten das ganze Jahr hindurch frieren.
Im Gegensatz dazu entsteht die Lehmhausreihe SRDU auf der Grundlage intensiver Zusammenarbeit eines Forscherteams mit äthiopischen Bauern. In ihr verbindet sich europäisches Nachhaltigkeitsdenken mit alten afrikanischen Techniken. Teil des Projekts ist es auch, Akzeptanz zu schaffen für die neuen Lehmbauten – kein einfaches Anliegen auf einem Kontinent, auf dem jeder, der es sich leisten kann, in einem Haus aus Zementbausteinen lebt.
Häufig ist die Motivation europäischer und asiatischer Akteure auch von wirtschaftlichen Interessen gesteuert – oft zum Nachteil für den Städtebau. Im Dorf Rema hingegen installieren äthiopische Techniker in den Häusern ihrer Kunden nach kommerziellen Prinzipien Solar-Home-Systeme. Sie tragen damit zur Verbesserung der Lebensbedingungen bei und zeigen, dass das ohne Unterstützung der EZA möglich ist und sich sogar finanziell lohnen kann.
Danielle Fischer
Anmerkung:
[01] Vgl. Pierijn van der Putt: «Niederländische Botschaft in Addis Abeba, van Gameren-Mastenbroek» in: deutsche bauzeitung, 1/2007, S. 18–27.
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Erweiterung Camping Ogna in Trun GR
12 MAGAZIN
Louis I. Kahn: Die Ausstellung | Korrigendum
16 MISSION ODER AUSTAUSCH?
Danielle Fischer
Bildung ist ein wichtiger Bestandteil der Entwicklungszusammenarbeit. Im Bauwesen Äthiopiens sind die Interessen der einzelnen Akteure sehr unterschiedlich.
19 COMEBACK FÜR LEHMHÄUSER
Elias Yitbarek Alemayehu
Anhand einer Proto-Typologie untersucht die EiABC den Wissensaustausch zwischen allen Beteiligten.
23 «GOTTES LICHT» IN REMA
Danielle Fischer
In einer dörflichen Siedlung hat sich Solartechnologie effizient und kommerziell erfolgreich etabliert.
27 SIA
Neue TV-Sendung: «Les Pieds sur Terre» | Austauschorganisation sucht Firmen | Vernehmlassungen | Eigenstromerzeugung in Gebäuden | Umsetzungspfade Energiestrategie
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Comeback für Lehmhäuser
Ein langjähriges Forschungsprojekt des Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction and City Development (EiABC, vgl. S. 18) befasst sich mit dem Wissensaustausch im ländlichen Hausbau. Eine Typologiereihe, die «Sustainable Rural Dwelling Unit», vermittelt Wissen über lokale Baumaterialien, angepasste Technologien und adäquate Raumaufteilungen an die von der Landwirtschaft lebende Bevölkerung. Die Forschungsgruppe des EiABC arbeitet mit Berufsschulen und Universitäten im Gurage-Gebiet zusammen. Gemeinsam mit Fakultäten, Bauern und Handwerkern werden nun aufgrund erster Forschungsergebnisse akademische Lehrpläne sowie handwerklich-technische Ausbildungen angepasst und entwickelt.
Das seit Jahrhunderten gleich gebaute Haus der Gurage (vgl. Kasten) hat nur einen Raum. Die Wände sind aus Holz und Lehm, das Dach ist strohgedeckt. Nur wer es sich leisten kann, baut separate Häuser für Gäste und Vieh. Ansonsten leben Menschen und Tiere in einem einzigen Raum, der allenfalls durch einen hölzernen Raumteiler getrennt ist (Abb. 1). Krankheiten, die von Vieh auf den Menschen und umgekehrt übertragen werden, sind eine der grössten Gefahren für die Bevölkerung. Allerdings werden sie von den Einwohnern nur selten mit der räumlichen Konstellation in Verbindung gebracht. Der Raum ist meist dunkel und schlecht belüftet, weil er nur über ein kleines Fenster verfügt. Der Rauch der offenen, mit Holz befeuerten Kochstelle, die in der Mitte des Raums liegt, ist wichtig für die Eindämmung von Insekten. Zugleich ist er jedoch schädlich für Augen und Lungen, und man geht davon aus, dass mehr als 80 % der Frauen auf dem Land an Spätfolgen leiden.
Hinzu kommen die negativen Folgen der Abholzung auf den ohnehin nur sehr spärlich vorhandenen Wald. Andererseits zeichnet sich die Gurage-Architektur durch ihre stabile Bauweise und ihren einzigartigen Charakter aus. Eines der Hauptelemente ist die zentrale, schirmförmige Holzkonstruktion, die das Dach trägt. Die zentrale Holzstütze drückt die Einheit der Familie und die Verantwortung des Familienvorstands aus.
Die Gurage fühlen sich ihrem traditionellen Haustyp stark verbunden. Aber nicht nur, weil es an Holz und Stroh fehlt, sondern auch wegen der assoziierten Modernität3 bauen immer mehr Bauern rechteckige Häuser mit Wellblechdach. Das «moderne» Haus hat den Vorteil, dass es schnell fertig und einfach im Unterhalt ist, auch wenn es ihm an Identität und Komfort mangelt. Anhand des SRDU-Projekts soll den Bauern Wissen vermittelt werden, wie sie Häuser erstellen können, die die Vorteile der beiden Haustypen verbinden und gleichzeitig die Gurage-Identität wahren.
Das zentrale Thema für den Wissensaustausch wurde mittels Daten zu räumlichen Aspekten der traditionellen Häuser und in Gesprächen mit Einwohnern von vier Siedlungen eruiert. An dieser Datenerfassung haben 13 Masterstudierende, 70 Studierende im ersten akademischen Grad und sechs Dozierende des EiABC mitgewirkt. Aufgrund ihrer Erkenntnisse entwarfen sie erste alternative Haustypen und daraus resultierende Nachbarschaften, die den sozialen und kulturellen Bedürfnissen der ländlichen Gemeinschaften entsprechen sollen.
Durchs Bauen zum Wissensaustausch
Die auf Basis der zuvor gewonnenen Erkenntnisse vom Forschungsteam entworfene SRDU-Proto-Typologie (Abb. 2) ist als Experiment zu verstehen. Um hygienische Standards einzuführen, sind Wohnbereich und Stall getrennt. Toilette, Dusche und Lagerungsbereiche wurden als aussen liegende Einheiten angefügt, eine Biogasanlage ersetzt die Feuerstelle. So kann der ohnehin anfallende Kuhdung in Kochgas verwandelt und der gesundheitsschädigende Rauch aus der Holzfeuerstelle vermieden werden. Als Baumaterial kamen sonnengetrocknete Lehmziegel für Wände und Bambus fürs Dach zum Einsatz. Die schirmförmige Struktur mit zentraler Stütze, die das Hausdach trägt, wurde in der neuen Konstruktion beibehalten.
Da die Wacholderbäume[2], die traditionell für die Stütze verwendet werden, immer seltener werden, ersetzte das Team sie durch vier gebündelte, lokal erhältliche Eukalyptuspfähle[3]. Es erforderte viel Überzeugungsarbeit, die Bevölkerung von diesem Schritt zu überzeugen und die noch bestehenden Wacholderbäume vor einer weiteren Abholzung zu schützen.
Weil der architektonische Entwurf lediglich eine abstrakte, technische Repräsentation der Wirklichkeit darstellt, diente der praktische Bauprozess als Medium für den Wissensaustausch zwischen Bauern und Forschungsteam. Er lässt sich wie folgt gliedern: Zwischen dem EiABC und lokalen Bauern: Für den Bau der ersten SRDU-Typologie wurden 13 Bauern aus zehn Woredas[4] der Gurage-Zone ausgewählt. Während des Baus wurden die Bauern in die Handlungsabläufe und Überlegungen einbezogen und entwickelten eine kritische Haltung hinsichtlich der Verbesserung traditioneller Häuser. Von ihnen wird erwartet, dass sie bei der Rückkehr in ihr Dorf das Wissen und die handwerklichen Fähigkeiten ausbauen und weitergeben.
Zwischen Bauern verschiedener Regionen: Zu den einzigartigen Aspekte des SRDU-Forschungsprojekts zählt es, dass der Lernprozess nicht nur zwischen den Mitgliedern der Universität und Bauern stattfand, sondern auch zwischen den Bauern aus verschiedenen Regionen. In der Gurage-Zone wird Bambus, obwohl dort sehr verbreitet, noch nicht zur Hausbedachung verwendet. Andererseits wird Bambus in dem weiter südlich gelegenen Gebiet um Chencha für den Bau traditioneller Häuser genutzt. Deshalb wurden während der Bauphase vier Dachbauer von Chencha eingeladen, um ihr Wissen über Bambuskonstruktionen weiterzugeben.
Nach der Fertigstellung der ersten SRDU-Typologie war es für alle Beteiligten einfacher, die Umgestaltung des traditionellen Hauses zu verstehen. Vor Ort und mittels Präsentationen und Diskussionen fanden Überlegungen für eine zweite, verbesserte Typologie statt. Beteiligt waren die Bauern, die wichtigsten Interessenvertreter wie das Bete Gurage Cultural Center (BGCC), die Gurage-Entwicklungsgesellschaft, Vertreter der Ministerien für Stadtentwicklung, Konstruktion und Bildung, nationale und lokale Politiker sowie Prominente und Stammesälteste der Gurage-Zone.
Während die Funktionstrennung, die Nutzung lokaler Materialien und die erstmals in dieser Region eingesetzte, vom Schwesterprojekt SUDU in Addis Abeba übernommene Gewölbestruktur, die das Zwischengeschoss trägt, gewürdigt wurden, kritisierten die meisten Interessenvertreter drei Aspekte des ersten Baus: Erstens wünschte man sich eine traditionellere Rundform, zweitens wurden die vier Eukalyptuspfähle anstelle des einzigen Pfostens und drittens der zu kleine Stall kritisiert. Nachfolgend wurde die zweite SRDU-Typologie (Abb. 05–06) mit einem runden Grundriss entworfen. Die vier Eukalyptuspfähle wurden mit Schnur umwickelt, damit sie eine optische Einheit bildeten, und ein grösserer, mit dem Haupthaus verbundener Stall geplant. Wie zuvor diente der Bau als Plattform für einen praxisorientierten Wissensaustausch mit dem Ziel, die Bauern in den Planungsprozess zu integrieren, damit sie Verantwortungsbewusstsein und Identifikation mit dem Projekt aufbauen konnten.
Adaption, Lehrplan- und Projektentwicklung
Neben der Vermittlung neuer Technologien sollten die Bauern das Wissen in ihre Traditionen aufnehmen und weitere Kombinationen umsetzen. Kurz nach Abschluss der ersten SRDU-Typologie stellten vier Bauern in ihrem Dorf eigene Lehmziegel her. Sie benutzten dafür die Schalungen, die ihnen das Forschungsteam geschenkt hatte. Einer von ihnen plante und baute ganze Raumeinheiten, zum Beispiel eine öffentliche Toilette. Interessant war, dass der Bauer für die Dachbedeckung anstelle von Bambusblättern die Blätter der Zierbanane verwendete und damit das Erlernte auf lokale Bedürfnisse anpasste.
Im nächsten Schritt soll das Forschungsteam nun die Erkenntnisse, die aus dem SRDU-Prozess gewonnen wurden, für die Entwicklung neuer Lehrpläne in der Berufsausbildung umsetzen. Eine Initiative, die Berufsausbildungen regional anpassbar machen will, soll später als leistungsfähiges Instrument zur Ausweitung des SRDU-Projekts im ganzen Land dienen. Da in Äthiopien über 80 % der Menschen in ländlichen Gebieten leben, besteht landesweit eine grosse Nachfrage nach verbessertem Wohnungsbau. Der Bau der Einheiten wird sowohl in der Gurage-Region als auch in anderen Teilen Äthiopiens vom Ministerium für Stadtentwicklung und Konstruktion gefördert. Dabei arbeitet das Ministerium eng mit dem SRDU-Team zusammen. Alle Ausbildungseinrichtungen, die sich mit Wohnungsbau beschäftigen, sollen dahingehend sensibilisiert werden, sich um eine Verbesserung des ländlichen Wohnungsbaus zu bemühen.
Man darf hoffen, dass aufgrund dieses starken politischen Engagements mehr Berufsschulen und Universitäten die Erkenntnisse des SRDU-Prozesses aufgreifen und ähnliche Projekte lancieren. Das Forschungsteam hat mittlerweile ein Handbuch in Amharisch erstellt, das die Konstruktionsprinzipien des Baus und deren Umsetzung schrittweise beschreibt.
Es ergänzt so auf der Anwendungsebene die Entwicklung akademischer Lehrpläne. Das Handbuch soll Studierende der Technischen Berufsschule Wolkite anregen, die SRDU-Technologie gemeinsam mit Handwerkern und Bauherren weiterzuentwickeln. Mittlerweile möchten auch einflussreiche Personen der Gurage-Region beim Bau ihrer Privathäuser diese Bautechnologie nutzen. Als Trendsetter sind sie Teil des Projekts und werden aktiv gesucht – denn in der nach wie vor feudalistisch geprägten Gesellschaft Äthiopiens kommt der Vorbildfunktion höher gestellter Persönlichkeiten eine hohe Bedeutung zu.
Der durch die Forschungsinitiative ausgelöste Wissensaustausch im ländlichen Wohnungsbau schlägt sich auf akademischer und praktischer Ebene nieder. Das Forschungsteam hofft, dass Berufsschulabsolventen aufgrund etablierter SRDU-Lehrpläne ihr Wissen zur Verbesserung des Hausbaus vermehrt an die Bevölkerung weitergeben und dabei traditionelle Bauweisen und Typologien weiterentwickeln. Der Wissensaustausch soll auch bewirken, dass Bauern aus eigener Überzeugung notwendige Anpassungen beim Hausbau ausführen und damit die Identität ihrer baulichen Umgebung aufrecht erhalten. Erst dann ist die Grundlage für einen engagierten und nachhaltigen Entwicklungsprozess gegeben.
[Elias Yitbarek Alemayehu, Assistenzprofessor und Inhaber des Lehrstuhls für Wohnungsbau am EiABC in Addis Abeba. Er steht einer internationalen Forschungsgruppe vor, die sich mit den Grundlagen des Wohnungsbaus im ländlichen Äthiopien befasst]
Anmerkungen:
[01] Zum Einfluss der Modernität: Elias Yitbarek Alemayehu: Reflections on the urban changes of Addis Ababa – Slums, Change and Modernity. In: Elizabeth Wolde-Giorgis (Hg.): What is Zemenawinet? Perspectives on Ethiopian Modernity (2010). Hg. v. Addis Ababa University und Goethe-Institut.
[02] Afrikanischer Wacholder (Juniperus procera), auf Amharisch «tid».
[03] Der aus Australien nach Afrika gebrachte Eukalyptus wächst in Äthiopien in grossen Mengen. Obwohl er die Biodiversität stark einschränkt, ist er als Brenn- und Bauholz eine wertvolle Ressource; vgl. www.greenethiopia.org
[04] Woredas sind die zweitgrösste Verwaltungseinheit in der Hierarchie der Regierungsstruktur.TEC21, Fr., 2013.05.17
17. Mai 2013 Elias Yitbarek Alemayehu