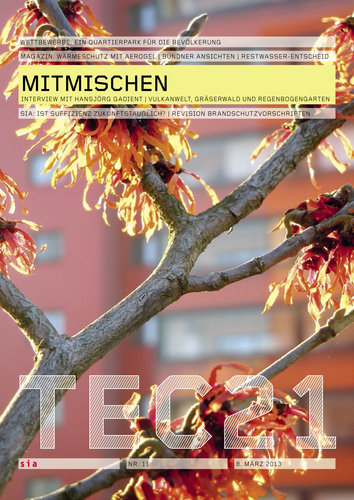Editorial
«Verdichtung» ist zum Schlagwort geworden, und man hat gemerkt: Sie ist kaum zu haben, ohne die Bewohnerinnen und Bewohner einzubeziehen (vgl. TEC21 9 / 2013). Dass Architekten Partizipation zu ihrem Entwurfsprinzip erheben, ist indes nach wie vor nicht der Standard. «Die Baupiloten» aus Berlin tun dies seit Jahren konsequent. Dabei befragen sie Nutzerinnen und Nutzer nicht nur, sondern entwickeln Räume mit ihnen gemeinsam – mittels Zeichnungen, Collagen und Modellen («Vulkanwelt, Gräserwald, Regenbogengarten»).
Bezieht man «verdichten» nur auf die gebaute Umwelt, greift man zu kurz. Vernachlässigt wird dabei die Rolle der Landschaft. Doch steigen die Anforderungen an die Grünräume, je dichter der Raum bebaut ist. Solange Kinder den Wald vor der Tür haben, mögen sie sich mit dem Verbot arrangieren, sich am Zierstrauch zu bedienen, um mit einer Astgabel eine Steinschleuder zu basteln, und werden sie sich mit der Tierwelt anfreunden können, ohne ein Meerschweinchen einsperren zu müssen. Solange sie auf einer nahe gelegenen Wiese einen Blumenstrauss pflücken können, können sie sich damit begnügen, im Rasen höchstens einmal ein verirrtes Gänseblümchen zu entdecken. Und solange ein Bach in der Nähe ist, den man stauen kann, werden sie sich im Sandkasten nicht übermässig langweilen.
Bietet ihnen die Umgebung aber all das nicht, muss es in ihrem unmittelbaren Siedlungsumfeld geschaffen werden. Verbreitet ist diese Einsicht indes nicht. Nach wie vor zeichnen sich Umgebungsgestaltungen von Neubausiedlungen zumeist durch ausgedehnte Rasenlandschaften aus, unterbrochen von Spielplätzen, die mit 08/15-Geräten alimentiert sind, und gefasst von Hecken aus Buchs, Eibe oder Kirschlorbeer. Hauptargument gegen eine fantasievollere, sozial verträglichere und ökologischere Gestaltung ist der Pflegeaufwand. Dass sich Grünräume auch im Siedlungsumfeld mit Biodiversität, optischer Attraktivität und sozialer Nutzungsvielfalt zu erschwinglichem Preis konzipieren lassen, illustriert «Chaotisches Ökosystem, geordneter Rahmen». Darin werden drei Siedlungen thematisiert, bei deren Gestaltung die Bewohnerinnen und Bewohner mitreden konnten. So, wie sie sich jetzt präsentieren, illustrieren sie aber auch, wie sie ihrerseits mit den Menschen kommunizieren.
Rahel Hartmann Schweizer
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Ein Quartierpark für die Bevölkerung
10 MAGAZIN
Diskreter Wärmeschutz mit Aerogel | Bündner Ansichten | Wichtiger Entscheid zum Restwasser
16 CHAOTISCHES ÖKOSYSTEM, GEORDNETER RAHMEN
Rahel Hartmann Schweizer
Mit zunehmender Verdichtung werden die Ansprüche an den Aussenraum immer höher und immer komplexer. Um ihnen gerecht zu werden, wurde in drei Siedlungen der Genossenschaft Eigengrund eine partizipativ entwickelte, verdichtete, ökologisch, sozial, wirtschaftlich und gestalterisch nachhaltige Landschaft geschaffen.
23 VULKANWELT, GRÄSERWALD, REGENBOGENGARTEN
Christian Holl
Architektur muss keine Geschichten erzählen. Sie kann aber Impulse setzen, damit die Nutzer dazu angeregt werden, sich durch eigene Geschichten die Architektur anzueignen. «Die Baupiloten» aus Berlin gehen diesen Weg – indem sie sich früh intensiv mit den Nutzerinnen und Nutzern über deren Vorstellungen von Architektur auseinandersetzen.
27 SIA
Ist Suffizienz zukunftstauglich? | Revision Brandschutzvorschriften | World Energy Outlook 2012 | Wahlen in Kommissionen 2/2012
32 PRODUKTE
Feller | Joulia | Gilgen Door Systems | Swisswool | RAL | Schindler | Fixit | Gutjahr
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Chaotisches Ökosystem – geordneter Rahmen
Die Einsicht ist verbreitet, dass ein Grossteil des Gebäudeparks in der Schweiz der Sanierung bedarf. Doch der «Park» im wörtlichen Sinn gerät aus dem Blick: Die Gestaltung von Grünräumen in Siedlungen lässt oft den Einfallsreichtum der architektonischen, ingenieur- und energietechnischen Leistungen vermissen. Ebenso ist der fortschreitende Verlust an Landschaft und die Notwendigkeit zur Verdichtung in aller Munde – zuweilen angereichert mit «Partizipation». Selten aber werden alle diese Aspekte zusammen fokussiert. Eine Synthese versucht hat der Landschaftsarchitekt Hansjörg Gadient in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften: In drei Siedlungen der Genossenschaft Eigengrund ist eine partizipativ entwickelte, verdichtete, ökologisch, sozial, wirtschaftlich und gestalterisch nachhaltige Landschaft entstanden. Im Gespräch erläutert der Landschaftsarchitekt das Vorgehen.
TEC21: Der Aussenraum der drei Siedlungen in Dietikon – an der Glanzenbergstrasse 26–28, der Glanzenbergstrasse 12 und der Schöneggstrasse 159–161 – war mit ausgedehnten monotonen Rasenflächen und der fantasietötenden Standardspielplatzausrüstung aus den 1960er-Jahren wenig attraktiv und ausserdem in einem pitoyablen Zustand. Sie sind ihm radikal zu Leibe gerückt. Man erkennt ihn kaum wieder. Wie haben Sie das gemacht?
Hansjörg Gadient: Zunächst, indem wir einen ganzheitlichen Blickwinkel gewählt haben – einen, der versucht, die verschiedenen Ansprüche an einem Ort zu erfüllen. Man muss heute davon abkommen, ausserhalb des Siedlungsraums ökologisch maximal wertvolle Flächen zu schaffen und innerhalb eher das Design zu pflegen. Stattdessen versuchten wir, beides zusammenzubringen. Denn wir können es uns je länger, je weniger leisten, Flächen nur für einen Aspekt – hier das Ökologische, da die Zierde, dort die Spielfläche – auszuscheiden. Mit zunehmender Verdichtung werden die Ansprüche an den Aussenraum immer höher und immer komplexer.
TEC21: Das ist das Gegenteil dessen, was der Städtebau der Moderne propagierte.
Gadient: Genau. Der modernistische Städtebau zog Grenzen zwischen verschiedenen Funktionen und definierte, wo gearbeitet wird, wo man sich erholt, wo man sich der Kultur widmet etc. In vielen Städtebau-, aber auch in Aussenraumkonzepten wird diese Trennung immer noch vorgenommen. Mit der Verdichtung muss man Wege finden, wie man an einem Ort mehreren und sogar widersprüchlichen Anforderungen Genüge tun kann. Es ist bezeichnend, dass Experten aus völlig entgegengesetzten Hemisphären für diese Mischung der Funktionen einstehen. Am Kongress der International Federation of Landscape Architects von 2011 in Zürich plädierte Joan Nassauer, Professorin für Landschaftsarchitektur an der University of Michigan, genauso dafür wie der Chinese Xiaoming Liu, der in Beijing Landschaftsarchitektur lehrt.
TEC21: Was heisst das auf den Grünraum einer Siedlung übertragen?
Gadient: Einerseits reicht es nicht, die Flächen als Abstandsgrün zwischen den Häusern zu behandeln und mit akkurat geschnittenem Rasen zu füllen. Man muss sie mit einer Aufenthaltsqualität aufladen, die mit derjenigen eines Naherholungsraums konkurrieren kann. Die Menschen wollen müssig entspannen, spielerisch verweilen und sich sportlich betätigen können: Spass, Spiel und Sport. Andererseits bedarf es einer gewissen Nutzungsneutralität. Das heisst, die Elemente, mit denen der Grünraum bestückt wird, müssen flexibel sein, damit sie auch alternative Nutzungen zulassen.
TEC21: Das klingt aber immer noch sehr funktionalistisch …
Gadient: Das mag daran liegen, dass die drei Kriterien ökologisch, ökonomisch und sozial nach wie vor im Vordergrund stehen. Ich würde sie denn auch ergänzen durch «ästhetisch» bzw. «gestalterisch». Das bedeutet, dass die Gestaltung zum einen die drei klassischen Aspekte der Nachhaltigkeit vereinen muss, zum andern aber auch, dass sie nicht zu modisch sein darf. Zukunftsfähige Gestaltungen müssen also nicht nur ökologisch, materiell haltbar und sozial verträglich sein, sondern auch optisch nachhaltig. Denn wenn man das in den Wind schlägt, ist die Dauerhaftigkeit von Landschaftsgestaltungen gering: Sie werden bald wieder abgebrochen – sei es, weil ihre Pflege zu teuer ist, sei es, weil die Menschen sie nicht annehmen und diese Ablehnung durch Littering sichtbar wird, oder sei es, dass man das veraltete Zeug nicht mehr sehen mag.
TEC21: Ist nicht die Furcht vor hohen Pflegekosten der Grund für die Zuflucht zum Rasen?
Gadient: Ein einfacher Vergleich zeigt, dass diese unbegründet ist: Einen konventionellen Rasen muss man 16 bis 20 Mal pro Jahr mähen, eine ökologisch wertvolle Langgraswiese bloss zwei Mal. Ökologisch sinnvolle Anlagen sind auch günstig im Unterhalt. Und meist wird die Biodiversität gesenkt, wenn man zu stark eingreift.
TEC21: Ökologie und Ökonomie lassen sich einigermassen objektivieren, d. h., sie sind in einem gewissen Rahmen messbar. Die soziale und gestalterische Nachhaltigkeit lässt sich hingegen nicht a priori berechnen. Und Ihre Vorstellungen davon hätten sich mit denen der Bewohner als unverträglich erweisen können, nicht wahr?
Gadient: Aus diesem Grund wurde ein partizipatives Verfahren gewählt, die Bewohnerinnen und Bewohner in die Planung einbezogen, ihre Wünsche und Bedürfnisse in einer Befragung ermittelt.
TEC21: Wie war die Resonanz darauf?
Gadient: Knapp zwei Drittel der Personen, die wir angefragt haben – Alleinstehende, Familien, Kinder – beteiligten sich, die anderen verzichteten aus Mangel an Zeit oder Interesse.
TEC21: Welche Erkenntnisse haben Sie aus der Befragung gewonnen? Waren Sie vorhersehbar, oder gab es Überraschungen?
Gadient: Bestätigt hat sich unsere These, wonach die Anforderungen an Grünräume gestiegen sind. Offenbart hat sich ausserdem ein enormer Informationsbedarf.
TEC21: Die grössere Palette an Wünschen geht also einher mit der Verdichtung, hat aber wohl auch mit dem weiten demografischen Spektrum in den Siedlungen zu tun?
Gadient: Ja, wobei die Bedürfnisse sich jeweils auch innerhalb einer Altersgruppe diversifiziert haben. Um ein Beispiel zu geben: Spielplätze. Der überwiegende Teil der Angebote auf Spielplätzen reduziert sich auf eine eingeschränkte Nutzung: Klettern, Rutschen, Schaukeln. Wenn man schaut, wie Kinder wirklich spielen, deckt das nur einen Bruchteil ihrer Bedürfnisse ab. Trotzdem werden immer wieder dieselben konventionellen Geräte aufgestellt, weil sie etabliert sind, weil die grossen Anbieter sie auf den Markt werfen, solange sie sie absetzen können, und aus Sicherheitsüberlegungen. Ich vermute jedoch, dass dahinter noch etwas anderes steckt, und zwar, dass das, was Kinder am meisten interessiert – etwas zu verändern –, nicht sein darf. In unserer Umwelt gelten Veränderungen, die Kinder vornehmen, schnell als Vandalismus. Schneiden sie an einem Zierstrauch einen Ast ab, weil sie einen Pfeilbogen machen wollen, schreitet der Abwart ein.
TEC21: In Ihrem Aussenraum darf man Äste für Pfeilbogen abschneiden? Gadient: Ja, es gibt Zonen, in denen Wildsträucher wachsen, die so ungezähmt gehalten werden, dass es auch nicht auffällt, wenn ein Zweig fehlt. TEC21: Wenn Sie von «Zonen» sprechen, ist das so zu verstehen, dass Sie den Grünraum der drei Siedlungen jeweils in Zonen mit unterschiedlichen Nutzungen gegliedert haben?
Gadient: Der Grundgedanke war, einen Katalog von Modulen zu entwickeln, der für alle Siedlungen der Genossenschaft funktionieren könnte. Ursprünglich beinhaltete er ein Dutzend Module, für die Ausführung haben wir sie auf sieben reduziert: Spielhain, Vogelinsel, Robinson’sche Blumenwiese/Blumenrasen, Langgraswiese, Pergola, Nutzgarten und Kräuterschach. Diese passten wir jeweils den spezifischen räumlichen Verhältnisse einer jeden Siedlung an. Die Idee war, der Genossenschaft ein Instrumentarium an die Hand zu geben, auf das sie dann auch für allfällige weitere Siedlungssanierungen zurückgreifen kann.
TEC21: Welcher Art sind diese Zonen, wie sind sie beschaffen?
Gadient: Um an die vorhin angesprochene Frage der Konzeption eines Spielplatzes anzuschliessen: Diesen haben wir als mit Bäumen bepflanzten «Spielhain» gestaltet, sodass sich die Kinder wie in einem Wäldchen fühlen, eine Welt für sich haben, die Eltern sich aber auch gern da aufhalten, weil sie Sichtschutz und Beschattung geniessen. Was die Spielgeräte selber betrifft, wurde zum einen entschieden, eher solche anzuschaffen, die von mehreren Kindern gleichzeitig benutzt werden können, also Korbschaukeln statt der üblichen Sitzschaukeln zum Beispiel. Es können nicht nur mehrere Kinder hineinklettern – was die Sozialisation befördert –, der Korb kann auch zusätzliche Funktionen ausfüllen, beispielsweise als Hängematte dienen. Zum anderen wurden Geräte gewählt, die auch ältere Kinder oder gar Erwachsene ansprechen. An der Glanzenbergstrasse 26–28 gibt es daher jetzt eine Drehscheibe. Die Spuren, die sich inzwischen im Gras abzeichnen, zeigen, dass es eines der beliebtesten Geräte ist (Abb. 01).
TEC21: Gibt es weitere Elemente, bei denen der soziale Aspekt im Vordergrund steht?
Gadient: Unser Ziel war, überall möglichst alle Aspekte zu berücksichtigen. So haben uns soziale Überlegungen beispielsweise auch beim Modul «Berankte Laube» geleitet. Sitzplätze in herkömmlichen Grünanlagen in Siedlungen werden erfahrungsgemäss kaum genutzt, weil sie meist weder über Witterungs- noch Sichtschutz verfügen. Wir haben Segel aus Planenmaterial machen lassen, die man ganz einfach mit Ringen einhängen kann, wenn man von den Balkonen aus nicht beobachtet und beim Gewitter nicht nass werden will. An der Glanzenbergstrasse 26–28 dagegen haben wir keine neue Pergola gebaut, sondern den bestehenden, von den Bewohnern einst selbst errichteten Unterstand aus Respekt vor der Eigenleistung bewahrt: Er war der Kern der Nutzung des Aussenraums, mithin der Aneignung in dieser Siedlung.
TEC21: Wie weit haben Sie überhaupt mit dem Bestand etwas anfangen können?
Gadient: In der Siedlung Glanzenbergstrasse 26–28 war durch die Baumassnahmen das Grundstück fast leer, und die Bäume waren überaltert oder stark geschädigt. Wir haben aber trotzdem einen bestehenden, arg in Mitleidenschaft gezogenen Nussbaum mit einer Blumenwiese umgeben, damit er sich erholen kann.
TEC21: Was ist mit «Blumenwiese» gemeint?
Gadient: Blumenwiese ist kein fachlich spezifischer Begriff, wir haben ihn für die Gespräche mit den Bewohnern geprägt. Sie ist ebenfalls ein Modul – normalerweise einfach ohne Baum drin. Es handelt sich um eine Robinson’sche Blumenwiese, mit der die Diversität erhöht wird. Das Pflanzenspektrum da drin ist viel grösser als in einer Fettwiese oder einem Sportrasen und das Nahrungsangebot für verschiedene Insekten deshalb üppiger. Um die Erwartung der Bewohner an den Zieraspekt einer Aussenanlage nicht zu enttäuschen, haben wir zusätzlich Blütenstauden eingepflanzt. Damit sind wir dann beim Namensgeber angelangt, beim irischen Gärtner William Robinson, der diese Art Wiese schon im 19. Jahrhundert entwickelt hat.
TEC21: Womit wir beim ökologischen Part wären …
Gadient: Eine Variation dazu ist der ebenfalls als Modul behandelte Blumenrasen, das heisst ein Rasen auf Magersubstrat, der weniger häufig geschnitten wird als ein Sportrasen und der eine andere Einsaat hat, mit mehr Kräutern und Blumen durchsetzt ist und eine relativ lange Blütezeit hat. Er hat viele ökologische Vorteile, aber auch einen Nachteil: Im ersten Jahr ist er eher unattraktiv, was der Akzeptanz der Bewohner hätte abträglich sein können. Um ihnen zu signalisieren, dass da etwas kommt, haben wir ihn in Glanzenberg zusätzlich mit Krokussen bepflanzt, um ihm von Anfang an einen starken Blütenaspekt zu verleihen. Das Gleiche haben wir in den Langgraswiesen mit eingepflanzten Wildtulpen, Narzissen und Zierlauch gemacht.
TEC21: Gibt es auch Bereiche, die der Natur vorbehalten sind, ohne Konzessionen an die Bewohner?
Gadient: Nein, ohne Konzessionen an die Bewohner geht gar nichts. Aber man kann dennoch bei der Ökologie weit gehen. Die Vogelinsel ist ein solches Element. Sie besteht im Wesentlichen aus Vogelnährgehölzen – wilde Kirschen und Holunder, kombiniert mit stacheligen Pflanzen wie Schlehe und Sanddorn. Zunächst bieten sie zahlreichen Vögeln eine Nahrungsgrundlage. Sobald sie sich zu undurchdringlichen Dickichten entwickelt haben, bilden sie ausserdem einen Schutzraum für Meisen, Sperlinge, Amseln, Finken und vielleicht auch für empfindsamere Arten wie Hausrotschwänze oder Stieglitze.
Die Vogelinsel ist das Modul, das vielleicht am stärksten der Biodiversität zuträglich ist, weil sie nicht betreten und nicht «aufgeräumt» wird, das heisst, Totholz, Blätter- und Asthaufen bleiben liegen. Dies wiederum trägt dazu bei, die Unterhaltskosten zu senken, weil innerhalb der Inseln praktisch keine Pflege anfällt. Sitzgelegenheiten an ihren Rändern steigern ausserdem als Nischen, in die sich die Bewohner zurückziehen können, die Aufenthaltsqualität. Und nicht zuletzt sind sie mit der attraktiven Blüte der Kirsche auch optisch ein Erlebnis. So kommen am Ende alle vier Aspekte zusammen: ökologisch wertvoll und wirtschaftlich günstig, sozial nützlich wie auch gestalterisch attraktiv.
TEC21: Auf Ihren Plänen fällt auf, dass alle diese Module mit Steinplatten gerahmt sind: nicht streng geometrisch, aber doch abgezirkelt, wo man doch – mit dem Gedanken an die Biodiversität im Hinterkopf – eher Wildwuchs erwarten würde. Ist das der Tribut an den Gestaltungswillen des Landschaftsarchitekten, den die Genossenschaft leisten musste?
Gadient: Wenn Sie einen Blick auf Abb. 06 werfen, erhalten Sie einen Teil der Antwort. Nicht aus Unwissenheit haben wir übermässig viele Nistkästen installiert und nicht zufällig ihre Farbe derjenigen der Genossenschaft angepasst, sondern vielmehr, um den Bewohnern die Funktion des «Gestrüpps» zu signalisieren, das sich im Innern der Insel zunehmend bilden wird. Neben ihrer eigentlichen haben die Nistkästen eine kommunikative Funktion, die heisst: «Wir vernachlässigen die Pflege dieses Bereichs nicht aus Faulheit, sondern weil wir etwas für die Vögel tun.» Um Akzeptanz und Schonung eines «ungepflegten» Bereichs zu erreichen, ist das eminent wichtig. Aus dem gleichen Grund sind sie klar abgegrenzt, d. h. «sauber» in Grenzen gehalten. Analoges gilt für die anderen Module: Ihre Funktionen müssen kenntlich sein, damit sie akzeptiert werden. Die Landschaftsarchitektin Joan Nassauer kondensiert das in der Formel «Messy ecosystems – orderly frames» einerseits und «Cures to care» andererseits. Und an diesem Punkt kommt auch der Gestaltungswille zum Zug. Wir konnten die Elemente objekthaft in die Freifläche setzen, diese gliedern und gleichsam das Vakuum der ehemals grossflächigen, ungestalten Aussenräume füllen.
TEC21: Bei den Vogelinseln besteht der Beitrag der Bewohner gewissermassen darin, sich herauszuhalten. Gibt es Teilnahme auch im Sinn des Hand-Anlegens?
Gadient: Diesem Bedürfnis tragen der Nutzgarten und das Kräuterschach Rechnung, wobei wir sie auf zwei verschiedene Arten miteinander «gekreuzt» haben. In Nr. 12 haben wir das Kräuterschach innerhalb des eingezäunten Nutzgartens realisiert. Eingezäunt deshalb, weil sich die Leute bei offenen Gärten schamlos bedienen – und um wiederum einen Treffpunkt zu schaffen. Das funktioniert gut. Die Bewohner, die Beete gemietet haben – sie müssen etwas kosten, um die Sorge wert zu sein –, pflegen auch die Kräuterschachs akkurat. In Nr. 26 und 28 haben wir es dagegen in den Grillplatz integriert, wo es ja Sinn machen würde. Dreimal haben wir es angepflanzt, bis wir kapitulierten: Die Leute haben die Kräuter ausgegraben und auf ihren Balkon genommen! Kinder spielten damit, als ob es ein Sandkasten wäre.
TEC21: Ist das der einzige Wermutstropfen?
Gadient: Die Bocciabahn ist nicht gerade eine Erfolgsgeschichte: Sie wird kaum genutzt, obwohl die Bewohner sie sich bei den Befragungen explizit gewünscht haben. Vielleicht ergibt sich daraus aber auch eine Chance: Wenn man nun einfach nicht mehr jäten würde, bekäme man eine ökologisch hochinteressante Sukzessionsfläche. Der Boden ist so verdichtet und so mager, dass nur hochspezialisierte Pflänzchen eine Chance hätten.
TEC21: Die Bilder vermitteln den Eindruck, dass die Anlagen akzeptiert werden. Ist das auch so, wenn der Landschaftsarchitekt mit der Kamera in der Hand wieder weg ist?
Gadient: Eine Anekdote beantwortet diese Frage vielleicht am anschaulichsten: Wir haben die Beete bei den Eingängen zum Hochhaus Nr. 26 jeweils hochwertig bepflanzt: Im Frühling blühen Zwiebelpflanzen, später Sternmangolie, Zwergflieder sowie Rosen und im Herbst Anemonen und Silberkerzen. Das ist vergleichsweise pflegeaufwendig, aber es wird als Visitenkarte wahrgenommen – ausserdem sind es nur kleine Flächen. Dort nun wohnt eine ältere Frau, die diese Rabatten schon früher gepflegt und sich ihrer wieder angenommen hat. Als ich dann aber sah, dass sie unseren in der Fassadenfarbe knallrot gewählten Wildtulpen weinrot-weiss geflammte holländische Hybride beigesellte, bin ich im ersten Moment erschrocken; im zweiten habe ich gedacht: Nun, das ist jetzt Aneignung, so soll das doch eigentlich sein.
Literatur:
zu Joan Nassauer: www.snre.umich.edu/profile/nassauerTEC21, Fr., 2013.03.08
08. März 2013 Rahel Hartmann Schweizer
Vulkanwelt, Gräserwald und Regenbogengarten
Architektur muss keine Geschichten erzählen. Sie kann aber Impulse setzen, damit die Nutzer in einer spezifischen Atmosphäre dazu angeregt werden, sich durch eigene Geschichten die Architektur anzueignen.
«Die Baupiloten» aus Berlin gehen diesen Weg – indem sie sich früh intensiv mit den Nutzerinnen und Nutzern über deren Vorstellungen von Architektur auseinandersetzen.
Architektur sagt etwas darüber aus, wie Menschen ihren Umgang miteinander regeln, wie sie einander und sich selbst sehen beziehungsweise gesehen werden wollen. Architektur kann zu einer Erzählung werden, die von dem berichtet, wie Menschen sie nutzen.
Gemeint ist mit «Erzählung» nicht die Wiedergabe eines Geschehens, sondern eine Form, sein Leben zu begreifen, seine Rolle in der Welt zu verstehen und zu gestalten. Wenn Menschen der Architektur ihre eigenen Geschichten einschreiben, dann kann man davon sprechen, dass sie sich mit einem Gebäude identifizieren. Eine solche Identifikation stellt sich umso eher ein, je besser die Kommunikation zwischen Architekten und Nutzern funktioniert. Behinderungen erfährt der verbale Austausch, weil je andere Vokabulare verwendet werden. Vorstellungen und Wahrnehmung von Architektur sind oft divers, Fachsprache und alltagsweltliche Bedürfnisse artikulieren sich unterschiedlich. Die Möglichkeiten der Verständigung zwischen Profis und Laien loten «Die Baupiloten» an der Schnittstelle von Lehre, Forschung und Praxis in partizipativen Prozessen aus. Die Grundthese dabei ist, dass Atmosphären als zentrales Instrument der Verständigung zwischen Architekt und Nutzer geeignet sind, weil sie die präzise architektonische Festlegung meiden. Auf der anderen Seite können sich Nutzer mitteilen, ohne von der vermeintlichen Notwendigkeit einer korrekten Formulierung überfordert zu werden.
Es lohnt sich, einen Blick auf die konkrete und jeweils spezifische Form zu werfen, mit der die Baupiloten methodisch auf verschiedene Situationen reagieren.
Ausführliche Entscheidungsfindung
An der Nikolaus-August-Otto-Oberschule in Berlin, einer Montessori-Gemeinschaftsschule, sollte, nachdem 2011 ein mehr oder weniger konventioneller Neubau eingeweiht wurde, ein experimenteller Begegnungspavillon entstehen. In einem ersten Schritt hatten die Schüler mit Collagen dargestellt, welche Atmosphäre ein solcher Pavillon ausstrahlen könnte. Diesen Collagen wurden Namen gegeben, die die bildliche Atmosphäre um eine sprachliche erweiterten. Die Schüler und die Studierenden der Baupiloten wählten gemeinsam einen Favoriten aus, und zwar den «tropischen Gräserwald», auf dessen Grundlage die Studierenden erste architektonische Fantasien entwickelten. In einem nächsten Schritt tauschten sich Schüler und Studierende über die Orte aus, die sie regelmässig besuchen, und darüber, was sie ihnen bedeuten, sodass die Studierenden ein Gefühl dafür bekamen, wie Schüler den Raum nutzen. Dann wurden in einem Workshop erneut gemeinsam Entwürfe von Elementen konzipiert mit Qualitäten, die sich Schüler von ihrem Pavillon erwarten – ein besondere Schaukel etwa oder ein Versteck, das die Beobachtung anderer zulässt. Diese Elemente wurden von den Studierenden zu einem modular aufgebauten Konzept für einen Pavillon weiterentwickelt. Nach erneuter Diskussion über die Entwürfe wurde eine Wahl getroffen. Realisiert wurde schliesslich ein aus Holzelementen aufgebauter Pavillon, mit Sitznischen und Rückzugsbereichen unterschiedlicher Grösse, dessen farbige und transluzente Fenster für verschiedene Stimmungen sorgen (Abb. 05).
Straffer Partizipationsprozess
Nicht immer ist ein solch ausführlicher Beteiligungsprozess möglich oder gewünscht. Beim Neubau der Kindertagesstätte (Kita) Lichtenbergweg für etwa 100 Kinder in Leipzig sollte der Partizipationsprozess straff durchgeführt werden, nicht zuletzt, weil innerhalb der Bauherrenschaft Skepsis bestand, ob die Beteiligung für die Bauaufgabe ausreichend belastbare Ergebnisse liefern würde. Das in einem grossen Garten mit vielen Bäumen gelegene Grundstück sollte so bebaut werden, dass es sich in die Nachbarschaft der von Eigenheimen geprägten Strasse fügt. In einer ersten Diskussion wurden mit den Pädagogen, den Bauherrenvertretern (Hochbauamt und Jugendamt), dem Träger und der Kita-Leitung Wünsche und Erwartungen, Prioritäten und Raumnutzungen, der Zusammenhang zwischen pädagogischem Konzept und Architektur erfasst. Ergänzt wurde dies durch atmosphärische Begriffe, die auch gegensätzlich sein konnten – etwa geborgen, lichtdurchflutet, veränderbar. Der Partizipationsworkshop mit den Kindern griff ein bereits vorher in der Kita behandeltes Thema auf: die vier Elemente. Bilder von Traumwelten der Kinder gaben erste Einblicke in deren Wünsche. Die Drei- bis Vierjährigen bauten in Kartons Modelle eines Waldgartens, «mit all den fantastischen Dingen zum Klettern, Liegen, Schaukeln, dem raschelnden Laub oder dem erdigen Boden». Die Vorschulklasse entschied, in Gruppen einen Regenbogengarten und eine Vulkanwelt zu bauen. Die Baupiloten liessen den Kindern Zeit, erinnerten sie aber hin und wieder an das Thema. Dabei sorgten Begriffe wie «Vulkan», «warm», «kuschelig», «Regenbogentreppe» und «Aussichtswolke» dafür, dass der Bezug zum Ausgangspunkt des Prozesses präsent blieb.
Die Modelle wurden anschliessend auch hier Schritt für Schritt über Fotomontagen und Schnittskizzen einer architektonischen Umsetzung zugeführt. Der Bau Kita wurde im Frühling 2011 begonnen und 2012 fertiggestellt.
Nicht nur für Kinder und Jugendliche
Ein drittes Beispiel illustriert, dass der an Atmosphären gebundene Partizipationsansatz, entsprechend variiert, auch mit Erwachsenen durchgeführt werden kann. Bei der Sanierung des zwischen Spree und Tiergarten in Berlin gelegenen, denkmalgeschützten Studentenwohnheims Siegmunds Hof aus den 1960er-Jahren wurden auf der Basis von 300 Interviews mit Studierenden zum gemeinschaftlichen Wohnen mögliche Aktivitäten und atmosphärische Beschreibungen destilliert. Im Planspiel «Spiel deinen Wohntraum – Wohn deinen Spielraum» wählten sie verschiedene Aktivitäten, sortierten sie räumlich und charakterisierten sie atmosphärisch.
Das Ergebnis gab Aufschluss über Prioritäten und Defizite des Bestands und das Verhältnis zwischen Privatheit und Öffentlichkeit innerhalb gemeinschaftlichen Wohnens. So war dem Freizeitsport ursprünglich zu wenig Bedeutung beigemessen worden, und die Studierenden empfanden die Verbindungen zwischen Innen- und Aussenräumen als unzureichend.
Zusätzlich zur energetischen und bautechnischen Sanierung wurden daher die Wohnungen so umgebaut, dass aus einer rigiden Einzelzimmerreihung eine Struktur aus verschiedenen Wohnungstypen entstand, vom Einzelzimmer bis zur Vierzimmer-Wohngemeinschaft. Terrassen schaffen Übergänge zum Garten, die Freibereiche werden durch grosse Sitzmöbel nutzbar, der Platz vor dem Haus öffnet sich zur Strasse, Gemeinschaftsräume werden thematisch differenziert. Die Häuser werden durch die Namensgebung charakterisiert: Es gibt ein Haus für Kunst- und Gartenfreunde, eines für Sportfreaks und eines für Workaholics.
Die drei Beispiele zeigen die Bandbreite, in der die Partizipationsmethoden der Baupiloten angewendet werden; sie dienen dazu, sinnliche und atmosphärische Qualitäten zu finden, die räumlich interpretiert und mit Namensgebungen, Farben sowie Lichtstimmungen umgesetzt werden können. Bei aller Weiterentwicklung der ersten Ansätze bleiben die Bezüge zu den ersten atmosphärischen Aussagen stets bestehen. Prinzipiell kann diese Methode weiter ausgebaut werden, auch für die Gestaltung von Arbeitswelten etwa ist eine Adaption vorstellbar. Die letztlich gefundenen ungewöhnlichen Konstruktionen und Formen sind dabei in direktem Bezug zu den Ideen der Nutzer entstanden, greifen die narrativen Impulse aus Collagen auf und setzen durch deren Übertragung selbst ihrerseits narrative Impulse.TEC21, Fr., 2013.03.08
08. März 2013 Christian Holl