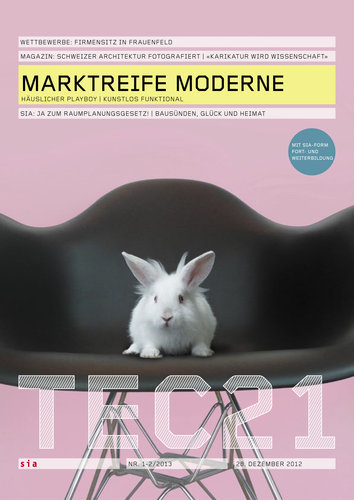Editorial
Fern ist uns die Absicht, zum Jahreswechsel in kulturpessimistisches Gejammer zu verfallen. Ebenso wenig liegt uns daran, die Vergangenheit zu verklären. Dass früher – zum Beispiel in der nostalgisch heraufbeschworenen Aufbruchstimmung der 1920er- und 1930-Jahre – alles besser war, stimmt bekanntlich nicht. Selbst die damals aufblühende moderne Architektur ist aus heutiger Sicht nicht über jegliche Kritik erhaben. Wie jede vitale Bewegung hat die frühe Moderne experimentiert, Exzesse betrieben und schwere Fehler begangen – etwa die Funktionentrennung auf städtebaulicher Ebene, mit deren Folgen wir uns noch lange auseinandersetzen müssen.
Doch viele der damals engagierten Architektinnen und Architekten waren von Idealen beseelt, wie sie in unserer übersättigten Zeit kaum noch jemand zu formulieren wagt: menschenwürdiges Dasein, Perfektion, befreites Wohnen, Emanzipation, Reinheit und Ehrlichkeit.
Es ging um nicht weniger als darum, die Welt zu verbessern.
Unsere Kolleginnen und Kollegen von Tracés, unserer welschen Schwesterzeitschrift, haben sich gefragt, was aus diesen hehren Absichten geworden ist. Als Untersuchungsobjekt diente ihnen die urbane Junggesellenwohnung – einmal in der Interpretation des Männermagazins Playboy, das in der Nachkriegszeit dezidiert modern eingerichtete Penthouse-Wohnungen für freizügige Männer propagierte, und einmal in Gestalt zweier kürzlich fertiggestellter Studios mit kompaktem Küche-Bad-Block, die zumindest formal an die Kleinstwohnung der frühen Moderne erinnern.
Die Erkenntnisse, die wir in diesem Heft präsentieren, stimmen nachdenklich. Zwar hat sich das Formenvokabular der Moderne in den letzten Generationen fest etabliert: Reduzierte Linien und Materialien, funktionale Küchen und hippe Designmöbel sind mehrheitsfähig geworden. Doch im Zug dieser Popularisierung und der Kommerzialisierung, die damit einher ging, haben die Formen ihre ursprüngliche Bedeutung eingebüsst. Im Playboy Mansion stand zwar keine brave Hausfrau am Herd, ob aber die devoten «Bunnys», die sich auf den modernen Möbelklassikern tummelten, dem Frauenbild von Architekturpionierinnen wie Margarete Schütte-Lihotzky oder Charlotte Perriand entsprochen hätten, darf bezweifelt werden. Die Sensoren und interaktiven Monitore wiederum, die in den beiden neuen Studios eingesetzt wurden, zeugen von einem Gesellschaftsbild, das eher auf virtuelle als auf reelle Gemeinschaft setzt.
Judit Solt
In eigener Sache
Diese und die nächsten beiden Ausgaben von TEC21 verschicken wir im Rahmen einer Kooperation an alle Mitglieder des Schweizerischen Verbands der Immobilienwirtschaft (SVIT), Sektion Bern. Wir freuen uns, bei dieser Gelegenheit neue Leserinnen und Leser zu begrüssen!
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Firmensitz in Frauenfeld
09 MAGAZIN
Pornotopia | Schweizer Architektur fotografiert | Geheime Welt im Gotthard | «Karikatur wird Wissenschaft»
16 HÄUSLICHER PLAYBOY
Christophe Catsaros
Ein Cocktail aus Sex, Architektur und Design: Das Männermagazin Playboy hat die moderne Gestaltung popularisiert, aber auch zu einem Konsumgut gemacht.
22 KUNSTLOS FUNKTIONAL
Anna Hohler
Die frühe Moderne strebte nach formal perfekten, lebensfreundlichen Innenräumen. Hightech-Medienoberflächen können deren Behaglichkeit nicht ersetzen.
27 SIA
Ja zum Raumplanungsgesetz! | Kursprogramm Deutschschweiz 1/2013 | Bausünden, Glück und Heimat
33 FIRMEN | PRODUKTE
Gassler | Vectorworks | Nora | Skantherm
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Häuslicher Playboy
Das Männermagazin Playboy setzte sich in der Nachkriegszeit kräftig für die Popularisierung der modernen Architektur ein. Wegen seiner erotischen Inhalte als Referenz unerwünscht, fehlt es jedoch meist in den Bibliografien zum Thema. Das ist schade, denn für die Architektur- und Designgeschichte ist das Studium des Playboy sehr aufschlussreich. Es zeigt, wie die Moderne – ursprünglich als Instrument der menschlichen Emanzipation gedacht – in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend als blosses Konsumprodukt vermarktet wurde. Das kürzlich erschienene Buch «Pornotopia» geht diesem Phänomen auf die Spur.
Das 2012 auf Deutsch veröffentlichte Buch «Pornotopia»[1] der Philosophin Beatriz Preciado (vgl. S. 9) durchbricht die scharfe Grenze zwischen populärer und wissenschaftlicher Literatur. Die Untersuchung über die anthropologische und architektonische Bedeutung der Zeitschrift Playboy zeigt, dass die Vision ihres Herausgebers Hugh Hefner viel weiter reichte, als es die freizügigen Titelbilder vermuten lassen. Tatsächlich hat Playboy wie keine andere Massenzeitschrift die moderne Architektur propagiert. Grosse Namen und hochwertige Einrichtungsgegenstände tauchten darin auf; vor allem aber setzte sich das Magazin entschieden für das Leben in der Stadt ein. Die 1953 gegründete, in Chicago herausgegebene Zeitschrift entwickelte zwischen 1953 und 1963 einen kämpferischen Diskurs für eine neue männliche Identität – die des unverheirateten jungen Grossstädters. Sehr schnell trat Playboy auch als Inneneinrichtungsmagazin für Männer auf und versuchte, sich einen Platz zwischen Frauen- und Wohnzeitschriften zu sichern. Mit seiner geschickten Mischung an Themen – Sex, Literatur und Wohndesign – hatte Playboy von Anfang an aussergewöhnlichen Erfolg. Die kleine Revolution, die Hugh Hefner für sich beansprucht, war die Rückeroberung des häuslichen Raums für den Mann. Die Begriffe Revolution und Rückeroberung mögen aus heutiger Sicht übertrieben erscheinen, im Kontext der konservativen Grundhaltung in den USA der 1950er-Jahre betrachtet sind sie jedoch durchaus angemessen.[2]
Stadtflucht und konservative Geschlechterrollen nach 194
5Während des Kalten Kriegs, einer von Spionen und heimlichen Helden besessenen Zeit, gehörte das amerikanische Heim vor allem der Familie. Es befand sich – dank der noch jungen Automobilkultur gut erreichbar – draussen vor der Stadt. In dieser sehr schematischen Vorstellung, die das traute Zuhause vom Rest der Welt trennt, war der Mann gezwungen, sich ausserhalb zu betätigen; darum verfügte er über das einzige Fahrzeug der Familie. Der häusliche Bereich war die Domäne der Frau. Dieses Modell der Kernfamilie hat nicht nur die Wertvorstellungen mehrerer Generationen von Amerikanerinnen und Amerikanern geprägt, sondern auch die urbane Entwicklung nach 1945. Die Städte dehnten sich in endlosen Suburbs aus, das Leben verlagerte sich aus dem Zentrum in die Peripherie. Die geostrategischen Ängste vor einem totalen Krieg, der die Städte zerstören würde, trieben die Familien aus den Städten hinaus. Jene Zivilisation, die in ihrer jüngsten Geschichte weltweit die meisten Bombardierungen veranlasst hat, konnte sich für die Sicherung ihrer Zukunft nur für ein anti-urbanes Modell entscheiden; denn je weiter die Stadt sich ausbreitete, desto weniger verwundbar war sie. Die atomare Bedrohung, die Rassenkonflikte, die Drogen und die Kriminalität mochten im Stadtzentrum bleiben: Der Durchschnittsamerikaner wohnte nicht mehr dort. Dieses sogenannte «White-Flight-Phänomen» war mitverantwortlich für den Niedergang der Innenstädte in den 1960er- und 1970er-Jahren. Beatriz Preciado betont, dass diese Trennung der Lebensbereiche Wohnen und Arbeiten auch ein effizientes Mittel war, die Frauen aus dem Arbeitsmarkt zu verdrängen, um wieder Platz für die nach 1945 demobilisierten Soldaten zu schaffen. Den aus dem Stadtzentrum verdrängten Frauen sei nichts anderes übrig geblieben, als sich um das Heim zu kümmern. Auf die emanzipierte, produktive Frau der 1940er-Jahre, die problemlos die in den Krieg gezogenen Männer ersetzen konnte, folgte in den 1950er-Jahren die abhängige, von der Aussenwelt abgeschnittene Ehefrau und Mutter.
Rückeroberung von Stadt und Wohnung
Auf dieses vorherrschende Modell des Einfamilienhauses in der Vorstadt antwortete der Playboy mit einem Plädoyer für das urbane Leben: «Der Mann verlangt nachdrücklich eine Wohnung für sich […], einen Raum nur für sich […], das ideale Penthouse für einen urbanen Junggesellen», heisst es in einem Leitartikel vom September 1956. Das Penthouse, von dem die Playboy-Leser träumten, verspricht die Wiederaneignung eines häuslichen Raums, der vom Einfluss der Frau befreit und wieder ins Stadtzentrum verlegt wurde. Die Stadt erhält dabei ihre begehrenswerte, spannende Dimension zurück. Der neue Mann – emanzipiert, unverheiratet oder geschieden – kann sich seinen Lieblingsbeschäftigungen hingeben: der Inneneinrichtung, elektronischem Spielzeug und leicht bekleideten Mädchen. Der neue Junggeselle behauptet sein Recht auf seinen eigenen Geschmack. Hugh Hefner verkörpert mit Vergnügen das von ihm propagierte Männermodell: Er lebt im Pyjama, umgeben von etwa dreissig sogenannten «Bunnys», in einem geschlossenen Universum, wo alles gefilmt wird. Das Playboy Mansion, Lebens- und Arbeitsort zugleich, ist das erste mediale Kloster unserer Zeit.
Die Bemühungen des Playboy um Auflösung der altväterlichen Allianz zwischen häuslichem Raum und Weiblichkeit hatten eine gewisse Entsprechung in den analogen Bemühungen der Feministinnen. Manche von ihnen betrachteten das Magazin sogar als Vorkämpfer der sexuellen Befreiung, gleichrangig neben der feministischen Bewegung und der Friedensbewegung der 1960er-Jahre. Beatriz Preciado ist in diesem Punkt zurückhaltender: Tatsächlich ist der kommerzielle Charakter dieser ersten medialen und sexuellen Utopie kaum zu übersehen. Sein unbestrittener Beitrag zur Entstehung des libidinösen und pharmazeutischen Konsumismus schliesst Playboy definitiv aus der Reihe der Protagonisten der sexuellen Befreiung aus.
Käufliche Schönheit für käufliche Schönheiten
Inwiefern erhellt nun die erotische und architektonische Heldengeschichte des Playboy die Frage nach dem Sinn der Modernität? Auf den Seiten des Magazins kann man verfolgen, wie die Utopie der Modernität zur Ware wird. Es zeichnet sich ab, wie die funktionelle, idealistische Vorkriegsbewegung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum luxuriösen, gestylten Modernismus verkommt. In den Netzen der Konsumkultur und der Massenmedien gefangen verliert die Moderne nach und nach ihre ethischen Imperative; sie wird zur blossen Stilübung, die sich den wechselnden Tendenzen und der Spekulation anpasst. Auf den Seiten des Playboy verkörpert ein Stuhl von Eero Saarinen auf einmal nicht mehr die Klarheit und Schnörkellosigkeit einer vollkommen angemessenen Geste, sondern wird, wozu ihn die Konsumgesellschaft verdammt: ein begehrtes und potenziell aneigenbares Objekt der Sinnlichkeit (Abb. 02). Die Architekturseiten des Playboy sind nur eines von vielen Symptomen der langsamen Verwandlung des modernen Stils. In den 1950er-Jahren tauchen zwei einander widersprechende Tendenzen auf: einerseits eine radikale, politisierte architektonische Gegenkultur, andererseits ein manierierter Modernismus, der jede Verbindung zu gesellschaftlichen Anliegen verloren hat. Zu einer Sache des Lifestyles – und nicht mehr des Lebens im vollen Sinn des Worts – gewandelt, wird die moderne Architektur zu etwas, was sie nach dem Willen ihrer Protagonisten nie hätte werden dürfen: zum Dekor. Diese Veränderung manifestiert sich in den rund um die Uhr gefilmten modernen Interieurs Hugh Hefners. Es ist kein Zufall, dass einer der eklektischsten Architekten unserer Zeit wiederholt im Playboy auftaucht: Frank O. Gehry entwarf schon vor fünfzig Jahren die Prinzipien des «bachelor pad», der Junggesellenwohnung als idealem Ökosystem für den neuen Mann.
Industrialisierung des erotischen Schauspiels
Das architektonische Interesse am Playboy beschränkt sich aber nicht auf das Zur-Ware-Werden eines Ideals. Neben dem genialen Einfall Hugh Hefners, das Verbotene mit dem Akzeptablen zu mischen, beruht sein Projekt auf der Schaffung eines erbaulichen Mythos: eines unerreichbaren, aber in der Vorstellung aller präsenten Orts. Das Playboy Mansion als Raum strikt hierarchisch gegliederter Freizeitbeschäftigungen ist die Verkörperung einer Utopie. Nach dem Vorbild dieses mythischen Raums entstehen eine ganze Reihe von Hotels und Clubs. Diese neue Art von Bordellen verhält sich zu den Orten der Ausschweifung im 19. Jahrhundert wie Hugh Hefners Magazin zu der verbotenen Pornografie jener Zeit: Beide haben zum Ziel, das einst als verboten und verurteilenswert Geltende akzeptabel und kommerziell nutzbar zu machen. So tritt die virtuelle – filmische, fotografische und bald darauf auch digitale – Softprostitution an die Stelle der herkömmlichen, handgreiflicheren Form in Nachtklubs und Freudenhäusern. Playboy ist das Symptom für die Industrialisierung des erotischen Schauspiels, die mit der Erfindung des Kinos begann und ihren bisherigen Höhepunkt mit der allgemeinen Verbreitung des Internets erreicht hat. «Der Bewohner des Playboy-Penthouse ist eine erotisierte, kommerzielle Version von McLuhans ‹hyperconnected man›», schreibt Beatriz Preciado. Das tausendmal abgelichtete runde Bett von Hugh Hefner, von allen elektronischen Geräten seiner Zeit umgeben, ist die vollkommene Verkörperung dieses kybernetischen Traums (Abb. 03). Wenn dies das Erbe von Playboy ist, wird klar, dass seine Rolle bei der Entstehung des Modernismus weit über erotische Aspekte oder die Frage des Stils hinausgeht. War der Mann, der im Pyjama arbeitete und niemals sein Schloss verliess, nicht das erste Opfer einer Krankheit, die uns alle mittlerweile unerbittlich erfasst hat – des Glaubens, die ganze Welt sei auf dem Bildschirm zugänglich? Die erotisch-mediale Utopie des Playboy erzählt nicht so sehr vom Verfall der Moderne, sondern viel eher vom Zerfall der Wirklichkeit. Bei Walt Disney und Hugh Hefner, in den Vergnügungsparks des einen und in den Clubs des anderen, zeichnen sich neue Arten der Unterwerfung ab, die auf der Kontrolle über das Begehren basieren. Denn Wünsche, die der Herrschaft des Bilds unterworfen sind, können nie erfüllt werden – und sind deshalb unbegrenzt kommerziell ausbeutbar.
Anmerkungen:
[01] Beatriz Preciado, Pornotopia. Architektur, Sexualität und Multimedia im «Playboy». Wagenbach, Berlin 2012.
[02] Vgl. Thomas Fechner-Smarsly, Ein Traumhaus für den Mann, in: NZZ vom 23. Mai 2012, S. 51.TEC21, Fr., 2012.12.28
28. Dezember 2012 Christophe Catsaros
Kunstlos funktional
Sind die Ideale der modernen Architektur im heutigen Wohnungsbau zu sinnentleerten Stilübungen verkommen? Das Beispiel der Kleinstwohnung mit kompakter Küche legt diesen Verdacht nahe. Die Exponenten der frühen Moderne haben sie entwickelt, um Menschen am Existenzminimum würdige Lebensbedingungen zu verschaffen und Frauen von lästiger Hausarbeit zu befreien. In der zeitgenössischen Architektur scheint die Faszination für technische Gadgets zu überwiegen. Ein zufällig ausgewähltes Projekt spanischer Nachwuchsarchitekten, das für viele andere stehen könnte, dient als Diskussionsgrundlage.
Marcel Breuer hat in einem Vortrag, den er 1932 in der Zeitschrift «Das Werk» veröffentlichte, den Unterschied zwischen «modern» und «Mode» betont.[01] Für den Bauhaus-Architekten und Möbelgestalter entsteht das «Moderne […] aus dem Bedürfnis nach ständiger Vervollkommnung […] unter dem Druck der Logik und der Leidenschaft», das «Modische» hingegen aus «Laune», «einer durchaus gesunden Langeweile, aus einem Bedürfnis nach Abwechslung». Modisches und Modernes zu verwechseln sei ein verhängnisvoller Irrtum. Die Prinzipien moderner Gestaltung seien in Gefahr, «leerzulaufen, weil man sie mit einer Enge vertrat, die um jeden Preis modern erscheinen wollte und die darum modische Allüren annahm». Gemäss Breuer setzte dieser Niedergang bereits ein, bevor die moderne Architektur sich überhaupt richtig entwickeln konnte. Denn «die moderne Architektur ist noch nicht geboren, oder nicht fertig geboren, trotz Flachdach, grossen Öffnungen, trotz ‹Tempo der Zeit› und ‹sozialer Einstellung›. […] Die Aufgabe ist, die verschiedensten Gebiete geistiger und praktischer Arbeit zueinander in sinnvolle Beziehung zu stellen.»
Wie dies konkret stattfinden könne, erläutert Breuer am Beispiel der Wohnung: Diese habe die gewandelten Bedürfnisse von Mann und Frau zu berücksichtigen und müsse sowohl Rückzugsmöglichkeiten als auch Gemeinschaftsräume bieten. Als Illustration dienen diverse «Wohnbedarf»-Möbel, «die alltägliche, normale, der Mode nicht unterworfene Gebrauchsgeräte sein wollen». Dennoch schliesst Breuer eine Verbindung zwischen Nüchternheit und Überschwang nicht aus. Auf mehreren Seiten präsentiert er den «Einwohnraum» von Le Corbusier, Pierre Jeanneret und Charlotte Perriand in Paris (Abb. 01) sowie Möbel von Le Corbusier und André Lurçat, die «bewusst gesteigerte, mondäne, aber deshalb auch vergänglichere Wirkungen [suchen]. Sie sind wertvolle Beweise, dass die formale Einfachheit der modernen Möbel nicht aus Armut und äusserem Zwang entspringt, sondern aus freiem Willen, der selbst des festlichen Aufschwungs fähig ist, für den Alltag aber freiwillig auf diese Festlichkeit verzichtet.
Breuers 1932 geäusserte Befürchtung, das Formenvokabular der Moderne könne sich in sinnentleerten Formalismen erschöpfen, verdient auch heute Aufmerksamkeit. Im Folgenden soll ein zeitgenössisches Projekt – der Umbau einer Wohnung in zwei Studios in der Altstadt von Saragossa durch das junge spanische Architekturbüro elii – auf die Frage hin untersucht werden, inwiefern es den Ansprüchen der frühen Moderne genügen würde. Der Vergleich ist gewagt, zumal sich die jungen Spanier keineswegs auf ihre illustren Vorgänger beziehen. Andererseits drängt er sich geradezu auf. Die beiden Studios sind ebenso wie der «Einwohnraum» Interpretationen eines Typus, der erst mit der Moderne zum viel beachteten Entwurfsthema wurde: der städtischen Einzimmerwohnung. Und auch die Küchenblöcke der Studios wären ohne die kompakten Küchen, die in den 1920er-Jahren entwickelt und in den funktionalistischen 1950er- und 1960er-Jahren zum Standard etabliert wurden, kaum in dieser Form denkbar. Insofern könnte das zufällig ausgewählte Beispiel – das in der spanischen Tagespresse hoch gelobt wurde – für manchen anderen Neubau stehen. Leben auf engstem Raum und die Kunst zu leben Der sparsame Umgang mit Ressourcen, die pragmatische Anordnung von Funktionen und die Optimierung von Arbeitsabläufen haben die Architekten der frühen Moderne stark beschäftigt. Dahinter stand nicht nur die Faszination für Rationalisierung und Industrialisierung, sondern auch ein ausgeprägtes soziales Engagement, das sich etwa in der «Wohnung für das Existenzminimum» konkretisierte. Die österreichische Architektin Margarete Schütte- Lihotzky schuf 1926 mit ihrer «Frankfurter Küche» den Prototyp der modernen Einbauküche. In den USA legte Richard Buckminster Fuller, um die Zukunft der gesamten Menschheit besorgt, 1928 sein materialeffizientes «Dymaxion House» und 1937 eine vorgefertigte kompakte Nasszelle vor. Der Funktionalismus der Nachkriegszeit setzte selbst im gehobenen Wohnungsbau kompakte Küchen- und Nasszellen ein.
Im französischen Sprachraum hat Charlotte Perriand (1903 –1999) Pionierarbeit auf dem Gebiet des Wohnens auf reduziertem Raum geleistet. Sie arbeitete mit Le Corbusier und Pierre Jeanneret zusammen und wurde vor allem wegen ihrer zu Beginn der 1930er-Jahre entworfenen Stahlrohrmöbel bekannt, doch ihre Auffassung von Material und Raum, ihre Neuerungen im Bereich der Gebrauchsgegenstände und der Inneneinrichtung haben unsere Wohnverhältnisse im 20. Jahrhundert insgesamt beeinflusst.[02] An der Kunstgewerbeschule Union Centrale des Arts Décoratifs in Paris ausgebildet – den Begriff «Kunstgewerbe» ersetzte sie schnell durch das nüchterne «Wohnungseinrichtung» –, weigerte sie sich, einen Raum zu «möblieren»: Für sie nahmen Architektur und Inneneinrichtung parallel Gestalt an. Prägend war die Erinnerung an einen Krankenhausaufenthalt in ihrer Kindheit: Die Nüchternheit und das Weiss der Räume hatten sie so entzückt, dass sie in Tränen ausbrach, als sie wieder nach Hause kam. So trug sie später eine Kette aus schlichten verchromten Kupferkugeln um den Hals und beleuchtete ihre Wohnung mit einem Autoscheinwerfer.
Teamarbeit war für Charlotte Perriand wesentlich, ebenso die enge Zusammenarbeit zwischen Architekt und Innenarchitekt. Sie entwarf ihre Möbel im Hinblick auf den Raum, die «tables en forme» beispielsweise, die alle individuelle Kurven hatten. Zur Zeit der Rationalisierung des Wohnraums, als die Elektrifizierung der Küche und eine praktische Anordnung gepredigt wurden, die der Hausfrau die Arbeit erleichtern sollten, ging Charlotte Perriand einen Schritt weiter: Sie beschäftigte sich mit der Verbindung zwischen Küche, Wohn- und Esszimmer und verwandelte die Durchreiche in ein von beiden Seiten zugängliches Regal mit Fächern und Schubladen. Dieses Möbelstück ersetzte sie fünfzehn Jahre später in der Unité d’habitation «Cité Radieuse» in Marseille (1947–1952) durch eine Theke, womit sie die Küchen-Bar erfand, die sie von da an in immer neuen Formen variierte (Abb. 02). Seit sie sich mit Le Corbusier auf den Internationalen Kongress Moderner Architektur (CIAM II, 1929) in Frankfurt vorbereitete, untersuchte sie die Möglichkeiten einer «Wohnung für das Existenzminimum» – eine Beschäftigung, die in den 1970er-Jahren im Entwurf eines 27 m² grossen Vierbettappartements für die Wintersportstation Les Arcs in Savoyen mündete. Die Grösse des Projekts (30 000 Betten für drei Anlagen) zwang zum Einsatz vorgefertigter Teile. Charlotte Perriand sah eine an den Küchenblock angehängte Badkabine vor.
Eine Wohnung, zwei Studios und viele Fragen
Der 2011 fertiggestellte Umbau einer Wohnung in der Altstadt von Saragossa erlaubt insofern eine thematische Anknüpfung an diese letzte grosse Arbeit Charlotte Perriands, als es sich auch hier um eng bemessene Zweitwohnungen mit modular-funktionalen Küchen- und Badezimmerblöcken handelt. Ein Madrilene, der ein paar Tage pro Woche in der Hauptstadt Aragons verbringt, suchte dort ein Pied-à-terre. Er entschied sich für den Kauf einer Wohnung, die mit 75 m² zu gross war und die er vom Architekturbüro elii umbauen liess, um eine Hälfte zu vermieten. Die drei Teilhaber von elii – Uriel Fogué Herreros, Carlos Palacios Rodríguez und Eva Gil Lopesino, die 2002, 2003 respektive 2009 an der Technischen Hochschule für Architektur in Madrid diplomiert haben – schlugen eine klare Trennung vor. Sie verdoppelten die Sanitäreinrichtungen und die Küchenecken und ordneten sie um eine Türschleuse an. Die technischen Installationen wurden unter einem doppelten Fussboden versteckt, in den eine Badewanne oder ein Duschbecken eingelassen sind. So bleibt auf beiden Seiten möglichst viel Raum frei.
Die Architekten rühmen die «funktionale Flexibilität» der beiden Studios, die ihnen zufolge daraus resultiert, dass der Serviceblock hinter Storen versteckt und auf diese Weise in eine fensterlose Wand verwandelt werden kann. Die zwei Stufen, die dank einem fluoreszierenden Anstrich von innen leuchten, können als Nachttisch benutzt werden, und das Bett lässt sich unter den Steg schieben. Ein Bügeltisch auf Rollen – der stark an das herunterklappbare Bügelbrett Margarete Schütte-Lihotzkys erinnert – könnte auch als Frühstücksbar dienen. Der zweite grosse Vorzug der Studios sei die elektronische Ausstattung, so die Architekten. Sie soll den Energieverbrauch der Bewohner verringern. Wie elii erklärt, sind die Studios wie Hotelzimmer mit einer Magnetkarte zugänglich; der Strom schaltet sich beim Verlassen der Studios automatisch ab. Man kann also ruhig vergessen, das Licht auszumachen, das System kümmert sich darum. Eine an der Decke angebrachte Anlage zeigt den Energieverbrauch des jeweiligen Nutzers in Euro an. Überdies werden die Daten an ein facebook-ähnliches soziales Netz gesendet, wo die am Netz Beteiligten die Energieverschwendung oder -sparsamkeit der Studiobewohner im Auge behalten können. Die Kommunikation zwischen den beiden Nachbarn soll durch eine Lichtanlage in der Türschleuse erleichtert werden. Die Wandbeschichtung speichert das Licht und bewahrt eine Zeit lang die Spur jedes Vorbeigehens. Man kann auch Botschaften hinterlassen, zum Beispiel indem man als Begrüssung die Hand auf die Wand legt: Der Abdruck bleibt sichtbar, wenn das Licht ausgeht. Energetisch gesehen zeugen diese Einrichtungen allerdings von einer gewissen Naivität: Die neuen Technologien verbrauchen nicht nur viel Energie, für ihre Herstellung werden mit Seltenen Erden auch wertvolle Rohstoffe benötigt. Zudem bleiben Recherchen mit einer Suchmaschine oder in einem sozialen Netzwerk, wie sie die Architekten von elii vorschlagen, nicht ohne Auswirkungen auf die Umwelt.
Das Leben auf einen Bildschirm reduziert
Insofern vermag das Projekt von elii dem Vergleich mit den Idealen der frühen Moderne nicht standzuhalten. Es ist weder modular noch funktional in dem Sinn, wie es etwa Charlotte Perriand verstand. Hier verfügt jeder Bewohner über 35 m², weit jenseits der Dichte der Cité Radieuse oder der Appartements in Les Arcs. Zudem stellt sich die Frage, ob man in diesen Studios je wirklich kochen wird – wahrscheinlicher ist, dass man sich mit dem Aufwärmen von Fertiggerichten begnügt. Vor allem aber ist der Funktionalismus der Studios derart exzessiv, dass sich kaum Leben darin entfalten kann. Für Charlotte Perriand sollte das Wohnen ein Vergnügen sein, ein täglich neues Fest; doch dafür ist ein gastlicher Raum nötig.
Ob die kühlen Einbauten und elektronischen Gadgets der beiden Studios zu einem längeren Aufenthalt einladen, ist zweifelhaft. Gäste sind erst recht unwahrscheinlich. Hier scheint alles auf einen gemeinsamen Nenner reduziert, den Bildschirm. Buchstäblich zentrales Element der Wohnung, verkündet er eine Glückseligkeit, die man nicht recht teilen mag. Die weissen Storen können «als Bildschirm dienen» (also zum Zappen), ohne die räumliche Anordnung wirklich zu verändern. Schliesslich wird in der ganzen Dokumentation des Projekts sorgfältig alles Tageslicht ausgeschlossen, obwohl sich hinter dem Fotografen in Wirklichkeit eine Fenstertür zum Balkon öffnet. Kurz: Die Aussenwelt scheint nur auf den Bildschirmen zu existieren. Unempfänglich für solche Kritik sprechen sich die Architekten für eine Architektur aus, die «über den vorherrschenden Anthropozentrismus hinausgeht» und den Menschen als einen Akteur unter anderen betrachtet, «als Knoten in einem Netz». Die Unterscheidung zwischen dem Aussen und dem Innen einer Wohnung ist für sie obsolet. «Bei einem Projekt wie diesem», erklären sie, «interessiert uns die Erkundung der architektonischen Auswirkungen einer Weltsicht, die das Wohnen als einen Raum innerhalb eines Netzes von Transaktionen und des Austauschs begreift.» Hier kommt ein Gesellschaftsbild zum Ausdruck, von dem frühere Generationen höchstens im Rahmen von abschreckenden Science-Fiction-Szenarien geträumt haben.[03] Ob eine solche Vorstellung des fast ausschliesslich virtuellen Zusammenlebens zu reellen Wohnformen führt, die das menschliche Bedürfnis nach Behaglichkeit zu befriedigen vermögen, bleibe indessen dahingestellt.
Anmerkungen:
[01] Marcel Breuer, Mode – Modern, in: Das Werk, Nr. 11/1932, S. 337–351. Die Zitate stammen von S. 337, 338 und 378.
[02] Von der zunehmenden Beschäftigung mit Charlotte Perriands Werk zeugten in den letzten Jahren diverse Ausstellungen, zum Beispiel 2005 im Centre Pompidou, 2010 im Museum für Gestaltung Zürich und 2011 im Petit Palais in Paris.
[03] Etwa in Ray Bradburys 1953 erschienenem und 1966 von François Truffaut verfilmtem Roman «Fahrenheit 451», in dem das selbstständige Denken mittels Drogen und Videowänden verhindert werden soll, weil es als antisozial gilt.TEC21, Fr., 2012.12.28
28. Dezember 2012 Anna Hohler