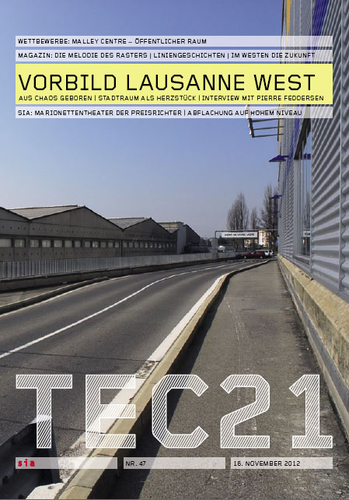Editorial
«Der Raum zwischen den Städten produziert urbane Kreativität.» Der Satz steht im klugen, vielstimmigen Buch über die ersten zehn Jahre gemeinsamer Raumplanung in Lausanne West, das am 6. Dezember endlich auch auf Deutsch erscheint (vgl. S. 11). «Allerdings nicht von selbst», möchte man nach der Lektüre anfügen. Denn der 2001 vom Kanton den acht Gemeinden im Lausanner Westen verordnete Baustopp war eher schon ein veritabler Tritt als ein Wink mit dem Zaunpfahl.
Eine stadtplanerische Vision, vom Kanton in Auftrag gegeben, dann beharrlich den acht Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten vorgetragen, setzte sich schliesslich durch: Aus dem Agglo-Chaos soll Stadt werden! Heute koordinieren die acht Gemeinden im Rahmen des Agglomerationsprogramms Lausanne-Morges und mit einem gemeinsamen Masterplan ihre Raumplanung, die Verkehrsentwicklung und alle grösseren Bauprojekte. Gemeinsam schaffen sie öffentliche Räume, machen das Gebiet durchlässig für Fussgänger und Velos, verdichten die Bebauung, mischen die Nutzungen und schaffen so allmählich städtisches Milieu. Statt Schweigen unter Nachbarn haben sich ein grosses produktives Palaver und ein «Mosaik aus ineinander verschachtelten Projekten» institutionalisiert. Renens’ Stadtpräsidentin Marianne Huguenin nennt es «institutionell intelligentes Gebastel», in dem sich Kleine zusammentun, um mit «schrittweisem Verhandeln» gross zu werden und Gewicht zu erhalten.
Ist dieser Weg ein Modell dafür, wie unsere Agglomerationslandschaften in eine nachhaltige Siedlungsstruktur umzubauen wären? Pierre-Alain Rumley, Ex-Chef des Bundesamts für Raumentwicklung, ist nicht ganz zufrieden. Er schreibt im Buch, Lausanne West könne nicht als führend bezeichnet werden, da Gemeindefusionen nicht in Betracht gezogen würden. Lausannes Alt-Stadtpräsidentin Yvette Jaggi hat hingegen Verständnis für das Autonomiestreben der Kommunen. Sie seien sich bewusst, dass sie kooperieren müssen, zögen es aber vor, sich «nach und nach und mit schrittweisen Konzessionen» (und dank finanziellen Anreizen aus dem Agglomerationsprogramm) eine gemeinsame Führung zu geben. Diesem pragmatischen Weg mangle es vielleicht etwas an Glanz, doch seine Effizienz messe sich an den Resultaten, und diese sorgten oft für positive Überraschungen. So auch in den Gemeinden in Lausanne West: Obwohl sehr verschieden und nach wie vor autonom, haben sie zusammen angefangen, ihre Gemeinden in eine Stadt umzubauen.
TEC21 beleuchtet regelmässig Grundsätze, Methoden und Beispiele einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Diese Artikel sind nun auch in einem Online-Dossier greifbar, das laufend aktualisiert wird: > Nachhaltigkeit planen.
Ruedi Weidmann
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Malley Centre – öffentlicher Raum
10 MAGAZIN
Die Melodie des Rasters | Liniengeschichten | Im Westen die Zukunft | Lebenszykluskosten-Management
16 AUS CHAOS GEBOREN
Ruedi Weidmann
Lausanne West ist ein Paradebeispiel ungeplanter Suburbanisierung. Die acht Gemeinden sind aber nun entschlossen, eine Stadt zu werden.
22 STADTRAUM ALS HERZSTÜCK
Lorette Coen, Ariane Widmer
Die Kommunen im Lausanner Westen besitzen selber kaum Bauland. Ihre Planung konzentriert sich deshalb auf Infrastruktur und öffentlichen Raum.
24 «KANN AUS DER WIRREN VIELFALT STAFDT WERDEN?»
Ruedi Weidmann
Wie macht man aus acht Agglo-Gemeinden eine Stadt? Interview
mit Pierre Feddersen, der den regionalen Richtplan Lausanne West erarbeitet hat.
28 SIA
Marionettentheater der Preisrichter | Abflachung auf hohem Niveau
33 PRODUKTE| FIRMEN
Bene | Laufen
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Aus Chaos geboren
Der Lausanner Westen ist ein Paradebeispiel ungeplanter Suburbanisierung. Acht Gemeinden sind jedoch entschlossen, zusammen ihre Zukunft in den Qualitäten der europäischen Stadt zu suchen. Was bisher fehlte, soll nun geschaffen werden: öffentlicher Raum und sanfte Mobilität, Nutzungsvielfalt und öffentlicher Verkehr – eine neue Stadt im Westen von Lausanne.
In und um Lausanne sind die Standorte klar verteilt: Im Osten Villen und stille Gärten, hier verstreicht die Zeit langsam. Im Westen dagegen Lärm und Dynamik: Fabrikareale und Arbeiterquartiere, Güterbahnhöfe und Autobahnen, Verteilzentren und Hochschulen, Einfamilienhäuser und Lagerhallen, Einkaufszentren und Tankstellen, Parkplätze, Garagen und Wohnblöcke bilden ein gewaltiges Durcheinander. Das Gebiet umfasst die westlichen Quartiere der Stadt Lausanne und die acht Gemeinden Renens, Prilly, Ecublens, Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Saint-Sulpice, Villars-Sainte-Croix. Auf der sanft gegen den See abfallenden Geländeschulter wurde 1877 der Güterbahnhof Renens angelegt. In der Folge wurden zwischen den Bauerndörfern Fabriken errichtet – allmählich entstand der heutige Flickenteppich.
Mit dem Bau der Autobahn 1964 zogen weitere Industrieunternehmen und 1970 die beiden Hochschulen aus der Enge der Stadt Lausanne hierher. In den 1990er-Jahren begann die Industrie zu serbeln und ins Ausland abzuwandern, dafür schossen nun Einkaufs- und Logistikzentren aus dem Boden. Mit 65 000 Einwohnern und 46 000 Arbeitsplätzen wäre Lausanne West die zweitgrösste Stadt in der Waadt – aber es ist eben keine Stadt. Die Gegend ist stark fragmentiert, ohne Zentrum, zu Fuss kaum zu bewältigen, fast ohne öffentlichen Verkehr und ohne öffentlichen Raum, der diesen Namen verdiente – ein typisches Agglomerationschaos. Doch die acht Gemeinden unterscheiden sich stark. So ist etwa das am Seeufer gelegene St-Sulpice wohlhabend, Renens dagegen ist arm und hat einen Ausländeranteil von über 50 %.
Stopp dem Wildwuchs
Seit 1991 führt eine Metrolinie vom Lausanner Stadtzentrum über Uni und EPFL zum Bahnhof Renens. Trotzdem fuhren im Jahr 2000 in den acht Gemeinden zwischen 67 und 94 % der Pendler mit dem Auto zur Arbeit. In jenem Jahr waren die Luftqualität so besorgniserregend, die Verkehrsüberlastung und die räumliche Desorganisation so unhaltbar geworden, dass die Kantonsregierung für Vorhaben wie Einkaufszentren und Einfamilienhauszonen, die viel Verkehr verursachen, einen Baustopp verhängte. Ein ausserordentlich hartes Vorgehen, das aber den Weg zur Zusammenarbeit ebnen sollte: Den Gemeinden wurde eine Vereinbarung vorgeschlagen, wonach sie ihre weitere Entwicklung unter der Leitung des Kantons gemeinsam koordinieren sollten.
Zunächst ging es aber darum, die vom industriellen Niedergang verursachte Mutlosigkeit zu überwinden und bewusst zu machen, über welche Trümpfe das Gebiet verfügt: eine wunderbare Lage über dem Genfersee mit Blick in die Alpen, gute Erschliessung durch Bahn und Autobahn, intakte Ortskerne, zwei Hochschulen, Baulandreserven und Verdichtungspotenzial auf Industriebrachen. Doch wegen der planlosen Überbauung war die Gegend zu unattraktiv geworden, um dieses Potenzial nutzen zu können. Nach vielen Diskussionen, vor allem mit den Gemeindepräsidenten, setzte sich die Einsicht durch, dass eine überkommunale Planung wünschenswert sei.
Überkommunale Planung
Instrument dazu ist das Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), ein Masterplan für das ganze Gebiet, der 2003/2004 von den Gemeinden, der Stadt Lausanne und vom Kanton unterzeichnet wurde und Bestandteil des Agglomerationsprogramms Lausanne-Morges und des kantonalen Richtplans ist. Der SDOL basiert auf der Raumplanungsstudie eines interdisziplinären Teams unter der Leitung des Stadtplaners Pierre Feddersen. Dieses schlug ein prinzipielles Schema für die raumplanerische Gestaltung vor und schuf ein dreidimensionales Modell, die bis heute als Referenzen dienen.[1] Feddersen setzte viel Vertrauen in die Zusammenarbeit der Gemeinden und machte daraus eine Methode: Die vier territorialen und drei thematischen «Baustellen» sind gemeindeübergreifend angelegt. Aus dem Nebenund Gegeneinander der Dörfer soll Stadt werden, Verantwortungsgefühl für das Ganze soll kommunale Partikularinteressen ablösen (vgl. S. 24).
Der SDOL strebt eine rationelle Nutzung des Baulands an. Er krempelt Lausanne West aber nicht komplett um, sondern stützt sich auf vorhandene Infrastruktur und Siedlungskerne ab, nutzt vorhandene Situationen und Ressourcen. Die neue Stadt soll eine starke Identität bekommen, zugleich sollen Autonomie und Charakter der Gemeinden erhalten bleiben. Nebst den sieben «Baustellen» ist der SDOL richtungsweisend für den Ausbau von Bahnhöfen, S-Bahn-Stationen, Bus- und Tramlinien, die Aufwertung öffentlicher Räume und die Erhaltung des industriellen Erbes. Ausserdem legt er Bedingungen für Bauvorhaben bezüglich Dichte und funktionaler Durchmischung fest.
Organisation und Werkzeuge
2003 wurde das Büro des SDOL eingerichtet. Unter der Leitung von Ariane Widmer koordiniert es mit vier Vollzeitstellen die Planungen. Es erarbeitet selbst keine Projekte, sondern beauftragt spezialisierte Firmen mit Studien und wertet die Ergebnisse aus. Die Leitung eines Planungsvorhabens liegt stets bei einer Gemeindeverwaltung. Daneben gibt es zwei koordinierende Gremien: Die «Pilotgruppe» besteht aus den Gemeindepräsidenten, zwei Regierungsräten und den Leitern der involvierten kantonalen Ämter; sie trifft alle Entscheide und trägt die politische Verantwortung. Im «Stab für die technische Leitung» treffen sich monatlich die Leiter der zuständigen Gemeindeämter und Vertreter der kantonalen Departemente, sie betreuen die einzelnen Studien, evaluieren alle wichtigen Bauprojekte im Gebiet (vgl. Kasten unten) und bereiten die Entscheide der Pilotgruppe vor.
Als Planungswerkzeuge dienen Expertenberichte, Wettbewerbe und Teststudien. Letztere erweisen sich bei komplexen Aufgaben als besonders fruchtbar: Resultate mehrerer interdisziplinärer Teams werden öffentlich verglichen und diskutiert; Fachleute und Bevölkerung erarbeiten so gemeinsam eine Vision. Jeder Eingriff verlangt nach einer sensiblen Bestandsaufnahme, muss auf einer strategischen Vision basieren und braucht Zeit für Verhandlungen, damit Gelegenheiten genutzt und Partnerschaften geschaffen werden können. Zentrales Anliegen aller Massnahmen ist die Qualität des öffentlichen Raums (vgl. S. 22).
Mit öffentlichen Räumen Bruchstücke verbinden
Der Lausanner Westen besteht aus untereinander nicht verbundenen Teilstücken – eine Folge grosser Bahn- und Strassenbauten, aber auch von vielen ohne Blick auf das Gesamte errichteten Einzelgebäuden. Die für den Transitverkehr ausgelegten Strassen führen strahlenförmig von Lausanne weg und trennen die Agglomerationsteile, statt sie zu verbinden. Da sie nur für Autos konzipiert sind, eignen sie sich für die heutigen Bedürfnisse nicht. Heute wird jedes Bauvorhaben als Chance gesehen, Räume zu schaffen, mit denen sich die Bevölkerung identifizieren kann. Öffentliche Räume – Plätze, Parks, Wege, Brücken, Strassen und Vorgärten – schaffen Durchlässigkeit und verknüpfen, was zusammengehört, wenn eine Siedlung eine hohe Lebensqualität aufweisen soll. Die grosse Aufgabe besteht also darin, eine Stadt mit urbanen Qualitäten zu schaffen. Im suburbanen Kontext heisst das: den Autoverkehr reduzieren und kanalisieren, den öffentlichen Verkehr fördern, Wege für die sanfte Mobilität öffnen, öffentliche Räume schaffen, die Bebauung verdichten, die Funktionen sinnvoll mischen und die Zersiedelung stoppen. Dabei helfen Bundesgelder aus dem Agglomerationsprogramm.
Die neue Stadt, die in den nächsten zehn Jahren etwa 30 000 neue Einwohner aufnehmen soll, wächst nicht vom historischen Zentrum Lausanne aus, sondern soll im Westen geboren werden und ihre Gestalt aus eigenen Qualitäten entwickeln. Die Studienphase ist abgeschlossen. Die Ausgaben von Gemeinden, Kanton und Bund werden auf mehrere hundert Millionen Franken geschätzt; dazu dürften private Investitionen von mehreren Milliarden kommen.
Sieben Baustellen – viele Projekte
Der SDOL hat sieben sogenannte «Baustellen» festgelegt. Vier davon sind strategische Teilgebiete (Karte S. 17), drei weitere betreffen übergreifende Aufgaben im gesamten Planungsgebiet. Jede Baustelle ist in Teilgebiete unterteilt, die Gegenstand spezifischer Analysen sind, und enthält zahlreiche, unterschiedlich weit gediehene Projekte – insgesamt sind es bisher rund 70, viele weitere werden aber in den nächsten Jahren hinzukommen. Die wichtigsten Baustellen und Projekte werden auf den folgenden Seiten vorgestellt.[2]
Anmerkungen:
[01] Schéma directeur de l’Ouest lausannois, verfasst von Feddersen & Klostermann, Plarel S.A., CEAT, Transitec, Metron, Joël Christin, Renens 2003. Bezug beim SDOL-Büro, www.ouest-lausannois.ch
[02) Weitere Informationen finden sich im Buch «Im Westen die Zukunft» (vgl. S. 11), in der Ausstellung «Pièces à Conviction» (vgl. S. 38) und auf der Internetseite des SDOL: www.ouest-lausannois.chTEC21, Fr., 2012.11.16
16. November 2012 Ruedi Weidmann
Stadtraum als Herzstück
Die Gemeinden im Lausanner Westen besitzen fast keine eigenen Bauflächen. Ihre gemeinsame Planung konzentriert sich deshalb auf die Infrastruktur und den öffentlichen Raum. Dieser bildet das Herzstück des Planungsansatzes, der auf einer Landschaftsstudie basiert.
Vor der Vergabe des Wakkerpreises 2011 waren sich wenige bewusst, dass vor den Toren Lausannes ein grosses, ganz neuartiges städtebauliches Vorhaben im Gange ist. Die Tatsache, dass neun Waadtländer Gemeinden [acht Gemeinden plus Stadt Lausanne, d. Red.] sich zusammenschlossen, um gemeinsam die prognostizierten demografischen Veränderungen zu bewältigen, war lediglich Teil der lokalen Berichterstattung. Das Ganze wurde diskret in Angriff genommen und auch so weitergeführt. Diese Bescheidenheit, die auch mit der politischen Situation der Region zu tun hat, stellte eine erste Chance dar für den Westen von Lausanne. Die zweite hängt mit den wirtschaftlichen Problemen zusammen: Diese verlangten zwingend nach Veränderungen, und zwar schnell. Denn dieses Gebiet mit den Hochschulen, das als künftiger Entwicklungsschwerpunkt von mindestens europäischer Bedeutung erkannt wurde, war nie Gegenstand von stadtplanerischen Überlegungen gewesen, die diesen Namen verdient hätten. So wie es sich präsentierte, war es für die gehegten Ambitionen unbrauchbar.
Als Pierre Feddersen, Architekt, Stadt- und Landschaftsplaner sowie Urheber des Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), des Masterplans Lausanne West, ungefähr im Jahr 2000 die betroffenen Gemeinden kontaktierte, war der Empfang ziemlich kühl. «Es fing schlecht an», erzählt er. «Zuerst musste ich die Behörden davon überzeugen, dass dieses Gebiet über ein riesiges Potenzial verfügt.» Damals neigte der Westen von Lausanne eher dazu, in Anbetracht der Schliessung zahlreicher Industriebetriebe in Trübsal zu versinken. Der Leerlauf war jedoch von kürzerer Dauer als befürchtet, die Region richtet sich im dritten Sektor neu aus und ist bereit für ein grosses Vorhaben. Die Umsetzung des Masterplans Lausanne West ab 2003 geschah zu einem entscheidenden Zeitpunkt.
Umfassende Landschaftsplanung
Die wichtigste Besonderheit und das Kapital dieses Raumplanungsprojekts besteht in der ausserordentlichen Tatsache, dass es auf einer Landschaftsstudie basiert, die 2001 im Rahmen der Revision des kantonalen Richtplans erstellt wurde. Die Autoren der Studie skizzieren in groben Zügen bereits die Philosophie, an der sich das Büro des SDOL bei seiner Arbeit bis heute orientiert. In der Studie steht die entscheidende Bemerkung: «Die Landschaft der Peripherie, die Schritt um Schritt vom Gebauten besetzt wurde, ‹die Masse›, verlangt nach einer Neugestaltung und Aufwertung durch den ‹Leerraum›. Der unbebaute, frei gebliebene ‹Leerraum› stellt das verletzlichste Element in der städtischen Komposition dar, denn diese Bereiche werden von der urbanen Entwicklung beansprucht. Das in dieser Studie empfohlene Vorgehen besteht in einer Herangehensweise an die Landschaft, die die soziokulturellen, ökologischen und wirtschaftlichen Werte mit einbezieht, denn sie sind entscheidende Komponenten für eine nachhaltige Entwicklung. Die fehlende Sensibilität, um nicht zu sagen Emotion, in der aktuellen Gestaltung zeigt, wie notwendig es ist, dem Lebensumfeld grössere Aufmerksamkeit zu schenken und sich auf die soziale Dimension, die die Umgebung im Alltag spielt, zurückzubesinnen. Die grösste Herausforderung besteht darin, eine verlorene Landschaft wiederherzustellen.»1 Das Team des SDOL-Büros übernimmt diese Zielsetzung und stellt den öffentlichen Bereich ins Zentrum seiner Stadtplanung: Den öffentlichen Räumen gebührt Respekt. Die Arbeit besteht darin, zu verbinden, wieder zusammenzunähen und den Unorten Qualität zu verleihen, indem man ihnen einen Sinn zuweist. Man interessiert sich für die Zwischenräume genauso wie für grossflächige Räume. Man räumt Hindernisse aus dem Gelände, um Fussgängerverbindungen oder auch grosse Verkehrsachsen zu fördern, man bietet Haltestellen an, Treffpunkte, Orte zum Verweilen. Im bestehenden Stadtgeflecht verbindet man die Stadtfragmente miteinander und versieht sie mit allen notwendigen Qualitäten.
Methodischer Pragmatismus
Sollen solche Vorhaben gelingen, braucht es die Fähigkeit, gleichzeitig auf allen Stufen mit Fantasie, Geschicklichkeit und Geduld aktiv zu sein. Sie verlangen auch nach Offenheit im Denken und Handeln: auf die Annehmlichkeiten der Spezialisierung verzichten zugunsten differenzierter Kenntnisse über das Gebiet. Die vom Büro des SDOL entwickelte Stadtplanung basiert natürlich auf einem Übersichtsplan, vermeidet jedoch übermässiges Vorbestimmen und gibt Erfinderischem den Vorzug. Sie konzentriert sich auf den Prozess, stellt Strukturen bereit, die das Projekt tragen können und ihm ermöglichen, sich auszubreiten. Der Stadtplaner gibt den Anstoss, setzt dann auf die Richtigkeit seiner Empfehlungen und zählt auf die Stärke der Personen, die sie umsetzen. Hierin liegt auch das Interesse des Vorhabens im Lausanner Westen: statt auferlegter Planung methodischer Pragmatismus. Dieser lässt der persönlichen Initiative grossen Freiraum. Er basiert auf dem Vorrang des Lokalen sowie auf systematischen Verhandlungen und auf einem Geflecht von unterschiedlichen, auf die Bedürfnisse abgestimmten Vereinbarungen. Mit anderen Worten: ein Planungsinstrument ganz im Sinne der politischen Gepflogenheiten in der Schweiz.
Im Gegensatz zu einer am Zeichentisch durchgeplanten Metropole am Genfersee sehen wir hier eine Region, bei deren Entstehung man auf die Wechselwirkungen zwischen Leitideen und der Arbeit vor Ort aufbaut. Zusätzlich bemerkenswert ist, dass das urbane Projekt des Bezirks Lausanne West nicht vom Zentrum Richtung Peripherie ausstrahlt, vom Grossen zum Kleinen, oder, anders ausgedrückt, von Lausanne zu den Nachbargemeinden. Es wird absichtlich und bewusst im Westen geleitet und konzipiert, für und durch ihn.
Aber diese schöne Autonomie kann zur Achillesferse des Vorhabens werden, das sich nun in der operativen Phase befindet. Die Region erlebt nämlich einen grossen Immobilienboom. Werden sich die Gemeinden von Lausanne West dem enormen Druck der Spekulation entziehen können? Was für eine Regelung braucht es, um sie davor zu schützen? Da sie in den seltensten Fällen über die Grundstücke verfügen, sind sie zur Realisierung der Ziele des Masterplans von den Eigentümern und Investoren abhängig. Dies zu einem Zeitpunkt, da sie sich anschicken, zig Millionen in die Finanzierung der Infrastrukturen zu stecken. Um ihr Raumplanungsprojekt zu schützen, das Gefahr läuft, auf Abwege zu geraten, werden sie ungleich grössere Verhandlungs- und Führungsmittel einsetzen müssen, als sie es gewohnt sind. Den Lockrufen der Bereicherung gilt es eine geschlossene Front sowie einen geeinten politischen Willen entgegenzusetzen. Es geht darum, das Verteidigen der rein kommunalen Interessen hinter sich zu lassen, um im Westen die Zukunft zu sehen.
Dieser – hier leicht gekürzte – Artikel erscheint demnächst unter dem Titel «Öffentlicher Raum, Herzstück der Stadtplanung» im Buch «Im Westen die Zukunft» (vgl. S. 11).TEC21, Fr., 2012.11.16
16. November 2012 Lorette Coen, Ariane Widmer Pham