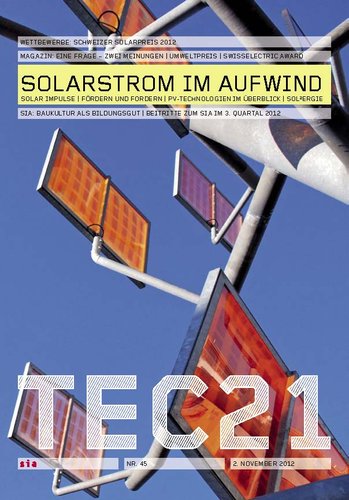Editorial
Die Energiestrategie des Bundesrats sieht vor, den Anteil der Photovoltaik an der Deckung des Schweizer Strombedarfs von heute 0.5 % auf 19 % im Jahr 2050 zu erhöhen. Dies entspricht einem Wachstum auf das 38-fache in weniger als 40 Jahren.
Wie das gehen soll, ist alles andere als klar. Über die politischen und ökonomischen Mittel scheiden sich die Geister: Ist die Förderung der Photovoltaik nützlich? Wird Innovation durch Subventionen beflügelt oder gehemmt? Gefordert sind auch Raumplanung, Gesetzgebung und Architektur: Ist es vertretbar, Kulturland und Naturschutzgebiete für den Bau von Solaranlagen zu opfern? Sollen Baubewilligungen für grosse Industrie- und Gewerbebauten an die Auflage geknüpft sein, die Dachfläche für Solaranlagen zur Verfügung zu stellen? Ist es im Sinne der kulturellen Nachhaltigkeit, wenn jedes Gebäude mit Kleinstanlagen bestückt wird? Selbst wenn all diese Fragen geklärt wären, bleibt immer noch die Herausforderung, die über dezentral gelegene Solaranlagen gewonnene Energie ins bestehende Elektrizitätsnetz zu integrieren und – da sie nicht kontinuierlich anfällt – zu speichern.
Im Rahmen unserer Heftreihe «Energiewende» nähern wir uns aus unterschiedlichen Richtungen diesem hochkomplexen Thema (TEC21 7/2012, 12/2012, 15-16/2012, 25/2012, 29-30/2012 und 38/2012). Die vorliegende Ausgabe fokussiert auf die technischen Aspekte der Photovoltaik. Die gute Nachricht kommt zuerst: Im Interview «Wir wollen den Pioniergeist stimulieren» betont André Borschberg, Partner von Bertrand Piccard bei «Solar Impulse», dass visionäre Projekte auch mit heutigen Technologien möglich sind; die hohe Ingenieurskunst besteht darin, sie geschickt einzusetzen. Und was die Verwirklichung der Energiestrategie 2050 angeht: «Solarstrom: fördern und fordern» gibt zwar keine endgültigen Antworten, trägt aber die wichtigsten Fakten und Diskussionspunkte zu den oben gestellten Fragen zusammen. «Photovoltaik-Technologien im Überblick» beschreibt und vergleicht die unterschiedlichen Ansätze, die es in der Photovoltaik gibt, hinsichtlich Eigenschaften, Ausgangsmaterialien und grauer Energie. Ergänzende Informationen zu Technologien, die erst an der Grenze zur Marktreife stehen, finden sich in der Rubrik «Magazin» auf S. 14 und 16. «Von der Sonne zur Erde und wieder zurück» präsentiert ein System für die Gewinnung, Speicherung und Transformation solarer Energie im Gebäudebereich. Und nicht zuletzt stellen wir in der Rubrik «Wettbewerbe» die Gewinner des Schweizer Solarpreises 2012 vor.
Die nächste Ausgabe von TEC21 wird direkt an diese anknüpfen und sich Pumpspeicherwerken widmen, denen bei der Speicherung des Solarstroms grosse Bedeutung zukommt. Im kommenden Jahr folgt dann eine Ausgabe, in der wir uns auf die architektonische Integration von Solarthermie und Photovoltaik konzentrieren.
Claudia Carle, Judit Solt
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Schweizer Solarpreis 2012
12 PERSÖNLICH
Eine Frage – zwei Meinungen
14 MAGAZIN
Bücher und Film | Deutscher Umweltpreis | swisselectric research award 2012
24 «WIR WOLLEN DEN PIONIERGEIST STIMULIEREN»
Claudia Carle
André Borschberg, CEO von Solar Impulse, spricht über die Herausforderungen und Ziele beim Bau eines Solarflugzeugs, das auch nachts fliegen kann.
28 SOLARSTROM: FÖRDERN UND FORDERN
Lukas Denzler
In die Photovoltaik werden grosse Hoffnungen gesetzt. Wie rasch
sie ausgebaut und wie sie gefördert werden soll, scheidet jedoch die Geister.
33 PHOTOVOLTAIK-TECHNOLOGIEN IM ÜBERBLICK
Stephan Buecheler
Wir vergleichen die heute relevanten Photovoltaik-Technologien,
stellen ihre jeweiligen Charakteristika vor und zeigen ihre Vor- und Nachteile auf.
37 VON DER SONNE ZUR ERDE UND WIEDER ZURÜCK
Hansjürg Leibundgut
Die Professur für Gebäudetechnik der ETH Zürich präsentiert ein System von Technologien für den emissionsfreien Betrieb von Gebäuden.
43 SIA
Baukultur als Bildungsgut | Beitritte zum SIA im 3. Quartal 2012
48 PRODUKTE
Geze | Domotec | Asatec | Stiebel Eltron | HBT-ISOL | Schilliger Holz | Similor
61 IMPRESSUM
62 VERANSTALTUNGEN
«Wir wollen den Pioniergeist stimulieren»
Vor 13 Jahren umrundete Bertrand Piccard zusammen mit dem Briten Brian Jones die Welt im Ballon – und verbrauchte dafür 3.7 Tonnen Propangas. Nach der Landung beschloss er, dieses Wagnis zu wiederholen, diesmal allerdings ohne den Verbrauch fossiler Brennstoffe. Für die Realisierung seines Vorhabens rief er 2004 gemeinsam mit dem Ingenieur und Piloten André Borschberg das Projekt «Solar Impulse» ins Leben. Mit einem Team verschiedenster Spezialisten konstruierten sie in Dübendorf ein rein mit Solarenergie betriebenes Flugzeug, das auch nachts fliegen kann und in dem sie 2015 die Welt umrunden wollen.
TEC21: Worin lag die grösste Herausforderung beim Bau des Solar-Impulse-Flugzeugs?
André Borschberg (A. B.): Die Herausforderung war, ein Flugzeug von der Grösse eines Airbus zu bauen, das nicht mehr wiegt als ein mittelgrosses Auto – insgesamt nur 1600 kg. Es musste also im Verhältnis zur Grösse fünfmal leichter sein als ein Segelflugzeug. Unsere Aufgabe bestand folglich darin, ein anderes Design und andere Materialien zu finden, als sie bei Segelflugzeugen oder anderen sehr leichten Flugzeugen verwendet werden. Ausserdem benötigte das Flugzeug eine sehr grosse Flügelspannweite, um die aerodynamische Effizienz zu optimieren, also das Verhältnis von Auftrieb zu Widerstand. Wichtig ist, eine möglichst kleine Sinkgeschwindigkeit zu erreichen.[1] Bei einem Flugzeug mit grosser Flügelspannweite müssen die Flügel natürlich eine hohe Steifigkeit aufweisen.
TEC21: Welche technischen Neuentwicklungen stecken in Ihrem Solar-Impulse-Flugzeug?
A. B.: Die Entwicklung eines neuen Batterietyps oder einer neuen Solarzelle dauert mindestens 10 bis 15 Jahre und kostet enorm viel. Unser Ziel war daher eher, bestehende Technologien zu nutzen, sie anzupassen und zu verbessern, statt neue zu entwickeln.
TEC21: Können Sie ein Beispiel nennen?
A. B.: Wir haben z. B. das Gewebe – einen speziellen Polyurethanschaum – verbessert, aus dem das Cockpit und die Motorgondel bestehen. Es gibt der Gondel die Form und sorgt für die Wärmeisolation, um die Temperatur der Batterien in der Gondel auf dem optimalen Niveau zwischen 20 bis 50 °C zu halten und dafür keine Energie einsetzen zu müssen. Teilweise haben wir auch andere Materialien als üblich eingesetzt, z. B. Kunststoff statt Metall für Schrauben, Scharniere oder Elektronikgehäuse.
TEC21: Lassen sich diese Weiterentwicklungen auch in anderen Bereichen als dem Flugzeugbau nutzen?
A. B.: Es ist uns zum Beispiel zusammen mit zwei unserer Partnerfirmen gelungen, die Batterien durch Verbesserung des Elektrolyten und den Einsatz von Carbon-Nanotubes in den Elektroden leichter zu machen. Diese Batterien können nun auch für Autos oder andere Anwendungen genutzt werden. Wir haben ungefähr 80 Partner und Zulieferer, von denen gerade einmal zwei aus der Luftfahrt kommen. Die anderen sind daran interessiert, Technologien für ihre Märkte und ihre Kunden ausserhalb der Luftfahrt zu entwickeln, beispielsweise hocheffiziente Motoren oder leichtere Solarzellen. Selbst Entwicklungen, die Solar Impulse letztlich nicht anwenden konnte, nutzen die Firmen teilweise als Produkte für andere Märkte.
TEC21: Was für Solarzellen verwenden Sie?
A. B.: Wir haben das Optimum zwischen Effizienz und Gewicht gesucht und verwenden monokristalline Siliziumzellen. Sie weisen einen Wirkungsgrad von 22 bis 23 % auf, sind sehr dünn (rund 150 μm), sehr leicht und ziemlich biegsam.
TEC21: Müssen Sie die Flugrichtung nach dem Sonnenstand ausrichten, damit die Solarzellen optimal von der Sonne beschienen werden?
A. B.: Nur im Notfall, wenn die Energieversorgung ungenügend sein sollte, zum Beispiel wenn wir während der Nacht wegen Gegenwind mehr Energie als üblich verbraucht haben und die Batterien am frühen Morgen fast leer sind. Dann würden wir von der Sonne wegfliegen, damit der Winkel der Solarzellen zur Sonnenstrahlung besser ist.
TEC21: Können Sie auch bei wolkigem Wetter oder an Wintertagen fliegen? Reicht dann die Leistung der Solarzellen sowohl für den Flug als auch für die Speisung der Batterien aus?
A. B.: Wenn man nur während des Tages fliegen möchte, ist das kein Problem. Bei bedecktem Himmel gelangen immer noch mindestens 40 % der Sonnenstrahlung durch die Wolken. Damit können wir problemlos fliegen. Wenn wir aber Tag und Nacht fliegen möchten, brauchen wir optimale Wetterbedingungen oder müssen über den Wolken fliegen können, denn da benötigen wir die maximale Leistungsfähigkeit der Solarzellen. Wenn das einfacher wäre, hätten es andere schon gemacht.
TEC21: Als Pilot sind Sie im Cockpit extremen Bedingungen ausgesetzt, weil es aus Gewichtsgründen nicht wärmegedämmt ist und über keinen Druckausgleich verfügt. Sie haben einzig einen Schutzanzug und eine Sauerstoffmaske. Wie fühlen Sie sich als Pilot bei einem Flug bei – 20 °C und dem niedrigen Luftdruck in knapp 9000 Metern Höhe?
A. B.: Das ist eine Sache der Gewöhnung und des Trainings. Aber trotzdem merkt man, dass man als Mensch da oben nicht in seiner natürlichen Umgebung ist, daher sehr empfindlich ist und sehr vorsichtig sein muss. Schon kleine Probleme oder Fehler könnten fatal sein. Einmal habe ich zum Beispiel weniger Kleidung angezogen, weil geplant war, dass ich die meiste Zeit in niedriger Höhe über die Sahara fliege. Schliesslich musste ich dann doch länger in grösserer Höhe bleiben bei Temperaturen von –40° und –20 °C im Cockpit. Ich habe sehr gefroren und konnte nichts dagegen tun als möglichst schnell hinunterzufliegen. In 8700 m Höhe kann man ohne Sauerstoffzufuhr auch nach ein bis zwei Minuten schon bewusstlos werden, daher wird die Sauerstoffkonzentration im Blut laufend überwacht
TEC21: Bei der Weltumrundung wollen Sie bis zu fünf Tage und Nächte am Stück fliegen. Sie haben aber keinen Kopiloten, mit dem Sie sich abwechseln können, und im jetzigen ersten Solar-Impulse-Flugzeug auch keinen Autopiloten. Wie funktioniert das mit dem Schlafen?
A. B.: Im zweiten Solar-Impulse-Flugzeug wird es einen Autopiloten geben. Ich habe das gerade für einen 72-Stunden-Flug im Flugsimulator getestet. Dabei habe ich mich etwa zehnmal pro 24 Stunden je 20 Minuten ausgeruht, also insgesamt drei Stunden. Aus Sicherheitsgründen geht das aber nur, wenn man über Meer fliegt.
TEC21: Und in der Zeit würde der Autopilot übernehmen?
A. B.: Ja, und auch ein spezielles elektronisches Gerät, das wie ein virtueller Kopilot überwacht, was das Flugzeug macht, und den Piloten weckt, wenn es ein Problem gibt. Ausserdem bin ich die ganze Zeit über via Satellitentelefon mit dem Kontrollzentrum in Payerne in Verbindung, das auch Flugzeugdaten wie Position, Geschwindigkeit, Energierproduktion, Ladezustand der Batterien etc. erhält. Dort können sie mich ausserdem über eine Kamera sehen.
TEC21: Das klingt nicht sehr erholsam.
A. B.: Wir haben zusammen mit Forschern und Medizinern überprüft, ob ich bei diesem Schlafverhalten die erforderlichen Fähigkeiten behalte. Die Ergebnisse waren sehr positiv. Für mich ist das eine gute Strategie, die ich mehrfach geübt habe. Für eine andere Person müsste man das aber vielleicht anders lösen.
TEC21: Ist die Steuerung eines so leichten Flugzeugs anspruchsvoller als die anderer Flugzeuge?
A. B.: Wenn die Luft ruhig ist, ist das Flugzeug sehr einfach zu fliegen. Dann können Sie es mit zwei Fingern kontrollieren. Aber wenn es böig ist, braucht es viel Kraft und Aufmerksamkeit. Die Arbeit, die man dann als Pilot leisten muss, ist viel anspruchsvoller als bei einem normalen Motorflugzeug oder auch einem Segelflugzeug. Problematisch sind vor allem Turbulenzen über den Bergen oder eine starke Thermik. Deshalb starten und landen wir normalerweise früh am Morgen oder nach Mitternacht und meiden Gebiete mit starken Turbulenzen.
TEC21: Sie sind dabei, das zweite Solar-Impulse-Flugzeug zu bauen. Wie wird es sich vom ersten unterscheiden?
A. B.: Äusserlich nicht stark. Lediglich die Flügelspannweite wird mit 70 m noch etwas grösser sein. Aber alle Komponenten und Materialien wurden nochmals verbessert, beispielsweise die Motoren, die Batterien, die Solarzellen. Die Leistung des Flugzeugs wird daher noch besser sein. Auch das Cockpit wurde für lange Flüge angepasst: Für Flüge von bis zu fünf Tagen und Nächten braucht man ein grösseres Cockpit, damit man sich etwas bewegen kann.
TEC21: Welche weiteren Schritte planen Sie bis zur Weltumrundung?
A. B.: Nächstes Jahr möchten wir mit dem ersten Solar-Impulse-Flugzeug in den USA von Los Angeles nach New York fliegen. Ende 2013 soll dann das zweite Flugzeug fertig sein, mit dem wir 2014 Testflüge machen werden. 2015 wäre dann die Weltumrundung.
TEC21: Solar Impulse übermittelt eine Botschaft. Welche Wirkung erhoffen Sie sich davon?
A. B.: Zum einen möchten wir den Pioniergeist stimulieren, denn das ist es, was wir in der Gesellschaft jetzt brauchen, um aus der Rezession zu kommen. Die Leute haben Angst vor Veränderungen. Wir von Solar Impulse wollen zeigen, dass man Dinge anders tun kann als die ganzen Jahre zuvor. Zum zweiten möchten wir das Potenzial bestehender Technologien zeigen. Durch die intelligente Nutzung dieser Technologien können wir unter Beibehaltung unserer Lebensqualität viel Energie einsparen. Die einfachste Variante ist die Wärmedämmung von Gebäuden. Ein weiteres Ziel ist natürlich, das Potenzial erneuerbarer Energien zu demonstrieren.
TEC21: Es geht Ihnen also mehr um eine generelle Botschaft und gar nicht so sehr darum, das Fliegen mit Solarenergie zu propagieren?
A. B.: Das ist absolut richtig. Wir glauben, dass es bei Flugzeugen viel schwieriger ist und entsprechend länger dauern wird, das Erdöl zu ersetzen, weil dort das Gewicht eine wesentliche Rolle spielt. Man sollte lieber zuerst aufhören, Gebäude mit Öl zu heizen, und sich das Erdöl für die Zwecke aufsparen, wo es schwierig zu ersetzen ist.
Anmerkung:
[01] Die Sinkgeschwindigkeit ist die vertikale Geschwindigkeit, wenn keine Maschine läuft.
Literatur:
Solar Impulse HB-SIA, Editions Favre SA, Lausanne 2010. Mit der Sonne um die Welt. Ein Film von Henri de Gerlache, Gedeon Programme 2011.TEC21, Fr., 2012.11.02
02. November 2012 Claudia Carle