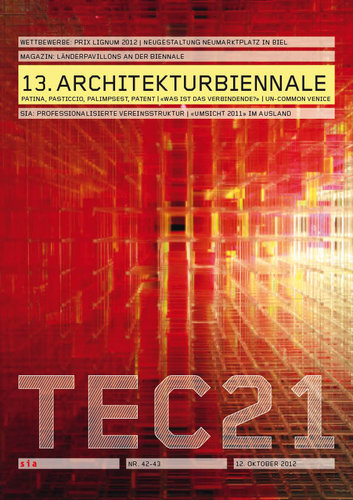Editorial
Alle zwei Jahre, alternierend mit der Kunstbiennale, richtet Venedig seit 1980 die grösste internationale Architekturausstellung Europas aus. In den 28 Länderpavillons in den Giardini und in weiteren, in der ganzen Stadt verteilten Lokalitäten präsentie-ren sich Nationen aus allen Kontinenten. Der Arsenale – die riesige, auf das 16. Jahrhundert zurückgehende ehemalige Schiffswerft – und der Hauptpavillon in den Giardini beherbergen zudem eine thematische Hauptausstellung, die unter der Ägide eines Gastkurators oder einer Gastkuratorin Exponate von namhaften Architekturschaffenden aus aller Welt versammelt. Dieses Jahr hat der britische Architekt David Chipperfield mit dem Thema «Common Ground» nicht weniger als 119 Teilnehmende mobilisiert. Hinzu kommt ein reichhaltiges Rahmenprogramm mit Vorträgen, Tagungen und Ausstellungen.
Einmal mehr zeigt sich: Auch wenn diese Flut von Beiträgen nicht nur Höhepunkte beinhaltet, lohnt sich ein Besuch der Biennale auf jeden Fall. Die von Chipperfield kuratierte Hauptausstellung ist in Bezug auf inhaltliche Dichte und Fokussierung besonders gelungen, und auch in den Länderpavillons findet sich sehr viel Sehenswertes. Alles zu besichtigen ist allerdings kaum möglich. Und selbst bei selektiver Betrachtung fällt es zuweilen schwer, Belangloses von Relevantem zu trennen, thematische Zusammenhänge herzustellen und die Informationen zu bündeln.
Wir haben es dennoch versucht und sind gemeinsam mit den Redaktionen unserer Schwesterzeitschriften Tracés und archi sowie unserer Onlineplattform als Team nach Venedig gereist. Das Ergebnis unserer Reflexion ist in verschiedenen Artikeln dieser vier Medien nachzulesen; auf sind alle Beiträge als Dossier versammelt.
Dieses Heft konzentriert sich auf die Hauptausstellung und auf den Beitrag im Schweizer Pavillon. In «Patina, Pasticcio, Palimpsest, Patent» spüren wir den inhaltlichen Zusammenhängen zwischen den Exponaten der Hauptausstellung nach und entdecken ein komplexes, selbst für gute Kenner der Architekturgeschichte anspruchsvolles Gewebe von Referenzen und Bezügen. «Un-common Venice» beschäftigt sich damit, was öffentlicher Raum in Venedig bedeuten kann. «Was ist das Verbindende?» ist die Frage, die wir an die Kuratoren des Schweizer Pavillons gerichtet haben; die Suche nach einer Antwort geht über den konkreten Ausstellungsbeitrag hinaus und wirft ein Licht auf das gesamte helvetische Architekturschaffen.
Und nicht zuletzt stellen wir als zusätzliche Inspiration einige ausgewählte Länderpavillons vor. Wer die 13. Architekturbiennale in Venedig besuchen möchte, hat dazu noch bis am 25. November 2012 Gelegenheit.
Tina Cieslik, Rahel Hartmann Schweizer, Judit Solt, Andrea Wiegelmann
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Prix Lignum 2012 | Neugestaltung Neumarktplatz in Biel
14 MAGAZIN
Länderpavillons an der Biennale
22 PATINA, PASTICCIO, PALIMPSEST, PATENT
Rahel Hartmann Schweizer
Diese Architekturbiennale erweist der Lagunenstadt die Reverenz. Die Installationen im Arsenale und in den Giardini verbindet ein Fluss, der zwischen zahlreichen Inspirationsquellen mäandriert. Das ist es, was einen mitreisst.
28 «WAS IST DAS VERBINDENDE?»
Judit Solt, Andrea Wiegelmann
Miroslav Šik, Miller & Maranta und Knapkiewicz & Fickert sind die Kuratoren der Ausstellung «And now the Ensemble!» im Schweizer Pavillon. Sie diskutierten mit TEC21 über ihre Zusammenarbeit und Bilder in der Architektur.
33 UN-COMMON VENICE
Rahel Hartmann Schweizer
Der Titel des Beitrags von Case Studio VOGT, «Un-common Venice», ist mehr als ein Wortspiel mit dem Motto «Common Ground». Er fängt mit den Studierenden das «Gemeine» ein und fördert das Ungewöhnliche zutage.
37 SIA
Neue Vernehmlassung der Norm SIA 180 | Vernehmlassung der Norm SIA 270 | Professionalisierte Vereinsstruktur | Grundlagen
zu einem Suffizienzpfad | «Umsicht 2011» im Ausland | Ausser Spesen nichts gewesen?
42 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
«Was ist das Verbindende?»
Miroslav Šik hat – zusammen mit den Architekturbüros Miller & Maranta aus Basel und Knapkiewicz & Fickert aus Zürich – an der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig die Ausstellung im Schweizer Pavillon realisiert. Unter dem Titel «And now the Ensemble!» gehen die Aussteller der Frage nach, was das Verbindende in der Architektur ausmacht. Im Hof des Schweizer Pavillons diskutierten sie am Eröffnungstag mit TEC21 über ihre Zusammenarbeit und die Bedeutung von Bildern in der Architektur.
Mittwochnachmittag am Eröffnungstag der 13. Architekturbiennale in Venedig: Miroslav Šik kommt von einer Diskussionsveranstaltung im Deutschen Pavillon, bei der es darum ging, die Ausstellungen im Schweizer und im deutschen Pavillon zu vergleichen. Dabei entzieht sich die Frage nach dem Wert der vorhandenen Bausubstanz, die der Generalkommissar Muck Pezet im deutschen Pavillon thematisiert, genauso jeder eindeutigen Antwort wie die Suche des Schweizer Teams nach dem Verbindenden (zum deutschen Pavillon vgl. S. 14). Das Interview ist Reflektion und Weiterführung dieser Diskussion, die auch die Frage nach der Bedeutung von Referenzen, gemeinsamen Hintergünden und Arbeitsweisen der drei Büros wie der Architektenschaft im Allgemeinen stellt. Versteht man die diesjährigen Aussteller als offizielle Vertreter der Schweizer Architektur, dann wäre das Gemeinsame im Schweizer Architekturschaffen nicht in formalen oder technischen Aspekten zu suchen, sondern in der Entwurfsmethodik: Der Bezug auf den Kontext und das Beiziehen von Referenzbildern sind verbreitet. Auch wenn es Unterschiede in der Auslegung gibt, scheint es eine verbindende Komponente zu sein – es ist sicher kein Zufall, dass Valerio Olgiati im Arsenale eine Sammlung von Referenzbildern bekannter Architektinnen und Architekten präsentiert (vgl. «Patina, Pasticcio, Palimpsest, Patent», S. 22).
TEC21: Miroslav Šik, Sie kommen gerade vom deutschen Pavillon. Ein wichtiger Unterschied zwischen der Ausstellung im Schweizer und jener im deutschen Pavillon ist, dass Letztere von einer Einzelperson kuratiert wurde, während Sie das Fresko und die begleitenden Räume im Team entwickelt und umgesetzt haben. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Miroslav Šik (MŠ): Pro Helvetia wollte zunächst etwas über mich sehen; Šik als Lehrer, als Architekt, als Theoretiker. Es wäre eine Rückschau geworden. Ich aber wollte nach vorne schauen und Dinge thematisieren, die mich beschäftigen. Ich wollte meine Arbeit als Architekt reflektieren; eben kontextgebundene Architektur. Im Grunde machen das viele Schweizer Büros, Entwerfen ist bei uns kontextgebunden. Darum habe ich entschieden, für diese Reflektion noch weitere Büros beizuziehen. Wir fünf haben bereits im Rahmen des Projekts «Andermatt Swiss Alps» des Unternehmers Samih Sawiris zusammengearbeitet. Das soll aber nicht heissen, dass alles harmonisch verlaufen ist: Wir haben auch gekämpft und miteinander gerungen. Die Idee der Collage gab es nicht von Anfang an; auch dass Bruno Giacomettis Pavillon ein wichtiger Protagonist in unserer Ausstellung sein müsse, haben wir nicht sofort verstanden.
Quintus Miller (QM): Im ersten Moment war es für uns nicht offensichtlich, wie diese Zusammenarbeit aussehen könnte. Wir haben alle sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Aber dann haben wir innerhalb von einigen Sitzungen herausgefunden, wo unsere gemeinsame Stärke liegen kann. Wir respektieren einander im hohen Masse und schätzen uns als Kollegen.
TEC21: Was waren die ersten Ideen, und wie kam es schliesslich zur Umsetzung des Freskos?
MŠ: Die Idee zum Fresko ergab sich aus unseren Diskussionen, sie ist Produkt des Prozesses. Irgendwann haben wir gesagt: Wenn wir von Ensemble reden, dann lasst uns auch ein Ensemble bilden! Die Art der Ausführung ist ebenfalls aus dieser Diskussion entstanden. Es war Axels Idee, die ursprünglich geplante Blackbox aufzuheben, die Architektur des Pavillons in unsere Ausstellung zu integrieren und folgerichtig mit Tageslicht zu arbeiten.
Axel Fickert (AF): Der Wunsch, ein Ensemble umzusetzen, stand relativ am Anfang – dorthin wollen wir ja auch mit unserer Architektur. Es gab Anregungen und Vorbilder, wie die Bilder des Architekten und Malers Joseph Michael Gandy[1]im Soane Museum in London, eine Anregung von Kaschka. Das hat uns an das Bild «Città Analoga» von Arduino Cantafora erinnert, das uns seit unserer Studienzeit beschäftigt (Abb. 2). Cantafora hat in einer Art Panorama Bauten von Aldo Rossi in den Kontext historischer Bauten und Stadtvisionen eingebunden und zu einer Collage kombiniert. Genau das passiert auf unserem Fresko – es ist unsere «Città Analoga», die wir weiter behandeln.
TEC21: Woher stammt der Titel «And now the Ensemble!»?
MŠ: Nach der Entscheidung, ein Ensemble zu collagieren, kamen wir auf den Slogan. Auch hier war es Axel, der uns darauf gebracht hat. Ich hätte wohl «Ensemble City» vorgeschlagen, aber das hätte nicht diese Kraft gehabt. Wir haben die «Città Analoga» mit neuen Mitteln gestaltet. Die Linie ist klar, wir beziehen uns auf Aldo Rossi und seine Zeit. Aber es gibt auch Unterschiede, was auch damit zusammenhängt, dass wir eine andere Generation sind. Wir haben verstanden, dass die Stadt heterogen und dennoch einheitlich sein kann.
QM: Viele verstehen diese Collage als eine Arbeit mit Bildern. Ich möchte das Wort lieber im englischen Sinn als «Images» gebrauchen. Darin liegen zwei Bedeutungen: einerseits das Bild und andererseits das Image, ein Wort, das wir im Deutschen auch kennen und bei dem es um Inhalt geht. Über diese Inhalte haben wir diskutiert und aus ihnen ein Fresko entwickelt. Kaschka Knapkiewicz (KK): Wir haben uns gefragt, wann eine Stadt oder ein Ort überhaupt einheitlich ist und wie man eine Vielfalt in der Einheit schaffen kann. Die meisten Architekten realisieren einen Solitär nach dem anderen; die Bauten stehen nebeneinander, bilden aber kein Ensemble.
AF: Im Zentralen Pavillon (Padiglione Centrale, Giardini) stellt Peter Eisenman den Plan von Piranesi als Modell aus – eine «Città Analoga» des antiken Rom. Was bindet dieses Häusermeer zusammen? Sind es die Säulen, weil ein grosser Prozentsatz von Bauten Säulenportiken aufweist? Gibt es in unserer Zeit etwas, das eine ähnliche Trägerfunktion aufweist und unsere Gebäude zusammenhält? Es ist nicht nur der Raum, es ist nicht nur die Volumetrie, es ist nicht nur die Gebäudestellung, es ist nicht die Ähnlichkeit der Fenster – was ist das genau, was die Gebäude verbindet? Unsere Collage wirkt auf den Betrachter, weil es ein monumentales Fresko ist. Die interessante Frage ist, warum es als Ensemble wahrgenommen wird? Welches Bindemittel hält die abgebildeten Bauten zusammen? Das Kontextuelle gehört sicher dazu, aber viele Architekten machen kontextuelle Projekte. Was ist also dieses «Mehr»?
QM: Ich denke, es ist die dichte kulturelle Schichtung, die jeder von uns pflegt und die wir in unseren Bauten auch transportieren. Es sind profund gedachte Architekturen, die über das blosse Gefallen an einer Form, einem Volumen oder einer Aussage hinausgehen. Jeder von uns bringt aufgrund seines ganz persönlichen Hintergrunds eine bestimmte Geschichte in ein Projekt hinein, und die Vielschichtigkeit, die in den Bauten liegt, ermöglicht dies auch. Wir betten uns in eine gemeinsame Kultur, in ein kollektives Bewusstsein ein.
AF: Das machen doch alle Architekturschaffenden. Wir haben mit Studierenden deren Projekte versuchsweise zu einem Ensemble zusammengefügt, heraus kam aber nur ein Häuserhaufen. Ein anderes Beispiel: Im Arsenale sind zurzeit Fotos von Thomas Struth zu sehen. Einmal sind diverse Berliner Hinterhöfe dargestellt – banale Fassaden, die nur Fenster haben, nichts sonst. Daneben ist ein Bild von St. Petersburger Fassaden – wieder lauter Fenster, aber trotzdem ist der Strasseneindruck im öffentlichen Raum völlig anders. Es muss etwas geben, was diesen Eindruck ausmacht und den urbanen Raum prägt.
KK: Es ist die Zuwendung zum öffentlichen Raum. Es ist das Verständnis dafür, die Hauptfassade im traditionellen Sinn als repräsentatives Antlitz des Gebäudes zur Strasse hin aufzufassen. Im Hinterhof dagegen muss man nicht repräsentieren. Schaut euch Venedig an: Es gibt in der ganzen Stadt schmale, hohe Fenster im Piano nobile und sonst kleine Fenster, aber trotz den unterschiedlichen Grössen und Positionierungen tragen sie alle zum Schmuck der Strasse bei. Es ist, als hätte man sich auf einen Gestus zur Strasse hin geeinigt.
TEC21: Spannend ist ja gerade, dass Sie sich eben nicht auf Fenstergrössen oder sonstige Formen geeinigt haben. Auf dem Fresko zeigen Sie Werke, die jeweils für einen ganz bestimmten Kontext geschaffen, aus diesem Kontext herausgerissen und neu zusammengestellt worden sind. Alle diese «Entwurzelten» bilden ein neues Ensemble – da stellt sich schon die Frage, warum das funktioniert. Am direkten Bezug zum unmittelbaren Nachbarn auf dem Fresko kann es jedenfalls nicht liegen. Die Verbindung muss auf einer viel allgemeineren Ebene liegen.
QM: Es geht um eine Haltung, ein Verhalten – und darum, dass ein Gebäude ein «Gesicht» hat und etwas aussagt. Ich bin überzeugt, dass die vermittelte Bedeutung immer vielschichtig sein muss. Sonst wäre es unmöglich, aus unterschiedlichen kulturellen Umfeldern Zugang zum Gebäude zu finden.
MŠ: Nehmen wir ein Gegenbeispiel, den Novartis Campus in Basel. Der Masterplan von Vittorio Magnago Lampugnani gibt strenge städtebauliche Regeln und durchgehende Gestaltungselemente vor, und dennoch ist kein städtisches Ensemble entstanden.
AF: Weil die Bauten Solitäre sind: Sie basieren auf der Eitelkeit einzelner Architekturschaffender. Das ist das Paradoxe. Die verbindenden Strassenräume sind an sich gelungen, aber die Bauten streben das pure Gegenteil des Gemeinsamen an, sie konkurrenzieren und verschliessen sich, stellen das eine Thema gegen das andere. Angenommen, alle Bauten hätten Loggien oder raumhaltige Fassaden – ich denke jetzt beispielsweise an die Planung von Auguste Perret für Le Havre[2] – vielleicht hätten sie dann etwas, das Plastizität erzeugt. Es wäre anders.
TEC21: Liegt es in diesem Fall nicht auch an der Monofunktionalität der Büro- und Labornutzung und daran, dass der Campus kein öffentlicher Raum ist? Lampugnani hat ihn als Stadtraum gestaltet, aber de facto ist es eine «verbotene Stadt». Dort ist alles andere gewünscht als Öffentlichkeit, und das merkt man einigen Gebäuden auch an. Wozu sollen sie sich zu einer Strasse öffnen, die keine ist?
AF: Ich glaube, es liegt an der Art, wie sich die Gebäude dem öffentlichen Raum zuwenden oder eben nicht – der Grad der Plastizität, der Raumhaltigkeit. Darum bin ich auch gegen die Verdammung des Motivs: Das Motiv ist ein wichtiges Mittel, um diese Zuwendung auszudrücken.
QM: Ich verdamme das Motiv nicht. Ein anderer Gedanke: Liegt das Verbindende zwischen uns vielleicht darin, dass wir Architekturen schaffen, die Patina ansetzen können? Wir verwenden mineralische Materialien, die altern können. Dass ein Gebäude den Gebrauch, das Leben annehmen kann, ist wichtig.
MŠ: Das ist jetzt ein schönes Beispiel dafür, wie wir in der Gruppe diskutiert, gesucht und gerungen haben. Das Fresko ist ein empirisches Produkt. Das «masterpiece» dort ist tatsächlich dieses Ensemble, das Bindende. Wahrscheinlich hat jeder von uns noch eine eigene Gewichtung im Hinblick darauf, was ein Ensemble ist.
TEC21: Wie haben Sie es geschafft, sich auf diese Präsentation zu einigen? Haben Sie sich von Anfang an auf das Referenzbild «La Città Analoga» von Cantafora bezogen?
AF: Zunächst wollten wir eine gemeinsame Collage machen, sind aber damit gescheitert: Das geht einfach nicht, wenn man verschiedene Positionen vertritt. Darum ist das Fresko dreigeteilt: Jedes Büro hat eine Wand mit einer Collage seiner Bauten gestaltet. Wenn man die drei Bilder jetzt als Einheit liest, ist es das schönste Kompliment, das man uns machen kann! Offenbar sind die verschiedenen Visionen kompatibel.
MŠ: Es gab die Option, einen Comicstrip machen zu lassen. Wir hatten Kontakt mit Zürcher Zeichnern, u.a. mit Andreas Gefe. Er hätte das Unifizierende herstellen können, aber bei der Umsetzung seine eigene Handschrift auf die Collage übertragen. Dies hätte den Schwerpunkt auf ausserarchitektonische Massnahmen und Objekte wie Bäume verlagert, und die Architektur, die wir eigentlich abbilden wollten, wäre auf der Strecke geblieben. Wir wollten kein Kunstwerk schaffen, sondern das Ensemble in den Vordergrund stellen.
TEC21: Welche anderen Darstellungsformen haben Sie noch diskutiert?
MŠ: Es gab die Idee einer «russischen Hängung»[3], und auch die Technik der «Frottage» haben wir verfolgt. Schliesslich kamen wir auf das Verfahren mit der Fotoemulsion. Technisch war es ein Risiko, weil es bisher fast nur kleinformatige Versuche mit diesem Verfahren gegeben hat, maximal ein auf zwei Meter. Einige Künstler hatten in den 1970er-Jahren zwar grössere Formate ausprobiert, allerdings waren die Arbeiten damals häufig als Performance angelegt. Die Bilder wurden nicht fixiert, sondern sollten im Laufe der Ausstellung verblassen. Die technische Machbarkeit unserer Idee war daher nicht gesichert, wir haben mehr oder weniger alles auf eine Karte gesetzt.
TEC21: Wie wurde das Fresko dann tatsächlich ausgeführt?
MŠ: Zunächst mussten wir den Raum vollständig abdunkeln. Anschliessend wurde die Emulsion auf die Wand aufgetragen und mit Unterstützung von Klimaanlagen getrocknet. Danach konnten wir belichten. Parallel arbeiteten wir an den Vorlagen für die Projektion über Dia. Die Schärfe der Darstellung war teilweise nicht ausreichend, sie sollte bei ca. 600 dpi liegen. Als wir mit der Belichtung anfingen, kamen neue Schwierigkeiten hinzu. Zuvor hatte hier der Künstler Thomas Hirschhorn[4] ausgestellt. Er hatte den Pavillon völlig verkleidet und mit einem Kleber auf die Bodenplatten und an die Säulen und Wände mit Klebeband diverse Materialien und Objekte geklebt. Als wir die Fotoemulsion auftrugen, gab es punktuell unkontrollierte chemische Reaktionen, und die Bilder wurden unscharf. Also haben wir das ganze Spiel noch einmal wiederholt, die Wand zwischendurch gereinigt und neu verputzt. Inzwischen war es Mitte Juli, und hier in Venedig wurde es tagsüber 32 °C warm …
AF: Anstelle von drei Wochen haben die Arbeiten sechs Wochen gedauert. Am Ende hatte das Ganze die Dimension von Raffaels Werkstatt …
MŠ: Die Realisierung der Fotoemulsion verdanken wir dem deutschen Fotografen und Künstler Michael Zirn und seinem Team. Wir hatten angesichts der technischen Schwierigkeiten schon aufgegeben, als sich einer von Zirns Mitarbeitern an ein fotochemisches Rezept erinnerte: Man bringt Harnsäure auf, die anschliessend mit Salzsäure abgewaschen wird. Das haben wir gemacht. Die Arbeiter trugen Gasmasken – bei der Hitze wahrlich keine idealen Arbeitsbedingungen. Eine Woche vor der Eröffnung waren wir über den Berg. Zwischendurch haben wir alle ein bisschen die Nerven verloren und dachten: Hätten wir doch die Wände tapeziert ... Aber es wäre nicht dasselbe gewesen. Im deutschen Pavillon sind die Bilder auf die Wände geklebt; das sind aber Fotografien, die als solche wirken können und sollen. Bei unserer Collage ist es wichtig, dass der einzelne Pinselstrich vom Auftragen der Emulsion sichtbar bleibt. Dieser handwerkliche Aspekt und die Verfremdung durch das Belichtungsverfahren machen das Fresko zu dem, was es ist. Eine Verfremdung mit Photoshop haben wir übrigens auch getestet, aber als zu direkt verworfen.
QM: Die Kontrastveränderung, der Prozess hat den Bildern einen weiteren vereinheitlichenden Filter übergelegt. Was von der Sache her auch Sinn ergibt: Wir arbeiten alle mit dem Material und dem Detail. Es ist eine Arbeit, die für diesen Moment und für diese Wände gemacht ist, und das verleiht ihr ihren Charakter. Was ich noch ergänzen wollte: Wir sind sehr unterschiedlich, und das sieht man den Bildern auch an. Dass die Zusammenarbeit trotzdem so gut funktioniert hat, liegt daran, dass wir uns als Kollegen respektieren. Bei aller Unterschiedlichkeit sind wir passioniert für ähnliche Vorstellungen.
MŠ: Die anderen zwei Räume sind begleitend: der Lesetisch und unsere Referenzwand. Die fasziniert das Publikum am meisten, insbesondere die deutschen Kollegen, was mich doch überrascht, weil wir seit Jahren mit Referenzbildern arbeiten. Auch von meinen Studierenden verlange ich, dass sie mir ihre Referenzen immer wieder zeigen.
KK: Wir verständigen uns über unsere Referenzen. Wir sagen: «Weisst du, wie bei dem und dem Bau …» Wenn man das Bild hat, die Referenz, hat man die Richtung. Und bei den Deutschschweizer Architekten sind wir bei Weitem nicht die Einzigen, die so arbeiten.
MŠ: Das vierte Element unserer Ausstellung neben Fresko, Referenzen und Lesetisch – vielleicht die wichtigste Komponente – ist der Pavillon von Bruno Giacometti. Was er für eine Kraft hat, haben wir erst im Lauf der Zeit realisiert. Wir wollten, dass man die Räume wahrnehmen kann, den Bezug zwischen innen und aussen spürt.
Anmerkungen:
[01] Joseph Gandy (1771–1843) war englischer Architekt, Theoretiker und Maler, vor allem bekannt für seine imaginierenden Bilder der architektonischen Entwürfe von Sir John Soanes
[02] Auguste Perret war der hauptverantwortliche Stadtplaner für den Wiederaufbau von Le Havre nach dem Zweiten Weltkrieg
[03] Die «russische Hängung», auch «Petersburger Hängung», bezeichnet eine enge Reihung von Bildern. Sie wird benannt nach der Hängung der Gemälde in der Eremitage
[04] Thomas Hirschhorn, «Crystal of Resistance», Swiss Pavilion, Venice Biennale, Venice, Italy, 2011
And now the Ensemble! Ebenfalls unter dem Titel «And now the Ensemble!» ist eine Publikation erschienen mit Beiträgen u.a. von Adam Caruso, Vittorio Magnago Lampugnani, Quintus Miller und Miroslav Šik. Sie möchte dazu auffordern, Stadtplanung als dynamischen, kollektiven Prozess zu begreifen und zu gestalten: Miroslav Šik, Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, And now the Ensemble!, Zürich 2012TEC21, Fr., 2012.10.12
12. Oktober 2012 Judit Solt, Andrea Wiegelmann
Un-common Venice
«Quante Venezia conosce?» (Wie viele Venedig kennen Sie?) Die Frage wird einem am Kiosk gestellt, den Case Studio VOGT an der 13. Architekturbiennale in Venedig bespielt. Darauf gibt es nur eine Antwort: «Una e migliaia» (Eines und tausende). Der Titel des Beitrags des Landschaftsarchitekten Günther Vogt, «Un-common Venice», ist mehr als ein Wortspiel mit dem von David Chipperfield lancierten Motto der diesjährigen Ausgabe, «Common Ground». Er fängt mit den Studierenden des Lehrstuhls Landschaftsarchitektur der ETH Zürich und dem Case Studio VOGT das «Gemeine» ein und fördert das Ungewöhnliche zutage.
«Inside-Outside» heisst das Büro von Petra Blaisse, die die Ausstellung im niederländischen Pavillon gestaltet hat. Kongenial würde dieser Name indes auf den Beitrag passen, den der Landschaftsarchitekt Günther Vogt am Stuhl für Landschaftsarchitektur der ETH Zürich und dem Case Studio VOGT zusammen mit Studierenden der IUAV Venedig erarbeitet hat. Die Installation besteht aus zwei Teilen: einem introvertierten, der den Auftakt der Schau im Arsenale bildet, und einem extrovertierten, der eine neuralgische Stelle zwischen den beiden Austragungsorten der Biennale besetzt: die «Landzunge» an der Riva dei Sette Martiri – an welcher der Strom der Biennalebesucher sich mit demjenigen der Touristen vermengt, die aus den Kreuzfahrtschiffen geschwemmt werden, und sich in die Via Garibaldi ergiesst, das feste Terrain der Einheimischen.
«Leuchtturm» ist an beiden Orten ein Kiosk – draussen das zierliche, überkuppelte Oktogon mit dem verblassenden türkisfarbenen Anstrich, der an Patina erinnert (Abb. 1), drinnen, in den Corderie des Arsenale, dessen kupferblechverkleidete Nachbildung (Abb. 2). Original und Mock-up, Patina und Pasticcio, aussen und innen: der Lesarten sind viele, vor allem aber ist es die Verknüpfung beider, ihre Komplementarität. Und so funktionieren sie auch: Die Zeitung, Postkarten und ein Glas Wasser gibt es drinnen, beim Umwandeln des Mock-up. Der Ort der Kommunikation, des Austauschs ist das Original: Hier beantwortet man Fragen, «erwirbt» einen Pass, eine Postkarte, ein Eau de Toilette, ein paar Kiesel als Souvenir.
Den Kiosk als Kommunikations- und Präsentationsplattform zu wählen lag auf der Hand. Kaum ein anderes Objekt ist derart stark im öffentlichen Raum der Stadt verankert wie der Kiosk. Und Vogt nimmt Venedig selbst zum Ausgangspunkt: Das Verständnis des öffentlichen Raums als Allmende («commons») und die Fokussierung auf die Nutzenden – von lokalen Bewohnerinnen und Bewohnern bis zu globalisierten Tagestouristinnen – öffnet einen ungewöhnlichen Blick auf die Lagunenstadt.
Common Ground in der Gated Community
Günther Vogt hat einen differenzierten Blick auf den öffentlichen Raum – und strenge Kriterien an dessen Definition. Aus diesem Grund war es für ihn kein Thema, die Projekte Landesmuseum, Novartis Campus oder das olympische Dorf in London zu zeigen, an denen sein Büro beteiligt ist oder war. Das eine Gebiet – der Novartis Campus – entbehrt des öffentlichen Charakters gänzlich und hat mehr mit einer Gated Community gemein. Das andere – der Landesmuseumspark – hat ihn nur eingeschränkt, da er zwischen 22 und 6 Uhr geschlossen ist. Das dritte – die Unterkünfte der Athleten in London – war nicht nur abgeriegelt, sondern ausserdem ständig von Videokameras überwacht.
Aus der nämlichen Argumentation heraus beschränkte Vogt die Intervention nicht auf das Biennalegelände. Denn wie auch immer man das Thema «Common Ground» anpackt, der Widerspruch bleibt: Das Ausstellungsgelände ist während der Schau gerade nicht öffentlich, sondern nur mit Eintrittskarte zugänglich, was wiederum einer Separierung zwischen Fachpublikum, Touristen und Einheimischen gleichkommt. «Wir reden über öffentlichen Raum, aber wir tun das innerhalb einer Gated Community.» Unmittelbar daran schliesst sich die Frage nach der Ökonomisierung des öffentlichen Raums an, der zunehmend mit temporären Installationen für eine unüberschaubare Zahl von Events überstellt wird.
Nolli-Plan als Referenz
Die Bandbreite der Interpretation des Begriffs «öffentlicher Raum» ist sichtlich enorm – sie reicht bis zu dem Punkt, an dem er sich ins Gegenteil verkehrt. Um seine Studierenden aber für dessen genuine Qualität zu sensibilisieren, lässt Vogt sie jeweils den Nolli-Plan (1748) aufzeichnen und lenkt das Augenmerk auf die Kirchen, die seinerzeit zum öffentlichen Raum gehörten. «Die armen Leute übernachteten dort» – heute sind sie nachts geschlossen.
Wenn die Einzigartigkeit des Nolli-Plans darin besteht, dass die öffentlichen Gebäude nicht als geschlossene Flächen eingetragen sind, sondern als Grundrisse, dass positiv und negativ eine Verbindung eingehen, Innenraum auch Aussenraum ist – dann machen Vogt und seine Studierenden das Analoge: Der Kiosk an der Riva dei Sette Martiri auf «offener Strasse» ist begehbar, das Pendant im Innenraum des Arsenale ist Attrappe.
Damit huldigt Case Studio VOGT dem Genius Loci: Die Strassen und Plätze Venedigs sind in einem vorbildlichen Mass Common Ground. Das Leben selbst spielt sich auf ihnen ab, Nutzungsoffenheit ist hier alltäglich. Das liegt sogar in der Etymologie. In Venedig heissen die Plätze – mit Ausnahme des Markusplatzes, der den Titel «piazza» trägt – «campo», was auf den Begriff für urbar gemachtes Land zurückgeht und den Platz dem Charakter der Allmende verwandt macht. Er ist Treffpunkt der Jugendlichen, Spielplatz der Kinder; Grossmütter ruhen sich hier aus, Väter unterstreichen gestikulierend die Bedeutung ihrer Worte. Hier ist es ein gutes Zeichen, wenn es noch einen Tabaccaio gibt, weil dann auch die Apotheke nicht weit ist und ein Gemüsehändler noch ein Auskommen findet: «Ha tutto: bar, tabaccaio, una farmacia, un supermercato – come un piccolo paese.»
Und die Kirchen? Zufluchtsstätten für die Armen sind sie nicht mehr, aber manche von ihnen dienen Kindern als Aufbewahrungsort ihrer Spielsachen. Und das Motiv blieb. Vogt liebäugelte nämlich ursprünglich damit, eine Litfasssäule einzusetzen – in Anlehnung an den Spielfilm «Der dritte Mann», wo eine solche den Zugang zur Unterwelt bildet, in die Kanalisation, Refugium und Schlafplatz der Obdachlosen.
Ressource Wasser
Bei der Ankunft in Venedig habe ihn die unglaubliche Anzahl der Kioske überwältigt, sagt Vogt, weshalb die Wahl auf einen solchen als Ausstellungsstand fiel.[1] Das geeignete, noch dazu verwaiste Exemplar fand sich an besagtem Ort: am Dreh- und Angelpunkt von Arsenale und Giardini, an der Kreuzung zwischen den Touristenströmen, den Kreisen der Einheimischen und den Trampelpfaden des Fachpublikums.
Bespielt werden durfte er aber nur mit der Auflage, nichts zu verkaufen. Das erwies sich letztlich als Glücksfall insofern, als es an eine ursprüngliche Funktion des Kiosks anknüpft: Im Osmanischen Reich war der als «Sebil» bezeichnete Pavillon der Ort, wo Wasser ausgeschenkt wurde. Die Wohlhabenden hatten die Pflicht, den Armen sauberes Trinkwasser zu spenden. Vogts «Pavillon» thematisiert denn auch Wasser als Ressource, das er als
«Element ohne Eigenschaften» bezeichnet, «farblos, geruchlos, formlos und – endlos?».
Um den Bezug zum Wasser hervorzuheben, gab es in einer frühen Phase denn auch die Idee, den Kiosk auf einem Boot zu platzieren (Abb. 3), das über den Canal Grande gefahren wäre – eine Referenz an Aldo Rossis 1979 für die Theaterbiennale entworfenen Teatro del Mondo, der auf einer schwimmenden Plattform vor der Punta della Dogana ankerte.
Interviews, Mental maps und Fotos
Methodisch war der Ausgangspunkt der Installation in Venedig ein an Vogts Lehrstuhl entwickeltes Tool. Dessen wichtigste Instrumente sind Interviews und Schnappschüsse. Innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten haben die Studierenden der ETH, unterstützt von einheimischen Kommilitonen, Gespräche auf verschiedenen Plätzen der Stadt geführt. Auserkoren wurden der Campo del Ghetto Nuovo, der Campo Santa Margherita und die Piazza San Marco. Der Platz im ehemaligen jüdischen Getto ist der vielleicht abgeschiedenste Campo unter den grösseren Plätzen der Stadt. Auch an Tageszeiten, an denen er belebt ist, wirkt er ruhig, in sich gekehrt. Der Campo Santa Margherita war bis vor wenigen Jahren noch ein Geheimtipp für Touristen, die sich nicht als solche fühlen wollten. Und der Charakter der Piazza San Marco ist wohl am treffendsten eingefangen in der Antwort, die der älteste Kioskbesitzer der Stadt, Francesco, zu Protokoll gab: Der wichtigste Ort für Venedig sei die Piazza San Marco. Der wichtigste Ort für ihn persönlich hingegen ist: «Tutto ciò che non è Piazza San Marco.»
Die Interviewten zeichneten eine Mental Map auf, aus der hervorgeht, wie sie den Raum erinnern, wie sie sich in ihm bewegen, wie sie sich orientieren. Mit einer Kamera haben sie diejenigen Sujets fotografiert, die für sie an den jeweiligen Orten von Bedeutung sind.
Und schliesslich wurden sie mit der Frage konfrontiert, ob man für Venedig Eintritt verlangen und das Wasser kostenpflichtig machen sollte.
Kompass für den Common Ground
Die Resultate der Interviews, welche die Studierenden zusammengetragen haben, wurden in «die Sprache des Kiosks übersetzt» – zuallererst in eine Zeitung. In ihr sind die Gespräche, Fotos und Mental Maps dokumentiert. Eingebettet wurden sie in eine Reihe von Hintergrundartikeln – zur Geschichte des Kiosks, zur Beziehung zwischen dem Untergrund der Stadt Venedig und ihrer Kunst,[2] zum Schutzwehrprojekt «Mose». Dazu kommen verschiedene Gadgets, die als ungewöhnliche Souvenirs fungieren: Da gibt es den Pass, der einen als «Bewohner des grössten Staates der Welt», des Common Ground, ausweist. Im Gegenzug für die Beantwortung einer Frage kann man sich auch eine Postkarte aussuchen, zum Beispiel die, auf der sich die Vedute, der Stadtplan Venedigs, erst offenbart, wenn man sie mit dem Bodensatz der Stadt imprägniert, sprich: auf eine Steinplatte legt und abreibt. Mit dem Führer «Venedig in 89 Tagen» kann man anhand der Mental Maps der Interviewten die Stadt erkunden. Den dafür notwendigen Kompass gibt es ebenfalls am Kiosk.[3] Das Wort für die Orientierungshilfe geht auf das italienische «compasso» zurück, was mit «Zirkelweg» übersetzt werden kann – mithin wohl das treffendste Bild für die kollektive Mental Map Venedigs.
Anmerkungen:
[01] Wie das Pendant dazu erscheint der Beitrag «Venice take away», der im britischen Pavillon Gastrecht geniesst. Dort werden die Resultate einer globalen Recherche von zehn Architekturteams präsentiert, die ausströmten, um den Common Ground der Architekturpraxis in Brasilien, China, Deutschland, Japan, den Niederlanden, Nigeria, Thailand und den USA zu erforschen und die Antworten in Venedig zusammenzutragen
[02] Pieper, Jan, Venezia – un tentativo di rendere abitabile l’acqua tramite l’arte, in: Republic of Common Ground, Sept. – Nov. 2012, S. 12 – 13; www.republic-of-common-ground.com; Nachdruck von: Pieper, Jan, Venedig. Ein Versuch, das Wasser durch Kunst bewohnbar zu machen, in: Anthos, Jg. 31 1992, Nr. 1, S. 26 – 31
[03] Das «Inventar der Republik Common Ground» kann man auch im Internet bestellen unter: www.republic-of-common-ground.comTEC21, Fr., 2012.10.12
12. Oktober 2012 Rahel Hartmann Schweizer