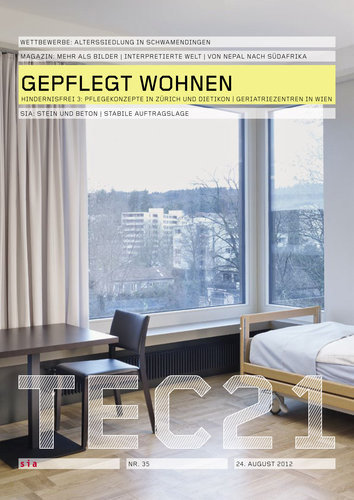Editorial
Dass sich der Alterungsprozess ebenso wie die nachberufliche, nachfamiliale Phase individuell gestaltet, es also «die» Alten nicht gibt, thematisierten wir an dieser Stelle bereits (vgl. TEC21 13/2012). Doch welche Strategien gibt es, um mit diesen unterschiedlichen Ansprüchen, Bedürfnissen und auch Möglichkeiten umzugehen?
Im letzten Heft der Reihe «Hindernisfrei»[1] stellten wir Modelle für das selbstständige Wohnen im Alter vor. Diese Ausgabe von TEC21 widmet sich dem Umgang mit einer Aufgabe, die durch den Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft aus den Familien ausgegliedert und der Gemeinschaft (dem Bund, den Städten und Gemeinden) übertragen wurde: der Betreuung und Pflege von Menschen im sogenannten vierten Lebensalter über 80, die durch zunehmende Gebrechlichkeit oder gesundheitliche Beeinträchtigungen ihren Alltag nicht mehr selbstständig bewältigen können. Wie gross ist der Bedarf an entsprechenden Einrichtungen, und was müssen diese leisten?
Der Umzug in ein Heim bedeutet noch immer eine Ausgrenzung aus dem bestehenden Lebensrahmen – für die alten Menschen, aber auch für ihr Umfeld. In einer Gesellschaft, in der Alter und Krankheit mit einem Stigma behaftet sind, ist es wichtig, zu erkennen, dass Pflegeheime nicht nur Fixpunkte für die dort lebenden und arbeitenden Menschen sind, sondern dass sie auch zur sozialen Qualität einer Stadt beitragen. Um dem zunehmenden Bedarf an Alters- und Pflegewohnplätzen zu begegnen und die alten Menschen nicht aus der Gesellschaft auszugliedern, entwickeln viele Städte Altersstrategien. In diesem Heft stellen wir drei davon vor: Die Stadt Wien hat mit ihrem Geriatriekonzept, das die Rückverlagerung der Pflegeheime vom Stadtrand in die Quartiere vorsieht («Neue Geriatriezentren in Wien»), eine langfristige Altersstrategie, ebenso wie die Stadt Zürich. Obwohl sich die Konzepte in einigen Punkten decken, sind sie sehr gezielt auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Städte zugeschnitten. Ergänzend dazu zeigen wir das Pflegezentrum Ruggacker in Dietikon ZH und mit ihm die Vorgehensweise einer Stadt, die im Gegensatz zum schnell wachsenden Zürich mit einem hohen Anteil an alten Menschen und einer schwachen Einkommensstruktur zu kämpfen hat («Pflegekonzepte in Zürich und Dietikon»).
Trotz den Bemühungen der beteiligten Akteure – Betreiber wie Architekten –, die Pflegeheime räumlich und funktional in den Quartieren zu verankern, harzt es mit der Umsetzung im täglichen Leben. Damit eine echte (nicht nur finanzielle) Solidarität zwischen den Generationen keine Utopie bleibt, gilt es, Berührungsängste abzubauen.
Tina Cieslik, Andrea Wiegelmann
Anmerkung:
[01] «Special needs», TEC21 38/2011; «Gemeinschaft im Alter», TEC21 13/2012
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Alterssiedlung in Schwamendingen
13 PERSÖNLICH
Leserbriefe | Wechsel im Team von TEC21
14 MAGAZIN
Mehr als schöne Bilder | Interpretierte Welt | Von Nepal nach Südafrika
26 PFLEGEKONZEPTE IN ZÜRICH UND DIETIKON
Tina Cieslik, Andrea Wiegelmann
Unsere Gesellschaft wird immer älter. Um ein adäquates Angebot für das Leben im Alter zur Verfügung zu stellen, müssen sich Gemeinden, Städte und Kantone mit verschiedenen Lebensentwürfen, aber auch mit den eigenen Möglichkeiten auseinandersetzen.
33 NEUE GERIATRIEZENTREN IN WIEN
Franziska Leeb
In der österreichischen Hauptstadt entsteht seit 2010 eine Reihe neuer Geriatriezentren. Im Rahmen des Geriatriekonzepts ziehen die Heime vom Stadtrand in die Quartiere.
41 SIA
Stein und Beton | Kurzmitteilungen | Stabile Auftragslage
48 PRODUKTE
Fenster: s: stebler | swisswindows | Berger swissFineLine | EgoKiefer | Ernst Schweizer
Böden: Lenzlinger | Forbo | Bauwerk
52 MESSEN
Bauen & Modernisieren | MADE Expo
Pflegekonzepte in Zürich und Dietikon
Der Anteil der über 80-Jährigen in unserer Gesellschaft steigt und mit ihm die Zahl der Personen, die in unterschiedlichen Formen Unterstützung und Pflege zur Bewältigung ihres Alltags benötigen. Die beiden Städte Zürich und Dietikon haben in den letzten Jahren ihr Angebot an Pflegeeinrichtungen analysiert und bestehende Pflegeheime instand gesetzt bzw. Neubauten errichtet. Auch wenn sich die Rahmenbedingungen unterscheiden – bei Besuchen des Pflegezentrums Bombach in Zürich Höngg und des Pflegeheims Ruggacker in Dietikon fällt auf, dass die Steigerung der Aufenthaltsqualität für Bewohner und Personal bei der Gestaltung der Häuser eine zentrale Rolle spielt.
Weitläufige Eingangsbereiche, Blickbezüge in den Gebäuden und in die Umgebung, eine sorgfältige Detaillierung und Materialwahl zitieren in Zürich Höngg wie in Dietikon eher grosszügige Wohnanlagen denn Pflegeeinrichtungen. Es ist offensichtlich, dass sich der Anspruch an diese Häuser in den letzten Jahren gewandelt hat. Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner werden aktiv gefördert, die Selbstständigkeit jedes Einzelnen durch Therapien unterstützt. Die sogenannte Aktivierung, die Unterstützung und Förderung von Beweglichkeit und Aktivität, spielt eine zentrale Rolle. Auch das Leben auf den Abteilungen, mit Zimmernachbarn und Pflegern ist gestärkt. Statt Mehrbettzimmern bestimmen heute Ein- und Zweibettzimmer die Wohnetagen. Eigene Demenzabteilungen ergänzen das Programm. Beim Pflegezentrum Bombach in Zürich und beim Pflegeheim Ruggacker in Dietikon, beides Instandsetzungen, mussten bestehende Strukturen, entstanden aus Pflegekonzepten der 1960er-Jahre, an diesen Anforderungskatalog angepasst werden.
Während die Stadt Zürich für den Neubau wie die Instandsetzung ihrer Pflegeeinrichtungen einen Richtlinienkatalog[1], basierend aus den Erfahrungen mit den bestehenden Anlagen, erarbeitet hat, entwickelte Dietikon mithilfe externer Berater die erforderlichen Vorgaben für die Planung. Beide Städte reagieren damit auf die vorhandene Nachfrage, wenn auch die Voraussetzungen andere sind: Zürich möchte das Angebot an Pflegeeinrichtungen auf dem aktuellen Stand halten – der Anteil an über 80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung wird nicht weiter steigen (vgl. Kasten S. 27) –, für Dietikon ist der Ausbau des Angebots auch Standortmarketing, da die Stadt in den nächsten Jahren von einer Zunahme der über 80-Jährigen ausgeht.
Grandezza in Bombach
Das Pflegezentrum Bombach, 1965 nach den Plänen der Architekten Josef Schütz und Hans von Meyenburg erbaut, liegt am Westrand von Zürich Höngg auf einer Geländeterrasse mit Aussicht über die Stadt. Über dem dreigeschossigen Sockel, auf zwei Untergeschosse folgt das freie Erdgeschoss, erhebt sich das siebenstöckige Bettenhaus, das mit einem zurückgesetzten Dachgeschoss abschliesst.
Den Besucher empfängt das instand gesetzte und im April 2012 wiedereröffnete Pflegezentrum mit einem grosszügigen offenen Erdgeschoss, das die parkartige Umgebung in das Gebäude hineinzieht. Das Nussbaumholz der Möbeleinbauten und die grossen Leuchten bestimmen den Raum. Die Offenheit, der Blick durch die geschosshohe Verglasung, die Kombination von warmen Holztönen und Steinböden entsprechen nicht im mindesten den Bildern, die beim Stichwort «Pflegeheim» im Kopf entstehen. Das verantwortliche Zürcher Büro Niedermann Sigg Schwendener nutzte die Möglichkeiten der Tragstruktur und schuf grosszügige, helle Räume.
Im Zuge der Instandsetzung wurde das Gebäude weitestgehend entkernt. Für die Anpassung der Grundrisse waren die Vorgaben des «Masterplans Bauten»[2] der Pflegezentren der Stadt Zürich ausschlaggebend. Darin enthalten sind Empfehlungen wie etwa die Zuordnung der Nasszellen zu den Zimmern oder die Anordnung von Aufenthaltsbereichen in jeder Abteilung. In Bombach sind eine Pflegeabteilung für Personen mit Sehbehinderung – erstmalig bei den Stadtzürcher Pflegezentren –, zwei Demenzabteilungen sowie eine Abteilung für geistig aktive (kognitiv intakte) Menschen integriert. Damit bietet das Pflegezentrum seinen Bewohnerinnen und Bewohnern eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Pflege und zudem ein umfassendes Therapieprogramm. Ein Tageszentrum, das «Stöckli», nimmt demenzkranke Bewohnerinnen und Bewohner tageweise auf. Voraussichtlich 2016 wird ein separates Haus für Demenzpatienten die Anlage ergänzen.
Für diesen Anforderungskatalog mussten die Nutzungen im Erd- und Untergeschoss neu organisiert werden. Die Eingangshalle ist als Zentrum der Anlage gestärkt und beherbergt nun neben dem Empfangs- und Aufenthaltsbereich auch die Cafeteria. Die Untergeschosse nehmen den erweiterten Therapiebereich auf, ebenso die Küche, den Personal- und den Andachtsbereich. In den sieben Obergeschossen sind durch die Neuorganisation der Grundrisse Aufenthalts- und Essbereiche entstanden. Durch integrierte Wohnküchen kann den Bewohnern nun ein Frühstücksbuffet angeboten werden. Die Möglichkeit, mit den Nachbarn auf der Etage zu frühstücken, wird, so der Leiter des Pflegezentrums, Erwin Zehnder, sehr gut angenommen. Das gemeinsame Essen auf den Geschossen bekommt einen beinahe familiären Charakter, unterstützt durch die Tatsache, dass das Pflegepersonal in der Regel immer auf denselben Abteilungen arbeitet:
Auch bei der Gestaltung der Zimmer stand der Anspruch im Vordergrund, eine persönliche, wohnliche Atmosphäre zu schaffen. Die ehemaligen Mehrbettzimmer sind in Ein- und Zweibettzimmer mit direkt zugeordneten Nassräumen umgewandelt. Die Ausstattung ist zurückhaltend genug, um den persönlichen Möbeln und Einrichtungsobjekten der Bewohnerinnen und Bewohner Raum zu geben. Sie haben deutlich mehr Privatsphäre als zuvor. Grosszügige Panoramafenster bieten auch aus dem Bett Aussicht ins Tal. Schmale Lüftungsflügel versorgen die Zimmer mit Frischluft und helfen, in Kombination mit der Komfortlüftung, den typischen Krankenhausgeruch zu vermeiden. Auf den Fluren zitieren die Kunststeineinfassungen der Zimmertüren die Eingangssituation in ein Privathaus und schaffen eine intime Atmosphäre, vergleichbar mit einer engen Altstadtgasse. Dieses Bild unterstützen die im Vorbereich der Treppen und Aufzüge installierten Bänke ebenso wie die Ausbaumaterialien (Eichenholz und heller Kunststein). Die notwendige Funktionalität der Wohnbereiche, die dennoch alle Ansprüche an eine moderne Pflegestation erfüllen, drängt sich durch die Gestaltung und die Wahl der Materialien nicht auf.
Differenziertes Angebot in Dietikon
In Dietikon ähneln die Anforderungen an die Instandsetzung des Pflegeheims Ruggacker der Aufgabenstellung in Zürich. Die Verabschiedung des Altersleitbilds der Stadt Dietikon von 1996 (vgl. Kasten S. 27) erforderte einen Ausbau der Wohnmöglichkeiten für betagte Einwohnerinnen und Einwohner. Ziel der Stadt ist es, jedem Bewohner entsprechend seiner Möglichkeiten Unterstützung für diese Lebensphase zu bieten. Im Zug der notwendig gewordenen Instandsetzung des Pflegeheims – von Markus Dieterle 1966 errichtet – wurde in einem angegliederten Ersatzneubau daher auch ein selbstständiges Wohnangebot für Senioren geschaffen mit der Möglichkeit, ergänzende Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Verantwortliche Architekten sind, wie in Bombach, Niedermann Sigg Schwendener. Die Umsetzung in Dietikon war dabei komplexer als in Bombach: Für die Bewohner des Altbaus (Ruggacker 1) stand während der Zeit der Umbaumassnahme keine alternative Unterkunft zur Verfügung.[3] Daher wurde zunächst der Neubau errichtet, der zukünftig die Seniorenresidenz aufnehmen wird (Ruggacker 2) und die Bewohner aus dem Pflegeheim dorthin umgesiedelt. Gleichzeitig konnten so im Untergeschoss des Neubaus Lagerflächen, Garderobenräume und weitere Betriebsräume geschaffen werden, um den Alltagsbetrieb des Pflege- heims auch während der Bauphasen zu sichern. Auch die Errichtung des Zwischenbaus, der Speise- und Mehrzwecksaal aufnimmt, wurde in der ersten Etappe ausgeführt.
In einem zweiten Schritt wird momentan das Bestandsgebäude instand gesetzt. Der Neubau ist seit 2011 bezogen, der instand gesetzte Altbau wird Ende August 2012 fertiggestellt sein. Dann ziehen die Bewohnerinnen des Pflegeheims zurück, und der Neubau kann, nach einer erneuten Umbauphase, für das Alterswohnen genutzt werden.
Aufgrund der unterschiedlichen Nutzung verfolgten die Architekten von Beginn an das Konzept, zwei getrennte Gebäude zu realisieren, die über gemeinsam genutzte Bereiche verbunden sind: den Speisesaal, angeschlossen an die Empfangsbereiche, und die Verwaltungsräume beider Häuser in den Erd- und Untergeschossen.
Hohe Qualität im Rahmen des Möglichen
Die neu errichtete Altersresidenz besteht aus dem Gartengeschoss, drei dazwischenliegenden Vollgeschossen und dem zurückspringenden Dachgeschoss. Alle Wohnungen (vgl. Kas- ten S. 32) verfügen über Balkone oder Terrassen, die hinter den durchlaufenden, die Geschosse markierenden Brüstungen liegen. Die gestaffelte Grundrissstruktur fächert die Zimmer gegen Süden zum üppig begrünten Park auf. Die versetzte Anordnung rhythmisiert auch die Korridore, sich weitende und verengende Sequenzen erzeugen intimere und öffentlichere Räume (Abb. 11,12). Vor den Zimmern bilden sie private Zugangsbereiche. Jeweils am Anfang und Ende des Korridors liegen die Gemeinschaftsräume. Sie ermöglichen mittels innenliegender Verglasungen eine natürliche Belichtung der Erschliessungszone.
Der Bestandsbau liegt an der belebten Bremgartnerstrasse, zu der sich auch der Haupteingang orientiert. Die Instandsetzung sollte die Umwandlung der ursprünglichen Pflegezimmer zu grosszügigeren und kleineren Einheiten (Ein- und Zweibettzimmer) ermöglichen. Doch die strenge Schottenstruktur des Tragwerks stand einer umfassenden Neuorganisation der Grundrisse entgegen. Sie wurde weitestgehend übernommen, ebenso die Lage der Steigzonen. Die Pflegebereiche sind in den drei identischen Obergeschossen des bestehenden Gebäudes neu organisiert und werden durch ein zusätzliches Attikageschoss, das die Demenzabteilung aufnimmt, ergänzt. Die innere Organisation mit mittig angeordneten Korridoren ist beibehalten und jede Wohneinheit neu mit eigener Nasszelle ausgestattet. Die ehemaligen Balkone wurden den Zimmern zugeschlagen, um ausreichende Raumgrössen zu erhalten. Eine Vorgabe der Bauherrschaft, basierend auf einer – im Rahmen der Altersstrategie erstellten – Machbarkeitsstudie für die Instandsetzung. Um dennoch grösstmöglichen Aussenbezug zu gewährleisten, nutzten die Architekten Eichenholzfenster mit Öffnungsflügeln, die mit ihren niedrigen Brüstungszonen Blumenfenster zitieren und die Zimmer grosszügiger wirken lassen. Zudem ermöglichen sie, ergänzend zur integrierten kontrollierten Lüftung, eine individuelle Belüftung der Räume. Im Erdgeschoss des Pflegeheims nimmt der Gebäudeversprung den Zugang mit Empfang und anschliessender Cafeteria auf. Die grösszügige Öffnung des Geschosses zu Cafeteria und Aussenbereich wurde möglich, da mit der Instandsetzung die Waschküche ausgelagert und die frei gewordenen Flächen mit Infrastruktur und Küche belegt werden konnten. Wie beim Pflegezentrum Bombach versuchten die Architekten auch in Dietikon durch eine gute Versorgung mit Tageslicht in allen Bereichen sowie durch eine sorgfältige Material- und Farbwahl die Privatsphäre der Bewohnerinnen und Bewohner zu stärken und die Atmosphäre in den Geschossen wohnlich zu gestalten. Angesichts der Zwänge, die durch die vorgegebene Tragstruktur bestanden, ist das Ergebnis umso überzeugender.
Zwänge und Chancen
Die Städte Zürich und Dietikon agieren innerhalb völlig unterschiedlicher Rahmenbedingungen. Während Zürich mit seinen zehn Pflegezentren aus der Erfahrung der eigenen Heime lernen konnte, zog Dietikon eine externe Beratung hinzu. Trotz allen Unterschieden in Ausgangslage und Umsetzung gibt es auch Gemeinsamkeiten: Beide Städte setzen beim Wohn- und Pflegeangebot für das Alter auf eine umfangreiche Palette an Möglichkeiten, die den vielseitigen Lebensentwürfen unserer Gesellschaft Rechnung trägt. Der Umgang mit ihren Pflegeheimen zeigt exemplarisch, wie sich der Schwerpunkt vom «Pflegen» zum «Heim», sprich zum «Daheimsein», zum Wohnen verschiebt. Die gezeigten Beispiele lösen diesen Anspruch dank einer sorgfältigen und sinnlichen Gestaltung ein.
Anmerkungen:
[01] Masterplan Bauten der Städtischen Pflegezentren, Zürich; Informationen unter: www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheit/pflegezentren.html
[02] ebd.
[03] Während der Instandsetzung des Pflegezentrums Bombach konnten die Bewohner in das ehemalige Personalhaus des Stadtspitals Triemli umziehen, in dem für Umbauten dieser Art ein temporäres Pflegeheim eingerichtet wurdeTEC21, Fr., 2012.08.24
24. August 2012 Tina Cieslik, Andrea Wiegelmann
Neue Geriatriezentren in Wien
Seit 2010 baut die Stadt Wien eine Reihe neuer Geriatriezentren.1 Sie sollen die medikalisierte Pflege in einem Umfeld erlauben, in dem die Patienten so wenig Spitalambiente wie möglich vorfinden. Man orientierte sich an Komfortkriterien des Wohnbaus, und wohl deshalb kamen Architekturbüros zum Zug, die sich im Geschosswohnungsbau profiliert haben. Die Gleichzeitigkeit der Entstehung und der Pilotcharakter des Bauprogrammes, für das es auch international kaum Referenzprojekte gab, sorgte für einen regen Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Projektteams. Die drei bereits fertiggestellten Häuser Leopoldstadt, Simmering und Liesing zeigen, wie unterschiedlich die Architekten das enge Korsett an Vorgaben interpretierten.
Das als Stadt im Grünen konzipierte «Versorgungsheim Lainz» am westlichen Stadtrand von Wien galt bei seiner Erbauung zu Beginn des 20. Jahrhunderts als internationales Vorzeigeprojekt (Abb. 1). Im Vergleich zu allen vorher bestehenden Einrichtungen zur Betreuung alter und armer Menschen boten die ansehnlichen Bauten mit gut belüfteten und belichteten Schlafräumen, Etagenbädern, Balkonen und Tagräumen einen bis dahin unüblichen Komfort. Andererseits wurde der abgelegene Standort wohl nicht nur wegen der guten Luft gewählt, sondern auch, um die Klientel aus dem Stadtzentrum fernzuhalten. Der inhaltliche Wandel der institutionellen Altenpflege lässt sich auch an der Namensgebung ablesen: In den 1960er-Jahren wurde das Versorgungsheim zum «Pflegeheim» und in den 1990er-Jahren zum «Geriatriezentrum am Wienerwald» umgebaut.
2015 wird das Wiener Flaggschiff der Altenpflege geschlossen und neu als Wohnquartier genutzt.2 Die rund 1200 Pflegeplätze werden dann in insgesamt neun neuen Häusern – teils an schon bestehenden Standorten – untergebracht sein, die nicht mehr im Westen der Stadt konzentriert sind, sondern dezentral über das Stadtgebiet verteilt werden. So wird den zukünftigen Patienten der Verbleib in der vertrauten Wohnumgebung ermöglicht. Die Klientel besteht aus betagten Menschen, die einen Pflegebedarf von mehr als 160 Stunden pro Monat haben und für die eine Pflege zu Hause oder in einem Seniorenwohnheim aufgrund der medizinischen Indikationen nicht zu bewerkstelligen ist. Die Wiener Pflegeplätze – sowohl jene in den kommunalen wie auch jene in Institutionen von privaten Trägern – werden über eine Clearingstelle nach pflegerischer und medizinischer Notwendigkeit vergeben und entweder aus dem Vermögen der Betroffenen oder über die Sozialhilfe finanziert.
Wohnlichkeit trotz Krankenhausinfrastruktur
Die Grössenordnung der neu errichteten Geriatriezentren, die nur an bestehenden Standorten weiterhin so heissen, an neuen Standorten aber «Pflegewohnhäuser» genannt werden, bewegt sich um je 300 Betten. Das Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz vom März 2005 gibt mit 350 Betten die Grenze nach oben vor, mit 240 Betten wurde eine wirtschaftlich sinnvolle Untergrenze definiert. Im Schnitt bleiben die Menschen zwei bis drei Jahre in den Einrichtungen, manche auch Jahrzehnte, jedenfalls so gut wie alle bis an das Ende ihres Lebens.
Um ihnen eine wohnliche Atmosphäre zu bieten und die Maschinerie des Krankenhauses in den Hintergrund zu drängen, gibt es Vorgaben: In den Pflegewohnbereichen, wie die Stationen nun genannt werden, soll der Aspekt des Wohnens im Vordergrund stehen. Die Zimmer sind überwiegend Einzelzimmer, etwa zu einem Viertel werden Doppelzimmer angeboten. Eine private Loggia für jedes Zimmer ist Pflicht und muss so ausgebildet sein, dass die Schwellen zwischen Zimmer und Freiraum auch mit Pflegebetten leicht überwunden werden können. Neben den Anforderungen an die Wohnlichkeit gelten für alle Häuser einheitliche strukturelle Vorgaben: So sind pro Geschoss mindestens zwei Pflegewohnbereiche unterzubringen, damit Therapieräume von mehreren Stationen nutzbar sind. Die Konstruktion soll eine hohe Flexibilität zum einfachen Umbau auch in der Betriebsphase gewährleisten. So sind zwischen allen Zimmern «Sollbruchstellen» vorzusehen, um den späteren Einbau von Verbindungstüren zu ermöglichen. Die maximal 28 Plätze pro Wohnbereich werden in zwei bis drei Wohngruppen gegliedert, denen gemeinsame Wohnzimmer zugeordnet sind.
Pro Haus sind überdies zwei Demenzstationen (mit insgesamt max. 56 Plätzen) für schwer Demenzkranke vorgesehen. Zudem sind Überschaubarkeit und kommunikations- und kontaktfördernde Strukturen sowie Inszenierungen gefordert (in Form künstlerischer Interventionen oder Aquarien), die zum passiven Beobachten animieren. Da etwa 80 % der Bewohnerinnen und Bewohner als Zusatzdiagnose Demenz aufweisen, muss auf den Bewegungsdrang dementer Menschen Rücksicht genommen werden. Wegführungen sollen als «Demenzschleifen» ausgebildet werden – also als Rundgänge ohne Sackgassen, damit die alten Leute ihre Runden drehen können.
Ein einheitliches visuelles Leitsystem für alle Häuser, für das die Grafikerin Gabriele Lenz und die Architektin Anja Mönkemöller (beide aus Wien) verantwortlich zeichnen, hilft zudem bei der Orientierung. Es variiert in einzelnen Aspekten wie in der pro Haus unterschiedlichen Farbigkeit oder in den Symbolfamilien zur Kennzeichnung der verschiedenen Stationen. Die Gartengestaltung soll abwechslungsreiche Spazierwege und Rückzugsorte anbieten, mit Duftkräutern, Blumen und Gräsern die Sinne stimulieren und ergotherapeutische Arbeitsplätze sowie Strecken für Gehtrainings zur Verfügung stellen. Sie ist verpflichtend an Landschaftsarchitekten zu vergeben. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser sollen – auch wenn sie nicht mehr mobil genug sind, um die Anlage zu verlassen – so viel wie möglich vom Leben rundherum mitbekommen. Daher sollen die Häuser gut in den Stadtquartieren verankert werden und keine Monostrukturen sein. Sie beherbergen weitere Nutzungen wie geriatrische Tageszentren, betreutes Wohnen, Mietwohnungen, Mehrzwecksäle auch für externe Veranstaltungen und allgemein zugängliche Cafeterias.
Pflegewohnhaus Leopoldstadt: Eine Stadt in einem Haus
Das Wohn- und Pflegehaus Leopoldstadt des Wiener Architekten Helmut Wimmer entstand auf dem Areal einer ehemaligen Buseinstellhalle im Stadtentwicklungsgebiet am ehemaligen Nordbahnhof. Die mächtige U-Form folgt den Vorgaben des Masterplans für das Quartier. Neben zwei Demenzstationen im ersten Obergeschoss und zehn Pflegestationen in den fünf Geschossen darüber beherbergt sie im zurückspringenden obersten Geschoss ein Heim für betreutes Wohnen sowie 22 geförderte Mietwohnungen in den Kopfbauteilen. Die Eingangshalle ist als zur Umgebung offene, multifunktionale Zone ausgebildet. Eine schleifenförmige Erweiterung in den Park birgt das Mitarbeiterrestaurant mit fernöstlich anmutendem Innenhof und einem Garten auf dem Dach, der es den Bewohnerinnen und Bewohnern der Demenzbereiche im ersten Stock erlaubt, ohne Begleitperson sicher ins Freie zu kommen.
Der Architekt überführte etliche seiner konzeptuellen Ansätze aus dem Wohnbau in das Pflegewohnhaus – zum Beispiel die Betrachtung der einzelnen Geschossebenen als übereinandergestapelten Baulands, auf dem innerhalb eines schlichten konstruktiven Systems aus Platten und Stützen Zwischenwände und Einbauten weitgehend frei disponiert werden können. Indem Zimmer und Funktionseinheiten zu kleinen «Häusern im Haus» (Abb. 6) zusammengefasst sind, schuf der Architekt eine vertikale Stadtlandschaft, innerhalb der den Bewohnerinnen und Bewohnern ein überschaubares, identifikationsstiftendes Umfeld geboten wird. Nach einem Farbkonzept des Wiener Künstlers Oskar Putz, der auch für die farbige Gestaltung in der Erdgeschosszone verantwortlich zeichnet, sind die einzelnen Hausgruppen unterschiedlich gefärbt und zeichnen sich so auch in der Fassade nach aussen ab. Dazwischen bildete Wimmer Gassen, Plätze und Sichtachsen.
Die Zimmer sind über die gesamte Breite mit Faltschiebetüren zum Loggienband hin zu öffnen, wodurch der Freiraum als Teil des Zimmers erfahren werden kann und der Wahrnehmungsradius der Bewohner über das Zimmer hinausgeht (Abb. 4). Kleine Fenster zu den Gängen hin gestatten die Teilnahme am Stationsleben, umgekehrt aber auch den Einblick von aussen, sofern die Jalousien nicht geschlossen sind. In jedem Fall tragen sie dazu bei, Isolation zu vermeiden. Die Materialisierung des Inneren ist stark von den für Krankenhäuser geltenden Hygienevorschriften und den für die Betreuung stark Pflegebedürftiger notwendigen Einrichtungen geprägt. Mit der hellen Grundfarbigkeit und den pastellfarbigen Fassaden der internen Häuser, den Markisen und dem Holzbelag auf den Loggien strahlt das Haus insgesamt dennoch das heitere Flair eines Erholungsheimes aus.
Pflegewohnhaus Simmering: Unkonventionelle Grundrisse
Ebenfalls in einem städtebaulichen Entwicklungsgebiet auf dem Areal einer ehemaligen Senf- und Essigfabrik liegt das Pflegewohnhaus Simmering des Wiener Architekten Josef Weichenberger. Die Umsetzung unterscheidet sich in Bezug auf Grundriss und Materialisierung dennoch stark von derjenigen in Leopoldstadt. Der Bauplatz grenzt an einen bewaldeten Park, der nach einem Konzept der Wiener Landschaftsarchitekten Auböck & Kárasz sowie den 3:0 Landschaftsarchitekten für die speziellen Anforderungen der betagten Klientel gerüstet wurde. Weichenbergers Entwurf trachtet danach, trotz dem grossen Gebäudevolumen Eintönigkeit zu vermeiden. Für eine optische Verkürzung sorgen die Gliederung in einen Mitteltrakt und zwei Seitenflügel sowie die leichten Knicke nach innen (Abb. 9). Die weiss verputzten Mäander an der Fassade gliedern im Wechselspiel mit der anthrazitfarbigen vorge- hängten Ziegelfassade und den Loggienöffnungen die Grossstruktur (Abb. 7). Die Brüche in der Linearität des Baukörpers kommen vor allem den offenen Raumsequenzen in den Pflegewohnbereichen zugute. Über eine geschosshohe Verglasung und vorgelagerte Terrassen öffnen sich die Tagräume zum Park hin. Die Nebenräume sind pro Station zu kompakten Inseln mit amorphem Grundriss gebündelt (Abb. 11), gliedern den weiten Raum zwischen den Zimmerfolgen und ermöglichen die Bildung von Wegschleifen. Mit einer offenen Küche samt Bar werden diese Binnenbauten auch zu sozialen Mittelpunkten jedes Wohnbereichs.
Bei den Zimmergrundrissen entschied sich der Architekt gegen die übliche Variante, das Badezimmer gangseitig anzubringen, sondern setzte es an die Aussenwand, um eine natürliche Belichtung zu ermöglichen. Auf diese Weise entstehen zwischen den Bädern an den Aussenfassaden Loggienpaare, die die Kommunikation zwischen jeweils zwei Nachbarn gestatten. Einige der Zimmer sind mit grossen Blumenfenstern zu den gemeinsamen Flächen in den Wohnbereichen versehen, bequeme Sitzbänke in den Zimmern machen Besucherinnen auch den längeren Aufenthalt angenehm (Abb. 8). Im Halbatrium, das die drei Gebäudeflügel zum Garten hin umschliessen, liegt als solitäre skulpturale Form der Andachtsraum aus Sichtbeton. Während auf seinem Dach zum Park hin ein beschaulicher Garten ausgebildet wurde, entstand über der Vorfahrt eine von beiden Demenzstationen zugängliche Terrasse, von der aus auch schwer desorientierte Menschen das Leben draussen ungefährdet beobachten können.
Geriatriezentrum Liesing: Sorgfältige Materialisierung
Auch bestehende Standorte sind Teil des Bauprogramms. Im Schlosspark Liesing im Südwesten von Wien ist seit 1876 ein Pflegeheim der Stadt in Betrieb. Bestehend aus einem Schloss aus dem 18. Jahrhundert und dem 1878 nebenan errichteten Versorgungsgebäude, entsprach es längst nicht mehr den heutigen Erfordernissen. Ein Neubau am Nordrand des Parks ersetzt nun das Versorgungsgebäude, das abgerissen wird. Das denkmalgeschützte Schloss wird instand gesetzt und wird die örtliche Musikschule beherbergen. Damit schufen die Architekten Riepl Kaufmann Bammer (Wien) zugleich eine Neuorganisation des Parkareals, in das nun auch das bestehende Parkbad im Süden des Geländes eingebunden ist. Der Neubau selbst zielt darauf ab, möglichst viele Schnittstellen und Durchdringungen zwischen Park und Gebäude zu ermöglichen.
Die Fassadenverkleidung aus Messingtrapezlochblech erdet das Gebäude farblich in der Parklandschaft und bildet für die benachbarten Amtsgebäude und Villen aus der Zeit um 1900 ein wertiges Gegenüber. Das Material setzt sich im Erdgeschoss als Deckenverkleidung fort. In Kombination mit dem Bodenbelag aus schwarz-weissem Terrazzo mit einer Gesteinskörnung aus Carraramarmor und mit den mit Ulmenfurnier belegten Wandverkleidungen wurde ein elegantes Ambiente geschaffen.
In den drei Obergeschossen des Karrees sind jeweils vier Lw-förmige Pflegewohnbereiche angesiedelt (Abb. 16). Zwei gläserne Spangen, die den internen Freibereich in drei Höfe unterteilen, sorgen für kurze Wege innerhalb der Geschosse. Zudem ermöglichen sie Rundgänge, die jeweils über zwei Pflegewohnbereiche führen. Die Orientierung wird durch subtile, aber wirksame Massnahmen unterstützt: Alle Gänge führen zum Licht hin, die abgehängten quadratischen Leuchten in den Tagräumen wurden in den Gangbereich erweitert und zeigen so schon von weitem die Lage der gemeinschaftlichen Flächen an. In die mit braunem Linoleum belegten Gänge wurden die je nach Station unterschiedlich farbigen Zimmerböden unter den Türen ein Stück hinausgezogen und dienen nun als dezente Markierungen der Zimmer. Die überwiegende Zahl der Zimmer ist nach Süden – zum Park oder Hof hin – orientiert. Messingverkleidete Schiebepaneele, die trotz massiver Optik leicht zu bedienen sind, gestatten die Beschattung der jedem Zimmer zugeordneten Freiräume (Abb. 17). Parkseitig blieb das zum Garten hin verglaste Erdgeschoss etwa zur Hälfte unbebaut, wodurch unter dem Gebäude hindurch ein Freiraumkontinuum vom Vorplatz über die Innenhöfe mit dem altem Baumbestand über die als «hortus conclusus» gestalteten, gedeckten Sitzbereiche unter dem Gebäude in den öffentlichen Park geschaffen wurde.
Im Grundriss erscheint das Gebäude nüchtern, vor Ort erweist es sich durch die sorgfältige und handwerklich präzise ausgeführte Materialisierung jedoch enorm wohnlich und von einer Hochwertigkeit, die Wertschätzung gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern und den übrigen Nutzerinnen und Nutzern ausdrückt.
Ambitioniertes Bauprogramm
Im Zeitraum von 2010 bis 2012 sind insgesamt sechs neue Pflegewohnhäuser fertiggestellt worden. Ab 2015 soll kein einziger der stationären Langzeitpflegeplätze in einem alten Gebäude untergebracht sein. Abgesehen von den unterschiedlichen städtebaulichen Gegebenheiten waren die Qualitätsdefinitionen sowie das Raum- und Funktionsprogramm bei allen Häusern annähernd gleich. Aus den Mitteln der Wohnbauförderung wird für 1800 Euro pro m² ein Basisgebäude hergestellt, weitere 1500 Euro sind für die über das Wohnen hinausgehenden Anforderungen kalkuliert. Umgerechnet auf einen einzelnen Bewohnerplatz schlägt dieser etwa mit den Kosten einer 70 m² grossen Wohnung im geförderten Wohnbau zu Buche. Bemerkenswert ist, dass die Architekten, vor allem was die Ausbildung der inneren Strukturen betrifft – z. B. bei den Zimmergrundrissen und der Anlage der Gemeinschaftsbereiche –, variantenreiche Lösungen entwickelten. Auch die Grundstimmung variiert – von der cleanen Sanatoriumsatmosphäre über eher auf Gemütlichkeit abzielende Gestaltungen bis zu elegantem Hotelambiente. Welches Konzept für die Bewohnerinnen und Bewohner das bessere ist, hängt sicher von individuellen Vorlieben ab. Nach der relativ kurzen Betriebszeit gibt es noch keine evaluierten Erfahrungswerte. Die Nutzerzufriedenheit scheint jedoch hoch zu sein und aus architektonisch-gestalterischer Sicht sind die städtischen Häuser ähnlich dimensionierten Pflegeheimen privater Betreiber um Längen voraus.
Anmerkungen:
[01] Die Stadt Wien stellte 2004 ihr Geriatriekonzept vor, dass sich mit der erhöhten Lebenserwartung der Menschen und damit auch mit einer Zunahme der nötigen Pflegeplätze befasst. Es sieht vor, die Pflegeplätze bis 2015 dezentral über insgesamt 13 Standorte (vier davon als Wohn- und Pflegehäuser) im ganzen Stadtgebiet zu verteilen. Dafür ist ein Gesamtbudget von 400 Mio. Euro vorgesehen. Weitere Informationen: www.wienkav.at/kav/ZeigeText.asp?ID=37307
[02] Das 25 ha grosse Areal des Geriatriezentrums Am Wienerwald soll ab 2015 zu einem Wohnstandort im Grünen umgestaltet werden. Den Ideenwettbewerb gewann Ende Oktober 2009 das Wiener Büro Veit AschenbrennerTEC21, Fr., 2012.08.24
24. August 2012 Franziska Leeb