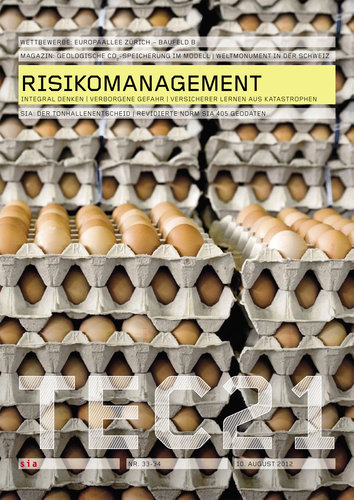Editorial
Im Alltag wird unter «Risiko» oft «gefühlte» Gefahr verstanden. Jeder Mensch trifft täglich mehr oder weniger bewusst Entscheidungen, und jede enthält Risiken und Chancen. Jeder hat sein subjektives Empfinden und seine persönliche Haltung gegenüber Risiken. Dabei zählt nicht, wie gross Risiken tatsächlich sind, sondern als wie gross wir sie empfinden – was zu einem grossen Teil von Erfahrungen abhängt.
Wenn wir uns als Gesellschaft heute weniger auf Aberglaube und Tradition verlassen als unsere Vorfahren, so nicht etwa, weil wir rationalere Menschen wären, sondern weil wir dank dem Risikobegriff rational Entscheidungen treffen können. «Der moderne Umgang mit dem Unbekannten begann mit dem Berechnen von Wahrscheinlichkeiten. Ohne Zahlen und Statistik ist Risiko etwas, das man aus dem Bauch heraus entscheidet», formuliert es Peter L. Bernstein in seinem anschaulichen Buch «Wider die Götter» zur Geschichte des Risikomanagements. Zentral ist, dass Menschen Wahrscheinlichkeiten und Risiken identifizieren können, potenzielle Schäden erkennen und dann Berechnung und Intuition abwägen.
Bernstein sagt es so: «Risiko ist eher eine Wahlentscheidung als etwas Schicksalhaftes.»
Wenn das so ist, fragt sich also nur, wer die Wahl trifft und nach welchen Kriterien – etwa wenn wir in Gebieten bauen, von denen wir die Gefährdung durch Hochwasser, Erdbeben oder Lawinen kennen. Prominentestes Beispiel derzeit sind die Ereignisse in Japan im letzten Jahr. Gemäss dem Untersuchungsausschuss des japanischen Parlaments wussten Regierung, Betreiberfirma und Aufsichtsbehörden, dass das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi zu nahe am Meer gebaut wurde, um einem massiven Erdbeben mit nachfolgenden Springwellen von 15 bis 30 m Höhe standzuhalten, wie sie in den vergangenen 120 Jahren immerhin dreimal vorkamen.
Die sechs Nuklearmeiler wurden nur 10 m über dem Meeresspiegel gebaut. Die Zerstörung der Reaktoren und der Kollaps der Kühlsysteme seien laut dem Ausschuss vorhersehbar und vermeidbar gewesen. Die Frage, warum nichts unternommen worden ist, beantwortet das japanische Parlament mit dem vernichtenden Urteil: Vetternwirtschaft.
Damit die Rationalität, zu der wir Menschen fähig sind, zum Tragen kommen kann, braucht es also eine politische Kultur, in der alle sicherheitsrelevanten Bereiche der öffentlichen Kontrolle unterstehen und die Experten, Politiker, Wirtschaftsführer und Aufsichtsbehörden zu rationalem Handeln verpflichtet. Das wäre dann der politische Teil des Risikomanagements, also die Aufgabe von uns Bürgerinnen und Bürgern.
Daniela Dietsche, Ruedi Weidmann