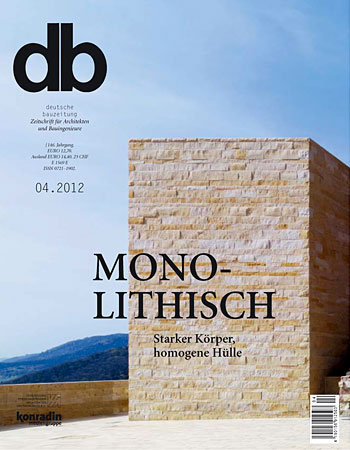Editorial
Im Kampf gegen die Banalität der gebauten Umwelt setzen Architekten auch auf ein monolithisches Erscheinungsbild ihrer Entwürfe. Dabei steht eine prägnante Gestaltung des Bauvolumens im Vordergrund. Ob Skulptur, Landmarke oder abstrahierter Baustein im historischen Ensemble: Damit sich die beabsichtigte Wirkung voll entfalten kann, bedarf es bei der Umsetzungeinerseits einer konsequenten Detaillierung von Fassade und Dach als homogener Hülle; andererseits ist es nötig, Öffnungen anteilig ausgewogen und wohldurchdacht zu setzen, um das Bild des starken Körpers nicht zu stören. Wie das gelingen kann, erläutern wir anhand von gebauten Beispielen in Deutschland, Spanien und der Schweiz. So zeigt sich z. B. das fast fensterlose Brandhaus der Stadt Zürich, dessen Inneres zu Übungszwecken der Feuerwehr regelmäßig in Flammen steht, als souveräne Betonskulptur statt als profaner Zweckbau. | Martin Höchst
Fest verankert
(SUBTITLE) Ferienhaus in Vitznau (CH)
Das Ferienhaus im Kanton Luzern überzeugt mit einer klaren, einfachen Formgebung und Materialität. Von außen steht v. a. die abstrakte, harte Betonschale im Vordergrund, die den Bau wie einen kantigen Stein vor einer mächtigen Felswand wirken lässt. Beim Nähertreten zeigt sich an den Gebäudeeinschnitten der warme, konsequent in Holz ausgeführte Innenkern, der Behaglichkeit ausstrahlt. Der Thematik des Anschlusses an das steil abfallende Gelände und dem Wunsch der Bauherren nach einem Holzhaus wird so architektonisch prägnant Rechnung getragen.
Das Ferienhaus befindet sich hoch über Vitznau, einer Gemeinde am östlichen Ufer des mehrfach verzweigten Vierwaldstätter Sees, der hier auf den Gebirgszug des Rigi trifft. Leicht außerhalb des Siedlungsgebiets, an einem steilen Hang liegend, tritt das Haus talseitig als dreigeschossiger Bau in Erscheinung, während bergseitig, von der Zufahrtsstraße aus, der Baukörper bloß eingeschossig ist. Noch steht das Einfamilienhaus alleine auf einer gegen Süden zum See hin abfallenden Bergwiese, doch zeugt bereits ein Lattengerüst von einem weiteren Bauvorhaben in unmittelbarer Nachbarschaft. Von hier genießt man einen eindrucksvollen Blick auf den Vierwaldstätter See und die Berge der Innerschweiz. Landschaftlich prägend vor Ort ist eine hohe Felswand aus Nagelfluh, die das Ferienhaus an seiner Rückseite spektakulär überragt.
Schutz vor Naturgefahren
Zu Beginn des Entwurfsprozesses wünschten sich die Bauherren ein Holzhaus. Aufgrund der Lage im steil abfallenden Gelände überzeugten die Architekten ihre Auftraggeber jedoch von der Idee eines steinernen Hauses mit hölzernem Innern: Ein konventionelles Holzhaus hätte einen klassischen Sockel benötigt, der in diesem Terrain zum dominierenden Bauteil geworden wäre.
Gleichzeitig forderten die Behörden eine Schutzwand, die bei Überschwemmungen das Wasser eines in der Nähe gelegenen Baches entlang der Zufahrtsstraße leiten soll. Die komplette Hülle in Ortbeton löst nun den Anschluss an den Hang ganz selbstverständlich. Außerdem kontrastiert sie in ihrer Scharfkantigkeit gelungen mit den freien Formen der Felswand, deren Farbigkeit sie präzise aufnimmt. Durch die Beigabe von Kies aus dem Weser-Gebiet in Norddeutschland erhielt das Betongemisch eine rötliche Färbung. Das Hochdruck-Wasserstrahlen entfernte die Zementhaut des Betons, was die rötlichen Körner der Zuschlagstoffe freilegte. Zugleich erhielt die Außenhaut durch das nachträgliche Bearbeiten eine raue Oberfläche mit einer gewissen Tiefe.
Tradition und Moderne
Von der Straße aus erreicht man über eine kurvenförmige Brücke, die auch als Zufahrtsweg zur Garage dient, einen Innenhof, der sich seitlich öffnet und mit einem Schiebetor geschlossen werden kann. Von ihm aus betritt man das offene Wohngeschoss, das von zwei Einbauten – der größere mit Küchenzeile, WC und Treppe, der kleinere mit offenem Kamin, Holzlager und Medienschrank – sowie einem weiteren Innenhof, der unmittelbar an die überdachte Terrasse anschließt, gegliedert wird. Während der Zugangshof geschlossen ist, öffnet sich der großzügige Wohnraum zum See hin. Die große Fensterfront und die Lage des Wohnzimmers hoch über dem natürlichen Geländeverlauf verleihen dem Bergpanorama eine eindrucksvolle Präsenz im Innern des Hauses. Die gelungene Inszenierung des Weges mit Richtungsänderungen setzt sich in den unteren Geschossen, in denen sich u. a. vier Schlafzimmer, Sauna und zusätzliche Loggien befinden, fort: Die beiden einläufigen Treppen sind zueinander um neunzig Grad gedreht angeordnet, die in den Gebäudekörper eingezogenen Außenbereiche stoßen an die großzügige Erschließungszone und erlauben so Ausblicke in verschiedene Himmelsrichtungen. Beim Entwurf der Schlafzimmer bezogen sich die Architekten auf Hotelzimmer und statteten sie mit frei stehenden Nasszellen aus: Dusche, WC, Waschbecken und Kleiderschrank wurden dabei zu einem Block zusammengefasst. Darin integriert ist eine aufklappbare Holzplatte, die als Gepäckablage oder Arbeitsfläche dient. Das Freistellen verleiht den Nasszellen eine Bedeutung, die über reine Nebenräume hinausgeht. Allerdings lassen die notwendigen großen Bewegungsflächen den eigentlichen Schlafbereich eher klein wirken.
Geschliffene, dreischichtige Blockholzplatten aus 35 mm dickem Lärchenholz bilden sämtliche inneren Oberflächen. Die Stabstruktur von rund 26 mm Breite und 2-2,50 m Länge wurde sichtbar belassen und farblos veredelt. So verhindert eine Lichtschutzbehandlung das Ausbleichen der Wände und ermöglicht das Umhängen von Bildern, ohne dass dunkle Flecken zurückbleiben. Dank einem wasserabweisenden Oberflächenschutz ist die Verwendung der Blockholzplatten auch in den Nasszellen möglich. Hier wurde der Bodenbelag allerdings gewachst. Einzig die Duschwanne ist aus Chromstahl und mit einem Lärchenholzrost überdeckt. Weitere Ausnahmen von der inneren Bekleidung mit Blockholz sind nur das Chromstahlblech in der Küche und das Stahlblech am offenen Kamin. Die Materialeigenschaften der Blockholzplatten, die plane Oberfläche mit fugenlos verleimten Stäben und die Verbindungen mit sichtbaren Keilzinken geben dem Innern eine Modernität, die den Bau weg vom heimeligen Chalet rückt. Trotzdem erinnert das Haus an traditionelle Bauten in den Bergen, wo oftmals eine steinerne Hülle einen Holzbau aufnimmt. Auch für die Böden der Loggien, die mit Flüssigkunststoff abgedichtet und mit einem gewachsten Holzrost belegt sind, sowie für die Fenster und die Rollläden wurde Lärchenholz verwendet.
Monolithisch detailliert, sicher ummantelt
Die zueinander versetzten Öffnungen der Fenster und der Loggien sind geschosshoch ausgebildet und verfügen über Glasbrüstungen als Absturzsicherung. Um die monolithische Wirkung der Außenhülle zu unterstützen, wurde an den Fensterbänken und am nach innen geneigten Dachrand auf Blechabdeckungen verzichtet. Stattdessen erfolgte auch hier die Abdichtung mit Flüssigkunststoff. Um ihr Aussehen an den Beton anzugleichen, wurden die Fensterbänke nach dem Abdichten mit feinen Körnern aus der Kiesmischung des Betons bestreut.
Innerhalb der schützenden Hülle aus Ortbeton befindet sich ein selbsttragender Holzelementbau aus vorfabrizierten, gedämmten Hohlkastenelementen. Damit konnte zumindest im Innern dem Wunsch der Bauherrschaft nach einem Holzhaus entsprochen werden. Der Holzbau muss dank der äußeren Betonhülle keine Schubkräfte aufnehmen und konnte daher optimiert werden. Nach dem Fundieren mit Pfählen und der Hangsicherung wurden zuerst die Kastenelemente aufgerichtet und mit einer Dampfsperre und einer zusätzlichen Dämmung versehen. Das Betonieren der 250 mm dicken Außenhaut konnte anschließend mit einer einhäuptigen Schalung erfolgen. Inzwischen beurteilen die Architekten den Bauablauf kritisch; rückblickend erscheint ihnen eine geschossweise und gleichzeitige Errichtung von Holzbau und Betonhülle wesentlich zweckmäßiger, da es für den Holzbauer einfacher ist, Ungenauigkeiten der Baumeisterarbeiten aufzunehmen als umgekehrt.
Den hohen Energiestandard hingegen würden die Architekten heute wieder anstreben. Eine hohe Dämmung, Dreifachverglasungen und eine kontrollierte Lüftung tragen dazu bei, dass das Ferienhaus die Anforderungen des schweizerischen Labels »Minergie Standard« erfüllt, auch wenn es nicht zertifiziert wurde. Die Heizung übernimmt eine Erdsonden-Wärmepumpe, die über Mobilfunk bereits aus der Ferne aktivierbar ist.
Gewappnet für den sich ändernden Kontext
Es liegt in der Natur der Sache, dass stark abstrahierte Bauten ihre Schwachstellen kaum verbergen können. So etwa beeinträchtigt eine talseitige Begradigung des Geländes für eine Liegewiese das Bild des Steins, der am Hang liegt. Auf der anderen Seite stört der gekurvte Zufahrtssteg mit seinen massiven Brüstungen die Klarheit des Baukörpers – auch wenn es die Absicht der Architekten war, die Straße bis in den Zugangshof zu führen. Von weiter oben erkennt man, dass die fünfte Fassade, das Dach, leider nicht im gleichen Abstraktionsgrad ausgebildet werden konnte wie die restlichen vier Fassaden: Die Aufbordung des Dachrands umfasst ein konventionelles begrüntes Dach, das aufgrund der Bauvorschriften verlangt war.
Trotz dieser Kritikpunkte zeigt das Ferienhaus einen möglichen Umgang mit einem nicht vorhersehbaren Kontext auf. Auch wenn es im Moment noch alleine auf der grünen Wiese steht – in Zukunft werden die Nachbarparzellen überbaut sein. »Reichtum« und räumliche Entfaltung sind deshalb ins Innere verlegt und die Außenräume so angelegt, dass sich beim Aufenthalt auf den eingezogenen Loggien die nähere Umgebung ausblenden lässt. Stattdessen wird der Blick in die Ferne auf den See und auf die Berge gelenkt. Der kraftvollen, monolithischen Hülle nimmt man ab, dass sie auch in einem veränderten Umfeld bestehen kann.db, Di., 2012.04.03
03. April 2012 Matthias Benz
Angeschliffene Felsen
(SUBTITLE) Zwei Einfamilienhäuser in Oberweningen (CH)
In einem Dorf im Züricher Unterland sind auf einem Grundstück, das für ein Haus zu groß, für zwei Häuser aber zu klein war, zwei »getrennte Doppelhälften« entstanden, wie die Architekten es nennen. Ringsum mit verzinkten und durch Ätzung modifizierten Stahlblechplatten bekleidet, ruhen die nach dem Split-Level-Prinzip organisierten Häuser als zwei autonome Volumina am Hang. Dabei ist es gelungen, die Deformation der Gebäudegestalt auch im Innern fruchtbar zu machen.
Eine knappe halbe Stunde benötigt die S-Bahn vom Züricher Hauptbahnhof bis Schöfflisdorf-Oberweningen. Der Zug passiert zunächst das Züricher Industriequartier, dann den Stadtteil Oerlikon und bewegt sich schließlich in westlicher Richtung in die Agglomeration. Am östlichen Rand zu Füssen der Lägern, jenes Bergzugs, der sich bis nach Baden an der Limmat erstreckt, liegt Oberweningen. Der Ort ist in seinem Kern ein von Fachwerkhäusern geprägtes Bauerndorf, das seit langer Zeit durch den suburbanen Druck der nahe gelegenen Metropole sein Gesicht verändert hat und dabei mit dem Nachbardorf Schöfflisdorf untrennbar zusammengewachsen ist.
Knapp außerhalb der Dorfkernzone, und damit nicht den dort gültigen Restriktionen wie Dachüberstand, Holzsichtigkeit etc. unterworfen, war eine Parzelle frei geblieben, die eine problematische Größe besaß. Für ein Einfamilienhaus war sie zu groß, für ein klassisches Doppelhaus indes zu klein. Es hätte zu einem Ungleichgewicht zwischen den beiden Haushälften geführt, gleich ob bei einem nach Norden und Süden oder einem nach Osten und Westen ausgerichteten Gebäude.
Vom Orthogonalen zum Polygonalen
Der Bauunternehmer, dem das Grundstück gehörte, beauftragte daher das im nahen Regensberg ansässige und ihm aufgrund mehrerer gemeinsamer Projekte bekannte Architekturbüro L3P damit, Alternativen zum simplen Konzept eines Doppelhauses zu erarbeiten. Ausgangspunkt für Boris Egli von L3P war ein mehr oder minder quadratisches Gebäude mit West-Ost ausgerichtetem Satteldach. Zunächst teilte er das Volumen in der Mitte und verschob die eine Hälfte leicht nach Norden, die andere nach Süden. Um die Belichtungssituation für die beiden extrem nahe beieinanderstehenden Häuser weiter zu verbessern, wurden die Seiten angeschrägt, sodass sich keilförmige Zwischenräume ergaben. Die letzte Operation stellte die Eliminierung der Dachfirste zugunsten abgeschrägter Flächen dar, die man als geometrisch radikalisierte Variante eines Krüppelwalmdachs verstehen kann.
Zunächst beabsichtigten L3P, die beiden Häuser in Sichtbeton auszuführen. Doch dies hätte eine doppelschalige Konstruktion erzwungen – eine recht kostenintensive Lösung, die angesichts der komplexen Geometrie in Oberweningen den finanziellen Rahmen vollends überstiegen hätte. So fiel die Entscheidung, die Konstruktion des Hauses zwar in Beton zu realisieren, die Hülle aber in Stahl auszubilden. Die Architekten wünschten sich weder braunen Cortenstahl noch gleißend-spiegelnde Platten, sondern eine lebendige, je nach Witterung und Lichtverhältnissen changierende Oberfläche. Daher zogen sie den Künstler Thomas Sonderegger aus Arbon hinzu, der sich seit Langem mit der chemischen Behandlung von Metalloberflächen beschäftigt. Dieser entwickelte ein Ätzverfahren für die stehend eingesetzt, verzinkten Stahlplatten. Die Herausforderung bestand darin, eine homogene Textur zu vermeiden und dennoch ein monolithisches Gesamtbild zu erzeugen. Das ist auf das Überzeugendste gelungen: Blickt man aus der Nähe auf die einzelnen Platten, so zeigt sich ein abstraktes, überaus lebendiges Sfumato aus Blau-, Schwarz-, Weiß- und Rosttönen. Aus der Ferne indes ist der Eindruck homogen, lässt sich die eigentliche Materialität kaum erkennen. Man könnte fast an Beton denken, noch eher an Naturstein. Die eigenliche Machart der Fassaden- und Dachflächen verschwindet optisch. Die Fugen zwischen den Platten an den Fassaden sind extrem schmal, und auch die zwecks Ableitung des Regenwassers schuppenartige Überlappung auf dem Dach tritt aufgrund der minimalen Plattenstärke nicht in Erscheinung.
Als »angeschliffene Felsblöcke« unterscheiden sich die beiden Häuser von der heterogenen Bebauung ringsum, doch wirken sie nicht zuletzt aufgrund der Materialität und ihrer Farbigkeit keineswegs aufdringlich. Mag sein, dass dies wundersamerweise dazu geführt hat, dass es weder mit den örtlichen Behörden noch mit den Nachbarn Auseinandersetzungen gegeben hat. Zumindest sei das in dieser Gegend kaum als Normalfall zu werten, wundert sich selbst Boris Egli.
Treppen, Wege und Durchblicke
Mauern aus Beton trennen das Grundstück in nordsüdlicher Richtung, verhindern Einblicke und gewähren trotz geringem Abstand die gewünschte Privatheit. Im Bereich zwischen den Häusern befinden sich spiegelnde Wasserflächen, deren Reflektionen zusätzlich dazu beitragen, die jeweils gegenüberliegende Fassade zu beleben. Denn nicht zuletzt aus Brandschutzgründen ist die Fassade der Häuser dort, wo das Gegenüber Fensteröffnungen besitzt, geschlossen. Grundsätzlich sind die Häuser mit annähernd gleicher Nutzfläche symmetrisch organisiert, ohne dass dies indes sklavisch befolgt wurde. So lässt sich eher von Gleichwertigkeit als von Gleichheit sprechen.
Das nach Norden ansteigende Gelände legte eine Organisation nach dem Split-Level-Prinzip nahe. Der Hauptzugang der Gebäude erfolgt von den zur Erschließungsstraße hin leider etwas mächtig auftretenden Tiefgaragen aus. Man passiert die Kellerräume und gelangt ein halbes Geschoss höher in einen dem Hang abgerungenen Arbeitsraum, der über ein schachtartig aus dem Gelände ausgestanztes, japanisch anmutendes Atrium belichtet wird. In Gegenrichtung führt der Weg weiter zu der nach Süden orientierten Küche (im westlichen) oder dem Wohnbereich (im östlichen Gebäude). Die Treppe wechselt die Gebäudeseite und leitet empor zum Wohnbereich (im westlichen) und zur Küche (im östlichen Gebäude). Auf der obersten Ebene, unter der gefalteten Dachlandschaft, sind schließlich mit Bad und Schlafzimmern die privaten Wohnräume angeordnet.
Obwohl die einzelnen Räume nicht unbedingt üppig dimensioniert sind, ergibt sich im Innern eine erstaunliche Großzügigkeit. Verantwortlich dafür sind die vielfältigen, aufgrund des Verzichts auf ein durchgehendes Treppenhaus sich ergebenen Durchblicke zwischen den einzelnen Geschossen, aber auch die geschickte Belichtung der Hauptwohnräume über in trichterförmige Deckenausstülpungen integrierte Lichtbänder in den Dachschrägen. Formal und farblich reduziert, ohne in eine Ästhetik von Hochglanzzeitschriften abzugleiten, zeigt sich das Innere: Zum rohen Sichtbeton der Konstruktion und dem Weiß der Einbauten und – zum Teil ebenfalls von den Architekten entworfenen – Möbel und Raumteiler gesellt sich im Bereich der Nasszellen die Farbe Grün. Vertikale, in die Wände und Treppenwangen eingelassene Lichtbänder rhythmisieren darüber hinaus den Weg durch das Haus.
Während sich angesichts des zeitgenössischen Bauens in der Schweiz mitunter der Verdacht aufdrängt, ein Haus müsse partout schräge Flächen aufweisen, ist es L3P wirklich gelungen, aus der Polygonalität des Volumens auch im Innern Kapital zu schlagen und verkrampfte Partien, bei denen die Deformationen des Äußeren im Inneren keinen Widerhall finden, zu vermeiden.db, Di., 2012.04.03
03. April 2012 Hubertus Adam
Salzberg an der Orangenküste
(SUBTITLE) Firmenhauptsitz in Castellón (E)
Die einer Hügelkette nachempfundene Form verleiht dem Verwaltungsgebäude in der Nähe von Valencia Halt im Durcheinander der suburbanen Peripherie. Bedauerlicherweise von Leerstand bedroht, überzeugt der Bau durch seine außergewöhnliche Gestalt und die intelligente Nutzung der Ressourcen.
Wie die Spitzen eines Salzbergs ragt das Dach der Grupo Azahar wenige Meter über die Baumwipfel, ein flüchtiges Bild von der Autobahn. Die Zufahrt zum Gebäude erfolgt über einen holprigen Seitenweg im Schatten der Schnellstraße vorbei an Orangenbäumen und Industriearealen. In der Peripherie zwischen felsiger Berglandschaft und der Betonskyline der spanischen Hafenstadt Castellón baute sich die Grupo Azahar, deren Betätigungsfeld vom Garten- und Landschaftsbau bis hin zur Recyclingtechnik reicht, ihren Haupsitz, eine Enklave mit Obsthainen, Pflanzhäusern und einem mit Gras umwachsenen Teich. Hier entstanden Arbeitsplätze für Ingenieure, die sich mit der Entwicklung nachhaltiger Technologien beschäftigen, und Gärtner, die Pflanzen für den Landschaftsbau züchten. Auf der Suche nach der passenden Architektur lud die Firma einige ausgesuchte Architekten zum Wettbewerb, aus dem der Entwurf des Office of Arquitecture Barcelona/Carlos Ferrater als Sieger hervorging: Ferrater versteht es, die Landschaft und die Ansprüche der Firma an Funktion und Nachhaltigkeit des Gebäudes gleichermaßen zu berücksichtigen und dabei eine besondere Atmosphäre durch Licht und Raumproportionen zu schaffen.
Landmarke und Enklave
Das Gebäude bilden zwei Baukörper, die sich parallel in Ost-West-Richtung erstrecken. Ihre nach außen gewandten Seiten sind jeweils geschlossen – zwei lange Wände, gefaltet wie Papier. Sie gehen fast nahtlos in die geneigten, weißverputzten Flächen des Dachs über. Dessen bewegte Kontur wiederum zeichnet die Berge im Norden nach. Nur das reflektierte Tageslicht profiliert die Kubatur je nach Sonnenstand unterschiedlich. So entsteht für den Betrachter aus Süden und Norden aus einiger Entfernung und von Nahem ein monolithischer und auf sich bezogener Eindruck. Projektarchitektin, Núria Ayala, erläutert – die architektonische Idee nachvollziehbar: »Der Umgebung fehlt das Urbane, also haben wir einen intimen, abgeschlossenen Ort geschaffen, angenehm zum Arbeiten.« Ferrater betont zudem die tektonische Idee zum Gebäude, dessen Flächen sich wie eine Landschaft fügen und so unterschiedliche Raumerlebnisse ermöglichen: »Die Form erzeugt nicht nur verschiedene Höhen in der Kubatur, sondern auch verschiedene Ausblicke und Atmosphären im Innern des Gebäudes.«
Wer das Areal von seiner Eingangsseite im Westen betritt, dem zeigt sich das Gebäude offener und weniger massiv. Der Weg führt zwischen den Gebäudespangen in einen der beiden Höfe. Eine Holzpergola über der umlaufenden, geschosshohen Verglasung spendet Schatten. Zur Rechten und zur Linken arbeiten die Angestellten mit Blick auf den Besucher, der über den Hof zum Foyer gelangt, dem zentralen Knotenpunkt zwischen den Bürospangen.
Fliessende Räume
Im Foyer wird klar, was Ferrater mit Raumerlebnis meint: Der gläserne Eingang ist niedrig, mit dem ausgestreckten Arm lässt sich fast der Türrahmen fassen. Während im EG die Glasfassaden die angrenzenden Höfe wie Bilder rahmen, staffelt sich der Luftraum darüber in die Höhe. Nach Norden ausgerichtete Dachöffnungen erhellen das Foyer mit einem diffusen Licht, das weit auf die Deckenunterseiten streut, und geben gleichzeitig den Blick auf die Berge frei: ein sakral wirkender Raum, das Herz des Gebäudes, architektonisch wie funktional.
In den beiden Bürospangen ergeben sich von hier aus vier unabhängig voneinander bespielbare Gebäudetrakte, in denen sich jeweils ca. 10 bis 15 Arbeitsplätze befinden. Die Organisation des Grundrisses spiegelt so die der Firma mit ihren vier unabhängigen Abteilungen wider. Die gemeinschaftliche Infrastruktur, wie Besprechungsräume, Teeküche und Waschräume ist vom Foyer aus erschlossen. Darüber findet sich ein zweites Geschoss mit den Räumen der Geschäftsleitung.
Die Übergänge der Räume sind fließend und transparent: Glasinnenwände und Schwingtüren verbinden Büros, Flure und Sonderräume optisch miteinander. Panoramafenster mit fast bodenbündigen Profilen lassen den Blick ungehindert in den Hof schweifen. Auch der einheitliche Bodenbelag für Innen und Außen, ein italienischer Naturstein, wirkt schwellenlos. Dort, wo Innenwände keinen Durchblick ermöglichen, erweitern Glasoberlichter die Dachuntersicht, so bleibt die großzügige Aufweitung der Büros in der Höhe auch in den Einzelbüros erlebbar. Die Installationen liegen versteckt hinter Schrankeinbauten vor den geschlossenen Außenwänden; der Innenraum bleibt dadurch frei von sichtbarer Technik, ein klarer, luftiger Eindruck entsteht. Die Einfachheit aller Details und der nahtlose Übergang zum Freiraum veranschaulichen das Selbstverständnis der Firma, das sich auf die Nähe zur Natur und Landschaft gründet. Die auffällige Kubatur ist also kein Selbstzweck: Sie ist nicht nur Landschaftszitat, sondern schafft im Innern eine luftige Atmosphäre trotz geringer Gebäudetiefen. Die geschlossenen Wände ziehen nicht nur notwendige Grenzen im suburbanen Durcheinander, sondern sind auch klimatisch sinnvoll, die Gliederung des Gebäudes in verschiedene Trakte schafft nicht nur einen Bezug zur Landschaft, sondern unterstützt v. a. die Firmenorganisation. Mit einfacher aber unverwechselbarer Architektur schafft Ferrater eine enorme funktionale und atmosphärische Vielschichtigkeit.
WDVS am Mittelmeer
Schnörkellos, kostengünstig und pflegeleicht, so wünschte sich der Bauherr das Gebäude. Die Betonkonstruktion hat daher eine für Spanien ungewöhnliche thermische Hülle. Ein Wärmedämmverbundsystem wurde auf den Betonaußenwänden verschraubt und mit einem speziellen Putz versiegelt. Dieser ist fugenlos verarbeitet, wasserabweisend, sehr hart und durch seine glatte Oberfläche wenig schmutzanfällig. So können Fassaden und Dach einfach mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Eine hochgedämmte Fassade statt aufwendiger Klimatechnik, in Spanien ist das bei modernen Bauten keine Selbstverständlichkeit. Die thermische Hülle und die Ausrichtung des Gebäudes alleine wirken sich schon positiv auf das Raumklima aus. Dazu kommt, dass der solare Wärmeeintrag durch die Orientierung der Gebäudeöffnungen nach Innen und durch die Pergola stark verringert und gleichzeitig eine Querlüftung über die Höfe und Oberlichter möglich ist. Fensterhohe, manuell schaltbare Ventilationsöffnungen in der Glasfassade unterstützen die natürliche Lüftung. Zusätzlich planten die Architekten eine Zulufttemperierung, die in den heißen Monaten Juli und August die Räume kühlt und in den kälteren Monaten Dezember und Januar das Gebäude erwärmt. Auch bei der Tageslichtausbeute wirkt die bauliche Gestaltung unterstützend: An diesem eher bedeckten Wintertag sind nur einzelne Schreibtischleuchten notwendig, um für genügend Helligkeit in den Büros zu sorgen – dank der geringen Gebäudetiefen und der zahlreichen Glaseinbauten. Weil Wasser an der Orangenküste ein seltenes, dennoch oft verschwendetes Gut ist, planten die Ingenieure einen Teich, der Regenwasser vom Gebäude und aus dem Hof sammelt und den Toiletten und dem Garten zuführt.
Konsequente Planung als Chance
Die Grupo Azahar arbeitet viel für öffentliche Auftraggeber und ist nun schwer von der spanischen Wirtschaftskrise getroffen. 2011 musste sie bereits das Gebäude an die Bank übergeben. Nur noch wenige Angestellte arbeiten heute vor Ort. Derweil nun die Pflanzenschätze verkümmern, der Garten verwildert und vertrocknet, plant die Bank die Nachnutzung des Gebäudes. Die Stärke des Baus sollte sich in diesem Augenblick beweisen: Im Gespräch ist ein Zentrum für kleine Firmen. Prägnante Architektur, geringer Wartungsaufwand und ein Grundriss mit separierbaren Gebäudetrakten machen die Umnutzung möglich. Gute Aussichten also, dass im Salzberg an der Orangenküste die Arbeit weitergeht.db, Di., 2012.04.03
03. April 2012 Rosa Grewe