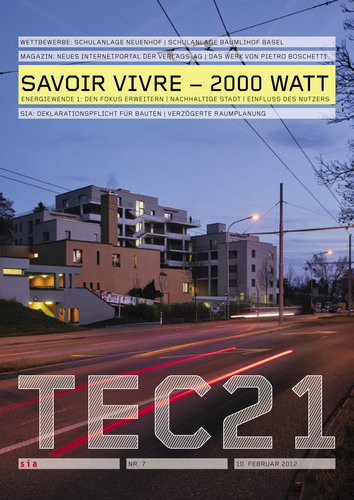Editorial
Dieses Heft eröffnet eine Reihe von acht Ausgaben, die wir 2012 der seit «Fukushima» viel beschworenen «Energiewende» widmen werden. Dabei spielt der Gebäudepark eine wichtige Rolle – rund die Hälfte des Schweizer Energiebedarfs geht auf sein Konto. Die Bemühungen zur Reduktion dieses Anteils konzentrieren sich bisher fast ausschliesslich auf technische Massnahmen, während der «Faktor Mensch» weitgehend ausser Acht gelassen wird. Das dürfte sich ändern, denn er ist bedeutend: In energieeffizienten Gebäuden ist der real gemessene Energieverbrauch oft höher als die Planungswerte – da sich die Nutzerinnen und Nutzer anders verhalten als angenommen, etwa mehr Wärme oder Licht bevorzugen, Fenster offen stehen lassen oder Räume intensiver nutzen.
Die mittlerweile von vielen Schweizer Gemeinden als Ziel anvisierte 2000-Watt-Gesellschaft ist ein Pro-Kopf-Prinzip. Die wahre Effektivität von energetischen Baumassnahmen muss deshalb ebenfalls pro Kopf und nicht pro Quadratmeter gemessen werden. Eine energetische Erneuerung reduziert den Energiebedarf pro Fläche; geht aber damit eine Reduktion der Bewohnerdichte einher, hebt dies den Spareffekt wieder auf. Solche «Reboundeffekte» gibt es auch in anderen Bereichen: Elektrische Haushaltsgeräte werden immer effizienter, aber wir benützen mehr davon; Motoren werden sparsamer, aber die Autos sind dafür schwerer, und wir fahren häufiger und weiter damit. Darum hat die Energiewende in der Schweiz noch nicht einmal angefangen: Der Energieverbrauch ist in den letzten Jahren ungebrochen parallel zum Bruttosozialprodukt gestiegen.
Will man Reboundeffekten entgegenwirken, muss man beim Lebensstil ansetzen. Das tönt unbequem und scheint schwieriger, als auf technische Massnahmen zu hoffen. Relevant sind vor allem die Anzahl Nutzende pro Fläche, das Nutzerverhalten im Gebäude und das Mobilitätsverhalten. Dass gute Bauprojekte die Werte dieser drei Faktoren deutlich verbessern können, macht etwa die Baugenossenschaft KraftWerk1 in Zürich seit zehn Jahren vor. Sie hat es nun nachmessen lassen: Die 240 Bewohnerinnen und Bewohner der Gründersiedlung verbrauchen statt des schweizerischen Durchschnitts von etwa 6000 Watt rund 3400 Watt pro Kopf, dank Haustechnik, weniger Flächenverbrauch und weniger Automobilität. Dies nicht aus Freude am Verzicht, sondern weil dieser Lebensstil ihnen ein Plus an Lebensqualität bietet.
Der Fotograf Hannes Henz wird die Reihe zur Energiewende mit seinen Bildern illustrieren. Zum Auftakt hat er Wohnorte fotografiert, die in diesen Tagen von Menschen aufgegeben werden, die in die neue Siedlung KraftWerk2 ziehen.
Claudia Carle, Ruedi Weidmann
In eigener Sache: Seit Mitte Januar ist unser neues Internetportal www.espazium.ch online (vgl. S. 12). Das Logo wird zukünftig in den Printausgaben auf weiterführende Berichterstattung im Internet hinweisen.
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Schulanlage Neuenhof | Schulanlage Bäumlihof Basel
12 MAGAZIN
Neues Internetportal der Verlags-AG | Das Werk von Pietro Boschetti
18 NACHHALTIGES BAUEN - DEN FOKUS ERWEITERN
Roland Stulz
Nachhaltiges Bauen darf nicht beim Thema Betriebsenergie stehen bleiben, sondern muss auch den Lebensstil und Aspekte wie graue Energie oder induzierte Mobilität berücksichtigen.
21 VON DEN UMWELTLABELS ZUR NACHHALTIGEN STADT
Andreas Hofer
Die Baugenossenschaft KraftWerk1 in Zürich ist eine Pionierin der Nachhaltigkeit. Die Nachevaluation ihrer Gründersiedlung und die partizipative Planung neuer Projekte führen zu einem immer breiteren Konzept von Nachhaltigkeit.
28 DER EINFLUSS DEES GEBÄUDENUTZERS
Paul Knüsel
Gebäudenutzer können bei Raumklima, Warmwasser- und Stromverbrauch je mindestens 20 % des Energiebedarfs einsparen. Dafür braucht es aber entsprechende Kommunikation und Anreize.
34 SIA
Gesucht: «Praktiker» | Lichtung im Labeldschungel | Deklarationspflicht für Bauten | Verzögerte Raumplanung
40 FIRMEN
42 WEITERBILDUNG
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Von den Umweltlabels zur nachhaltigen Stadt
Zehn Jahre nach ihrer pionierhaften Gründersiedlung in Zürich West hat die Genossenschaft KraftWerk1 ihr zweites Projekt fertiggestellt und ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Die Erfahrungen im Siedlungsalltag und die Strategiediskussionen für weitere Siedlungen führen die Genossenschaft dazu, Nachhaltigkeit immer breiter zu denken, das heisst ökologische Standards, Bewirtschaftung und Bewohnerverhalten gesamthaft zu evaluieren und dem Ziel 2000-Watt-Gesellschaft weiter anzunähern.
KraftWerk1 war über Jahre eine Idee ohne Gebäude (TEC21 42/2001). Dieser Status erwies sich als starkes Fundament einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie. Die Genossenschaft wuchs aus einer breit geführten Diskussion mit verschiedenen Anspruchsgruppen über nachhaltiges, städtisches Leben, soziale Integration und neue Wohn-, Arbeits- und Lebenszusammenhänge. Diese Diskurskultur lebte weiter, als die Planung der ersten Siedlung konkret wurde. Sie verpflichtete die zunehmend professionellen Gremien der Genossenschaft auf hohe Ziele und bildete die Basis für die Vermietung der Grosswohngemeinschaften und für die Organisationsstruktur, die bis heute wesentlich von Arbeitsgruppen für verschiedene alltägliche Belange geprägt ist.
Die Genossenschaft pflegt auch bei allen neuen Projekten einen intensiven partizipativen Prozess, der so früh wie möglich einsetzt. Die Leiterin des Ressorts Siedlungsprojekte im Vorstand lädt zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern aus den Ressorts Soziales, Kommunikation und Bau frühzeitig Interessierte ein, um über das Raumprogramm und soziale und ökologische Ziele zu diskutieren. Hier entstehen die Vorgaben für die Architekturwettbewerbe. Die Jurierungen sind öffentlich, und die Architekturteams präsentieren regelmässig den Planungsstand. Die partizipativen Prozesse richten sich immer auf das ganze Projekt: Es geht nicht darum, mit einem «Baugruppenmodell» eine künftige Bewohnerschaft zu bilden, und explizit auch nicht um die Gestaltung der späteren eigenen Wohnung. Der Einbezug von «Laien» in die Entwicklung grosser Bauprojekte und das Bekenntnis der Genossenschaft, mit ihren Projekten neue Lösungen zu suchen, verändern auch die Kultur unter den Planungsprofis. Sie müssen in Workshops ihre Konzepte verständlich erklären und auch in der Baukommission der Genossenschaft bereit sein, Erprobtes zu hinterfragen und technische, finanzielle und energetische Aspekte innovativ zu verknüpfen. Mit KraftWerk1 zu planen, ist deshalb anstrengend und braucht Offenheit und Dialogbereitschaft.
Ökobilanz als ganzheitliches Steuerungsinstrument
Zu Beginn der Planungsphase von KraftWerk1 existierten die heute etablierten Labels für energieeffizientes Bauen noch nicht. Mit Gabor Doka, einem Spezialisten für Ökobilanzierungen, erarbeitete KraftWerk1 ein Bewertungsmodell und beschloss, 2% der Anlagekosten (1Mio. Fr.) für ökologische Massnahmen zu reservieren. Entscheidend war dabei, dass sich die Ökobilanz nicht auf das Gebäude bezog, sondern auf die gesamten Verbräuche eines durchschnittlichen Menschen in der Schweiz. Die angewendete Methode (Eco Indicator 95) berechnete Energieverbrauch und Umweltbelastungspunkte für die verschiedenen alltäglichen Tätigkeiten. Dies erlaubte es, die energetisch effizientesten Massnahmen zu bestimmen und sie mit anderen ökologischen Massnahmen – wie Wasserspartechnologien und Investitionen in die Biodiversität – zu vergleichen. Schliesslich flossen drei Viertel der Mittel in bauliche Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs. Das grösste Gebäude erfüllt den während des Planungsprozesses lancierten Minergiestandard, in den kleineren Gebäuden wurde auf eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung verzichtet. Kleinere Beträge wurden für viele weitere ökologische Massnahmen verwendet, ein Rest für Umweltprojekte nach dem Bezug. 2009 verglich das Umweltbüro Carbotech die Ökobilanz aus der Planungsphase mit den gemessenen Werten. Die mittlerweile verbesserte Methodik (Advanced LCA compare) bestätigte die ursprünglichen Annahmen weitgehend. In KraftWerk1 gelang es, den Verbrauch einer Person auf durchschnittlich 3400 Watt zu senken. Diese erhebliche Reduktion gegenüber dem schweizerischen Durchschnitt von etwa 6000 Watt ist dem guten energetischen Standard, einer deutlich reduzierten individuellen Mobilität und dem tiefen Flächenverbrauch von 36 m² pro Person zu verdanken. Das zeigt, dass Verbräuche mit einem ganzheitlichen Massnahmenbündel zwar massiv reduziert werden können, jedoch für einen 2000-Watt- Lebensstil tiefer greifende Veränderungen nötig sind, die über ein Bauprojekt hinausreichen.
Verloren im Labelwald
So erfreulich die Ausbreitung von Strategien (SIA-Effizienzpfad, 2000-Watt-Gesellschaft), technischen Konzepten (LowX, Plusenergiehäuser) und Labelfamilien (Minergie, Minergie-A, -P, -Eco) als Ausdruck gesteigerten Umweltbewusstseins ist, so unpraktikabel erweist sich für KraftWerk1 der Umgang mit diesen Instrumenten. Das Thema wird auf der technischen Seite immer präziser gefasst. Ein Heer von Ingenieurinnen und Beratern plant komplexe haustechnische Systeme, die Bauindustrie verkauft diese gerne, und so kann sich auch eine weitab jeder ÖV-Haltestelle gelegene Einfamilienhaussiedlung mit einem Umweltlabel schmücken. Aber es fehlen Auswertungen über die effektiv im Betrieb erreichten Werte, und es fehlen Konzepte für die nachhaltige Verankerung des komplexen Wissens im Alltag. Das wachsende technische Umweltwissen erschwert Berechnungen und die Kommunikation mit den Umwelthandelnden: den Wohnenden und Arbeitenden. Dass beispielsweise Primärenergiefaktoren bei Minergie und im SIA-Effizienzpfad unterschiedlich definiert sind – so berechtigt deren Herleitung jeweils sein mag –, führt zu Fehlern und Missverständnissen und erschwert die internationale Vergleichbarkeit. Das wird im Umweltbericht von KraftWerk1 deutlich (Kasten S. 22). In der ersten Ausgabe ist es noch nicht gelungen, die Kennzahlen so zu vermitteln, dass Fachleute die Gebäude in bestehende Labels einordnen und gleichzeitig die Genossenschaftsmitglieder ihren Beitrag zu einer besseren Umweltperformance erkennen können. Deutlichster Ausdruck davon, dass die ausschliesslich technische Lösung eines gesamtgesellschaftlichen Problems nicht zum Ziel führt, sind jedoch die mageren Resultate im Grossen: Der Energieverbrauch in der Schweiz folgt nach wie vor unerbittlich der Entwicklung des Bruttosozialprodukts, eine Trendwende ist nicht in Sicht. Im Neubau setzen sich Niedrigenergiekonzepte durch, die gesetzlichen Normen verlangen mittlerweile sehr viel. Doch das wird durch den wachsenden Flächenverbrauch pro Kopf zunichte gemacht (vgl. Artikel S. 18). Und im Bestand geschieht wenig – vielleicht sogar, weil hier die hohen Anforderungen an die energetische Performance abschreckend wirken.
KraftWerk2: vom bautechnischen Albtraum zum Wohnexperiment
Diese Herausforderung stellte sich beim zweiten Projekt der Genossenschaft. Die Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime kam bei einer Überprüfung ihrer pädagogischen Angebote und ihrer strategischen Ziele zum Schluss, dass sie einen Teil des Zentrums Heizenholz in Zürich Höngg nicht mehr benötigte, und wollte zwei Häuser zu Wohnzwecken abgeben. Die Arealüberbauung aus den frühen 1970er-Jahren ist von hoher architektonischer Qualität, die Stadt hat sie seinerzeit als «Gute Baute der Stadt Zürich» ausgezeichnet. Die Stiftung erarbeitete für ihre Gebäude ein Erneuerungskonzept und ging davon aus, dass die Baurechtnehmerin die beiden Häuser im Rahmen dieses Konzepts umbauen würde. Im Bewerbungsverfahren unter gemeinnützigen Wohnbauträgern Ende 2007 stellte KraftWerk1 fest, dass das Areal über erhebliche Ausnutzungsreserven verfügte, und schlug vor, diese auszuschöpfen und somit das Projektvolumen deutlich zu vergrössern. Die beiden ursprünglich für Jugendwohngruppen genutzten viergeschossigen Häuser waren Zeugen ihrer Zeit: massive Backsteingebäude mit einem enormen Energieverbrauch, einer maroden Haustechnik und knappen Geschosshöhen, engen Grundrissen mit vielen tragenden Wänden, kurzum: ein bautechnischer Albtraum. Wenn für vierzigjährige Gebäude der Abriss zur Option wird, zeigt dies, wie wacklig Berechnungen von grauer Energie und Absenkpfaden bis ins Jahr 2150 sind – einen Zeitraum, den wir beim besten Willen nicht überblicken. Ein Ersatzneubau kam nicht infrage, weil bereits der Vorschlag, den Bestand zu verdichten, die Baurechtgeberin herausforderte, die sich vor jahrelangen Planungs- und Bauprozessen fürchtete. (Das seit Jahren juristisch umkämpfte Wohnprojekt Ringling ist in unmittelbarer Nähe geplant.)
Früh äusserte eine Gruppe älterer Menschen ihre Wohnbedürfnisse und brachte sich mit viel Energie in die Entwicklung eines Mehrgenerationenprojekts ein. Das Raumprogramm für den Studienauftrag umfasste einen breiten Wohnungsmix mit einem grossen Anteil an Kleinwohnungen, einigen Familienwohnungen, Wohngemeinschaften und als neues Experiment zwei Clusterwohnungen (Abb. 5 und TEC21 7/2011). In diesen sind verglichen mit einer klassischen Wohngemeinschaft die individuellen Bereiche grösser und mit einer bescheidenen Sanitär- und Kochinfrastruktur ausgestattet. Das Architekturbüro Adrian Streich gewann den Wettbewerb mit dem Projekt «terrasse commune», das die beiden Gebäude mit einem Zwischenbau zu einem grossen Haus verband. Der Zwischenbau bringt die barrierefreie Erschliessung und nimmt einen Grossteil der Gebäudetechnik auf, die Altbauten bleiben in ihrer Raum- und Tragstruktur soweit wie möglich erhalten. Das Volumen wird kompakter. Der Komplex erreicht nach dem Umbau, trotz Anschluss an ein energetisch nicht optimales, mit Öl betriebenes Fernheizungsnetz, den Minergiestandard. Eine konventionelle Lüftungsanlage konnte wegen der begrenzten Geschosshöhen nicht eingebaut werden. Gelüftet wird das Haus mit Überströmöffnungen über den Fenstern der Individualzimmer und zentralen Abluftkanälen. Wärmepumpen nutzen die Energie der Abluft zur Warmwassererzeugung und Heizungsunterstützung. Die Vor- und Nachteile der Strategie, einen Teil des Bestandes zu erhalten und zu ergänzen, konnten bis jetzt noch nicht bilanziert werden, da die Betriebszahlen noch fehlen. Mit dem Erhalt des Rohbaus, der etwa die Hälfte der grauen Energie eines Gebäudes ausmacht, wurden erheblich Material und Energie gespart. Ökonomisch haben jedoch bautechnische Schwierigkeiten die Kostenvorteile gegenüber einem Neubau weitgehend aufgefressen. Es bleibt die Hoffnung, dass die Gebäude durch die sorgfältige und aufwendige Instandsetzung ein zweites Leben bekommen haben, das sie für eine längere Zukunft tauglich macht.
KraftWerk4: Relokalisierung in der Agglomeration
Auf dem Areal der ehemaligen Textilfabrik Zwicky in Dübendorf entwickelt die Bau- und Wohngenossenschaft KraftWerk1 zusammen mit der Generalunternehmung Senn BPM und der Immobilienberatungsfirma Wüest&Partner ein Baufeld. Es ist vorgesehen, dass die Genossenschaft ungefähr die Hälfte des Bauvolumens übernimmt (etwa 150 Wohnungen und Gewerbeflächen). Die schwierige Lage, insbesondere die Lärmsituation, bestimmt das architektonische Konzept von KraftWerk4.[1] Das aus einem Wettbewerb hervorgegangene Projekt von Schneider Studer Primas Architekten nutzt die Rahmenbedingungen und entwickelt einen Baukasten aus Typologien, der unterschiedlichste Nutzungen und räumliche Qualitäten zulässt: Dünne Scheiben schirmen das Areal gegen den Lärm ab, zwei dicke Blöcke besetzen den Hofraum, Hallen schaffen im Erdgeschoss gassenähnliche Räume und auf ihren Dächern geschützte Gärten im dicht bebauten Areal. Es entsteht die Stimmung eines lebendigen Gewerbequartiers. Berechnungen im Vorprojekt zeigen, dass die massiven Volumen im Innern des Areals die dünnen Baukörper am Rand sowohl ökonomisch als auch energetisch kompensieren können. Eine Bilanz der grauen Energie für die Erstellung weist noch eine leichte Überschreitung der 2000-Watt-Zielwerte gemäss SIA-Merkblatt 2040 von einigen Prozent auf. Der energetische Standard wird auf Minergie-P-Niveau liegen. Die Nutzung von Wärme aus dem geklärten Abwasser der Kläranlage Neugut als Anergiequelle ermöglicht hocheffiziente Wärmepumpen und reduziert die thermische Belastung der Glatt. Zurzeit prüft die Genossenschaft Möglichkeiten der Energieproduktion auf dem Areal (Neunutzung der Wasserkraft der Glatt, Fotovoltaik auf Dächern und Fassaden). Im besten Fall könnte das Projekt seine gesamten Betriebsverbräuche selber erzeugen.
Für die Nachhaltigkeit mindestens so wichtig ist aber das Potenzial, auf dem Zwicky-Areal ein Gegenbild zur funktional getrennten Agglomeration zu schaffen, die in der Nachkriegszeit im Glatttal entstanden ist. Die Identität des vorhandenen Industrieensembles, das bereits mit verschiedenen Nutzungen neu belebt worden ist, ermöglicht eine Ergänzung und Stärkung mit einem dichten, vielfältigen Angebot an Wohn- und Arbeitsflächen. Wenn es gelingt, ein feines Netz aus Wohnen und Arbeiten zu knüpfen, und wenn die günstigen Gewerbeflächen Betriebe aus kreativen Branchen anziehen, die in der Innenstadt zurzeit erheblich unter Druck stehen, sind hier Prozesse einer produktiven Relokalisierung möglich. Dies ist eine Voraussetzung dafür, die fragmentierte Agglomeration in nachhaltige, lebenswerte Räume zu überführen und die ausufernde Mobilität in den Griff zu bekommen.
Die Erfahrungen in der Gründersiedlung und die Herausforderungen der neuen KraftWerk-Projekte zeigen exemplarisch den Beitrag auf, den wir mit der gebauten Umwelt für eine zukunftsfähige Gesellschaft leisten müssen: Niedrigenergiekonzepte müssen richtig betrieben, optimiert und den Benutzenden verständlich kommuniziert werden, es braucht einen kreativen Umgang mit dem Bestand, und die alltäglichen Funktionen müssen im grösseren Massstab zu nachhaltigen Quartieren rekombiniert werden.[2]
Anmerkungen:
[01] Das Projekt KraftWerk3 wurde 2011 aufgegeben
[02] KraftWerk1 beteiligt sich mit dem Projekt auf dem Zwicky-Areal am Pilotprojekt «Arealentwicklung für die 2000-Watt-Gesellschaft» des Bundesamts für Energie und der Stadt Zürich.TEC21, Fr., 2012.02.10
10. Februar 2012 Andreas Hofer