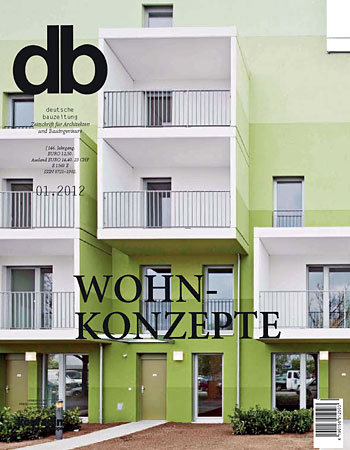Editorial
Im Geschosswohnungsbau gewinnen Aspekte wie Flexibilität und Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung. Die Bandbreite an Lebensentwürfen nimmt stetig zu, Bedürfnisse ändern sich rasch, klassische Familienverbände lösen sich auf, die Menschen werden immer älter und dabei auch immer bedürftiger. Gleichzeitig steigen die Ansprüche an Ausstattung und Raumangebot. Der Wohnungsbestand ist dafür allerdings überhaupt nicht gerüstet. Die mehr und mehr ins Blickfeld geratende Barrierefreiheit lässt sich planerisch leicht und inzwischen auch nahezu kostenneutral, notfalls nachträglich, herstellen.
Wohnungen hingegen, deren innere Struktur sich mit wenigen Handgriffen tatsächlich komplett wandeln lässt, gibt es aber so gut wie nicht; dem steht meist die nötige Massivität von Gebäuden und Bauteilen im Wege. Darum gilt es, v. a. im großen Maßstab neue Gebäudetypologien und Grundrisskonzepte zu entwickeln, die flexibel sind und sich der Vielfalt des Wohnens anpassen lassen. Das Einfamilienhaus im Grünen ist ein Auslaufmodell. Großzügige Einheiten im Verbund mit anderen sind im Kommen – mit größtmöglicher Privatheit nach innen, aber auch kommunikativen Bezügen nach außen. Diese Themen und Anforderungen sind alle nicht neu, bereits für die Weltausstellung in Montreal hat Moshe Safdie 1967 mit seinem »Habitat 67« (s. Bild links) kostengünstige Lösungen mit hoher Wohndichte und 15 verschiedenen Wohnungstypen entwickelt.
Damals ging das wirtschaftliche Konzept aus verschiedenen Gründen nicht auf. Heute jedoch wissen auch viele Bauträger, dass sie Nachhaltigkeit nicht erreichen, indem sie Gewohntes immer wieder erneut aus der Schublade ziehen. Einige bedenkenswerte Ideen und wegweisende – wenn auch nicht immer konsequent bis ganz zu Ende geführte – Vorschläge finden Sie auf den folgenden Seiten. | Achim Geissinger
Entdecke die Möglichkeiten
(SUBTITLE) 23 Wohneinheiten in Trignac (F)
Der enge Kostenrahmen im Sozialen Wohnungsbau bringt in aller Regel kleine Wohneinheiten mit engen Grundrissen hervor. Rein rechnerisch bedeutet deshalb eine verbilligte Bauweise ein Mehr an Raum, mit Möglichkeiten zum Abstandhalten und zur Vereinzelung. Mit einem simplen Stahlbetonskelett und Gewächshauselementen traten die Architekten den Beweis an, dass sich Raumkomfort auch mit kostengünstigen Mitteln herstellen lässt und dass sich vom Menschen her gedachte Architektur spürbar positiv auswirken kann.
Mit dem Modell »Loft« als Sinnbild für eine postindustrielle Revolution im Wohnungswesen im Hinterkopf, lässt das Sozialwohnungsbau-Projekt in Trignac den vorherrschenden, angesichts der starken Reglementierung immer ärmlicher daherkommenden Wohnungsbau ziemlich alt aussehen.
Die Architekten Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal brachten Wohnflächen mit offenen Grundrissen auf den Markt, die viel größer, energetisch weniger kostspielig und auch für den Mieter erschwinglich sind, durchaus aber in der Herstellung mit Standardbauten preislich mithalten können.
Schützenhilfe bot der öffentliche Bauträger Silène, der 2004 während eines Wettbewerbs auf die alternative Vorgehensweise des Büros aufmerksam geworden war. Den Wettbewerb haben sie zwar nicht gewonnen, die Zusammenarbeit begann aber schon wenige Jahre später mit drei Bauvorhaben in Saint-Nazaire. Eines davon sind die 23 Sozialwohnungen in Trignac im Stadterneuerungsgebiet von Granchamps, wo Schrotthaufen, das für Haupteinfallstraßen typische Gewerbe, kleinere Wohnbauten und Einfamilienhäuser aufeinandertreffen. Der unselige Kontext dieses in der Entwicklung begriffenen Gebiets veranlasste die Architekten dazu, ein Maximum an Individualisierungsmöglichkeiten anzubieten. Sie überarbeiteten ihr Konzept für die Cité Manifeste in Mulhouse (s. db 8/2005, S. 24) und übernahmen zwar den Maisonette-Typ mit den separaten Wohnungseingängen direkt von außen und den bekrönenden Gewächshäusern, fügten aber Balkone hinzu und griffen auf dauerhaftere Materialien zurück.
Die beiden, durch ein städtisches Technikgebäude voneinander getrennten Häuser verteilen sich auf zwei Grundstücke, deren vier bzw. zwei Parzellen ursprünglich zur Bebauung mit Einfamilienhäusern vorgesehen waren. Die für Fußgänger und Bewohner gleichermaßen unangenehme Umgebung verstärkt die spröde und verwirrende Erscheinung der beiden Gebäude. Ist ihre Physis – zart und durchlässig, aber auch roh, unverblümt, direkt – doch sehr weit entfernt von gängigen Vorstellungswelten und darf als Chiffre für eine neue Art von Wirtschaftlichkeit im Geschosswohnungsbau gelten: 70 m² für eine Zwei-, 100 für eine Drei-, 140 für eine Vier- und 170 m² für eine Fünf-Zimmer-Wohnung; die Mieten bewegen sich zwischen 300 und 550 Euro pro Monat.
Die Voraussetzung für diese Großzügigkeit ist das simple, bei beiden Häusern gleiche Konstruktionsprinzip: Das Traggerüst aus Stahlbetonstützen und -trägern in 3 und 6 m Höhe über dem Boden folgt dem Rastermaß der obenauf sitzenden Gewächshauselemente. Die von Aluminiumpaneelen und raumhohen Schiebefenstern eingefasste Primärstruktur bleibt unabhängig von der Nutzung und lässt eine völlig freie Raumeinteilung zu. Die Gewächshauskonstruktion aus verzinktem Stahl nimmt neben geschützten und geheizten Wohnräumen hinter Aluminiumpaneelen auch die von Polycarbonatwänden abgeschlossenen, mit transparenten Schiebewänden und automatischen Lüftungsflügeln im Dach ausgestatteten Wintergärten auf. Diese zur individuellen Aneignung freigegebenen Räume haben als Pufferzonen den Nutzen, über natürliche Lüftung die sommerliche Hitze über das Dach abzuführen und im Winter Wärme zu generieren und zu halten. Es genügt, Türen und Fenster der isolierten Bereiche zu öffnen, um warme Luft hereinzulassen und die Heizung abdrehen zu können. Um sich den konstruktiven Aufwand zu sparen – und angesichts des milden Klimas in Trignac – nahm man die Wärmebrücken der thermisch nicht entkoppelten Balkonplatten in Kauf, zumal sich die solaren Gewinne gegenrechnen lassen.
Der subjektive Anteil des Bewohners
Aus der Enge der beiden Grundstücke sind zwei Wohnungstypen abgeleitet: Das niedrigere Gebäude charakterisiert eine Serie von 13 unterschiedlichen, zumeist sehr tiefen, durchgesteckten Wohnungen (drei Gewächshauslängen, zusammen 19,80 m). Ihnen angegliedert sind jeweils eine Garage und in Verlängerung des Wohnzimmers im EG ein Stück Garten, auf das eine Glasschiebetür mit bodengleicher Schwelle hinausführt. Den Typen mit schmalerem Grundriss im EG und entsprechend kleinerem Gartenanteil ist als Ausgleich im OG ein größerer Wintergarten zugeordnet. Der Dreigeschosser nebenan umfasst zehn Wohnungen, die großteils vertikal über die tief ins Gebäude hineinführenden Waschküchen im EG erschlossen sind und deren Wohnräume, Terrassen und Wintergärten in den oberen Geschossen liegen.
Das Konzept setzt darauf, dass die Großzügigkeit räumliche und nutzerische Freiheit fördert. Es ist nicht nur wirtschaftlich gedacht, indem es sparsam mit Konstruktion und Material umgeht, indem es viel Fläche zu geringen Kosten bereitstellt, indem es mit einer leichten, industriellen Bedachung verschiedene Klimazonen ermöglicht, sondern auch, indem es die Bewohner dazu ermuntert, sich mit dem leicht anzupassenden System auseinanderzusetzen und es sich anzueignen, dadurch die eigene Subjektivität zu erfahren und es als Erweiterung der eigenen Person, als etwas Eigenes zu begreifen. Das Instrumentarium dafür ist denkbar simpel: Sichtbetondecken, Böden aus geöltem Beton, nirgends Leuchten, dafür aber reichlich mit Zwischenschaltern versehene Steckdosen, mehrere Wasseranschlüsse, minimale Abschottung nach außen, keinerlei Fensterläden, Trennwände aus Beton oder Gipskarton, Schiebetüren, Vorhänge als mobile Wärmedämmung. Der Bewohner ist vollwertig in die Raumbewirtschaftung miteinbezogen. Es ist an ihm, visuelle Tiefe und Flexibilität zu organisieren – die er sich gönnen kann oder auch nicht –, indem er Trennwände einfügt oder die Räume offen lässt, sich akustisch abschottet oder ungehinderte Schallausbreitung hinnimmt, sich auf eigene Art in den ungeheizten Wintergärten einrichtet, nach Gutdünken die Sonnenenergie einfängt und hinter zugezogenen Vorhängen für die Nacht konserviert.
Jeder Bewohner ein Forscher – das ist eine ehrgeizige und auf lange Sicht hin ausgelegte Herangehensweise, denn sie verlangt einen radikalen Wandel der Haltung, die gemeinhin dem Wohnen entgegengebracht wird. Es gilt, sich von den Gewohnheiten des traditionellen Wohnens, mit seinen gleichartigen, von der Außenwelt abgeschnittenen Einzelräumen, freizumachen, genauso wie von der uns selbstverständlich erscheinenden Definition von Komfort. Die 23 Wohnungen in Trignac setzen auf eine Kultur des Kontrasts und des Austauschs mit der Umgebung als Motor einer neuen inneren Dynamik. Was sich in der Außenwelt tut, kann nach innen dringen: das Prasseln des Regens auf dem Aluminiumdach, ein Windhauch im Wintergarten, Sonnenwärme hinter den Scheiben. Das Innenraumklima folgt eben nicht beständig der Laune des Bewohners, sondern macht die Jahres- und Tageszeiten erlebbar. Die Architektur von Lacaton & Vassal bildet den Rahmen für die Überlagerung des menschlichen Verhaltens mit den Naturerscheinungen und der gebauten Umgebung, sie offeriert beherzt Anreize und Voraussetzungen dafür, dass »etwas« entstehen kann. Und es entsteht tatsächlich etwas: Alle Bewohner sind überaus froh, einfach nur viel Platz zu haben. Sie sind in vollem Bewusstsein ihrer Freiheiten und entwickeln auch tatsächlich einige Fantasie. Von einer der Familien waren derart hymnische Äußerungen zu vernehmen, dass sie in einem Fachartikel nichts anderes als übertrieben wirken würden. In Gesprächen wird immer wieder betont, wie fundamental wichtig es angesichts der schaurigen städtebaulichen Situation ist – so abgeschnitten von jeglichem städtischen Leben –, viel Raum und Fläche zur Verfügung zu haben. Denn für die Kinder ändert das alles, auch für die Haustiere, für das Zusammenleben als Paar oder alleinerziehende Mutter. Es ist extrem viel wert, den Raum zu haben, einmal in Frieden eine Zigarette rauchen zu können, ohne jemanden zu stören. Die meisten Bewohner waren sofort begeistert und akzeptierten gewisse Abstriche. So kommen auf die Mieter nun doch um etwa 10 % höhere Heizkosten zu – bei doppelter Wohnfläche, wohlgemerkt.
Jenes Mehr, das gebraucht wird, um tun und lassen zu können, was man will, liegt glücklicherweise jenseits nachbarschaftlicher Begehrlichkeiten und regelt zudem die Fragen des Zusammenlebens in einem beengten Quartier. Die Bewohner genießen es, von ihren Freunden zu ihrer Wohnung beglückwünscht zu werden. Es fällt ihnen viel leichter, Gäste zu sich einzuladen. Durch die neuen Möglichkeiten bereichert sich ihr Leben wesentlich, die Veränderung bringt ihnen enormen Auftrieb. Das liegt an der mitreißenden und feinsinnigen Arbeit von Lacaton & Vassal. Man muss nach Trignac fahren und mit eigenen Augen sehen, wie die neue Umgebung das Leben und das Denken der Menschen verändert. Sicher gibt es einige, die damit nicht so viel anfangen können, die z. B. der rohe Beton abschreckt. Aber sie alle sind einfach glücklich, eine richtig große Wohnung zu haben.db, Di., 2012.01.17
17. Januar 2012 Karine Dana
Mitgedacht
(SUBTITLE) Wohnbebauung »Blok 128« in Amsterdam-IJburg (NL)
Auf dem Steigereiland, einer Insel des neuen Archipel-Stadtteils IJburg in Amsterdam, steht ein auffällig weißer Wohnblock an der Hauptstraße. Hinter seiner kühlen Fliesenfassade verbirgt sich eine typisch niederländische Verbindung von sozialen Ansprüchen und kommerziellen Interessen; bei der Gestaltung der 71 sozialen Mietwohnungen durften die Bewohner mitreden.
Die Niederlande waren stets als Land des seriellen Wohnungsbaus bekannt. Groß angelegte staatliche Wohnungsbauprogramme, ein standardisierter Bauprozess und die nahezu ausschließliche Vergabe von Bauland an Wohnungsbaugesellschaften und Projektentwickler, nicht aber an private Bauherren, haben die legendären Neubauviertel auf den Poldern hervorgebracht, in denen jedes Reihenhaus dem anderen gleicht. Lange waren die Niederländer damit zufrieden und protestierten weder gegen ewig gleiche Wohnungstypen noch gegen fehlenden Wiedererkennungswert. Erst im letzten Jahrzehnt ist der Wunsch nach mehr Individualität im Wohnungsbau laut geworden. Den Auftakt bildete die »Scheepstimmermanstraat« im östlichen Hafengebiet von Amsterdam, wo Privatleute Ende der 90er Jahre erstmals Baugrund erwerben und ein Reihenhaus nach Wunsch errichten konnten. Das Beispiel hat Schule gemacht, und v. a. im höheren Preissegment gibt es nun immer mehr private Bauherren und Baugruppen. Im Bereich der sozialen Mietwohnungen ist man gerade dabei, Erfahrungen mit Bewohnerpartizipation sammeln.
Trend zur Individualisierung
Auf dem Steigereiland, der westlichsten Insel des künstlichen Archipels IJburg, finden sich zahlreiche Beispiele für den Trend zur Individualisierung. Als städtebauliches Experimentierfeld ausgewiesen, ist die Insel durchsetzt mit individuellen Reihenhäusern, frei stehenden und sogar schwimmenden Wohnhäusern (s. db 10/2010, S. 18-25) privater Bauherren sowie Baugruppenprojekten aller Größenordnungen. Vor diesem Hintergrund scheint es wenig verwunderlich, dass auch der bislang einzige soziale Wohnblock auf dem Steigereiland auf einem Individualisierungsexperiment basiert. Block 128 beherbergt 71 soziale Mietwohnungen, die aus einem Partizipationsprozess hervorgegangen sind.
Er ist der südlichste von drei U-förmigen Wohnblöcken an der Haupterschließungsachse von IJburg und umarmt, wie seine Nachbarbauten, einen, allerdings nur zweiseitig umschlossenen Innenhof, in dem einige Wohnhäuser privater Bauherren stehen. Im Osten grenzt er an die Hauptstraße, im Norden an den vorgelagerten Pausenhof einer Grundschule und im Süden an das Ufer des IJmeers. Dort befindet sich nur ein seltsam kurzer Seitenflügel, der wie amputiert wirkt, denn auf der anschließenden Brache sollten ursprünglich als Teil des Projekts zehn Eigentumsreihenhäuser am Wasser entstehen, die jedoch vorerst einmal der Wirtschaftskrise zum Opfer gefallen sind.
Das Bild des Gebäudes wird von seiner ungewöhnlich hellen Fassade und den Balkonen mit hellgrünen Milchglasbrüstungen bestimmt. Aus der Nähe wird deutlich, dass die Fassaden mit glasierten Keramikfliesen in gebrochenem Weiß und mit hellgrauen Sprenkeln bekleidet sind. Alle quadratischen Fenster sind feststehend und haben weiße Fensterrahmen, während die öffenbaren Fenster an dunkelbraunen Rahmen zu erkennen sind. Für etwas Variation sorgen außerdem die Laubengänge auf der Hofseite des nördlichen Gebäuderiegels, wie zufällig verteilte Erker und zwei unterschiedliche Balkonformate. Exponiertheit sind die Niederländer gewohnt – ob ihre ausländischen Mitbewohner allerdings die in dichtem Abstand vor die Fassade gehängten Balkone zum Aufenthalt nutzen werden, wird sich angesichts einer doch recht steifen Brise erst noch zeigen müssen.
Eine Kuriosität findet sich auf der Nordostecke des Blocks: Dort sind große dreieckige Balkone aus dem Gebäudevolumen ausgeschnitten, weil neben dem Bau eine Hochspannungsleitung verläuft, unter der in einem 100 m breiten Sicherheitsstreifen kein Wohnraum, wohl aber Außenraum liegen darf.
Partizipation und Stadterneuerung
Insgesamt macht der Block aufgrund seiner Materialisierung einen recht kühlen Eindruck, und von den unvermeidlichen Parkplätzen im Hof wird einem auch nicht gerade warm ums Herz. Doch dafür ist er klar strukturiert und wirkt im Innern dank der großen Fenster, von denen einige auch die Treppenhäuser mit reichlich Licht versorgen, erstaunlich hell und großzügig. Die Bewohner sind ohnehin glücklich über ihre neuen Wohnungen, denn sie sind größtenteils aus schlecht gedämmten, hellhörigen, heruntergekommenen Nachkriegsbauten in einem Stadterneuerungsgebiet hier herübergezogen.
Hier ist auch der Grund dafür zu suchen, dass Partizipationsmodelle im Sozialen Wohnungsbau in den Niederlanden derzeit immer häufiger von sich reden machen. Im Südosten und im Westen Amsterdams sind große Stadterneuerungsprojekte im Gange, in deren Rahmen Nachkriegsbauten mit sozialen Mietwohnungen generalsaniert oder abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden, um mehr Variation ins Wohnungsangebot zu bringen und finanzkräftigere Bewohner in die Problemviertel zu locken. Wohin aber soll man die bisherigen Mieter umsiedeln, und wie bewegt man sie überhaupt zum Auszug? Im konkreten Fall handelte es sich um einen Komplex mit 312 Sozialwohnungen aus den 50er Jahren im Stadtteil Geuzenveld, die generalsaniert und z. T. zusammengelegt werden sollen. Nach der Renovierung wird die Hälfte der Einheiten als Eigentumswohnungen auf den Markt gebracht, und nur ein Drittel wird noch als Sozialwohnung vermietet. Folglich mussten möglichst viele bisherige Mieter weg. Als Anreiz bot man ihnen die Möglichkeit, den Entwurf ihres neuen Wohnblocks und ihrer Wohnungen zu beeinflussen.
Waschküche statt Whirlpool
Das Einbeziehen der Mieter begann bereits beim Auswahlverfahren. 15 Mieter bildeten eine Kommission, die zwischen zwei Architekturbüros wählen durfte und sich für DP6 aus Delft entschied. Zwar hatte DP6 dank eines früheren Projekts mit Wohnungen für türkische Senioren in Haarlem bereits Erfahrung mit Bewohnerpartizipation, da aber ein Großteil der Kommisionsmitglieder einen Einwanderungshintergrund hat, zog man vorsichtshalber ein Büro für interkulturelles Management hinzu, das Hilfestellung bei Kommunikationsproblemen bieten sollte. Danach wurde die Mieterkommission auf 34 Parteien erweitert, und es folgte ein erster Workshop, bei dem eruiert wurde, welche Mängel die alten Wohnungen aus Sicht der Bewohner hatten und was sie sich von ihrer neuen Wohnung wünschten. Zum Erstaunen der Architekten forderten die Mieter keine Whirlpools oder Dachterrassen, sondern äußerten realistische Wünsche, wie etwa einen separaten Raum für die Waschmaschine.
Auffällig war, dass Niederländer gerne eine offene und Ausländer lieber eine geschlossene Küche haben wollten. Die Fassade wünschte man sich hell und mit viel Glas, und im Hof wollte die Kommission lieber einen Garten mit Grillstelle als einen Spielplatz haben.
Auf Basis dieser Wünsche entwickelten die Architekten 45 Wohnungstypen. Die vorgegebenen Wohnungsgrößen von 70, 80 und 100 m² koppelten sie jeweils an ein Achsmaß und legten die Position der Leitungsschächte fest, damit die anschließende Stapelung im Block – dessen Gestalt im Masterplan festgelegt war – möglich wurde. Letztlich hatten die Bewohner Einfluss auf die Fassadengestaltung, die Einteilung ihrer Wohnungen und auf die Größe des Außenraums. Beim Abstellraum konnten sie entscheiden, ob er (wie in den Niederlanden üblich) komplett in der Wohnung oder zur Hälfte im EG des Blocks liegen sollte. Es gab jedoch auch Bewohnerwünsche, die nicht umgesetzt werden konnten, da die Wohnungen sonst nicht mehr den baurechtlichen Bestimmungen entsprochen hätten: Innerhalb der minimal dimensionierten Sozialwohnungen ist es z. B. kaum möglich, mit Zimmergrößen zu spielen.
Nach dem Vorentwurf durfte jede beteiligte Partei sich einen Wohnungstyp aussuchen und seine Lage im Gebäude bestimmen. Laut den Architekten ging das reibungslos über die Bühne; bei Streitigkeiten hätte der am längsten in Amsterdam gemeldete Bewohner die erste Wahl gehabt. Auch den Landschaftsarchitekten für die Gestaltung des Innenhofs durfte der Bewohnerausschuss zu guter Letzt noch auswählen.
Mehrere Fliegen mit einer Klappe
Dass solch ein Prozess das Gebäude deutlich teurer macht als einen gewöhnlichen Sozialen Wohnungsbau, versteht sich von selbst. Aber im Idealfall schlägt der Auftraggeber damit dennoch mehrere Fliegen mit einer Klappe: Denn einerseits verlassen die Mieter bereitwilliger ihre alten Wohnungen und andererseits entwickeln sie mehr Verantwortungsbewusstsein für ihre neue Wohnumgebung und gehen pfleglicher damit um. Dazu gehört auch, dass durch den Partizipationsprozess im Vorhinein ein Gemeinschaftsgefühl aufkommen kann, das bei anderen Neubauprojekten oft Jahre auf sich warten lässt. Auf lange Sicht ist sicher auch von Vorteil, dass durch die Partizipation eine große Bandbreite an unterschiedlichen Wohnungstypen entsteht, denn gerade in den Stadterneuerungsgebieten von Amsterdam-West ist der monotone Wohnungsvorrat eine Ursache für soziale Probleme.
Ganz zufrieden ist die Wohnungsbaugesellschaft in diesem Fall aber dennoch nicht, da nur 34 von 312 Parteien am Prozess teilhaben wollten. Der Rest ließ sich nicht dazu bewegen, von Amsterdam-West auf das Neuland am anderen Ende der Stadt umzusiedeln.db, Di., 2012.01.17
17. Januar 2012 Anneke Bokern
Setzkasten im Praxistest
(SUBTITLE) Wohnungsbau »Tila« in Helsinki (SF)
Das Gebäude bildete zunächst nur den groben Rahmen, die Einteilung der Wohnungen und den Ausbau der zweigeschossigen Einheiten gestalteten die jeweiligen Eigentümer selbst. Für die großen Wohnungsbaugesellschaften eignet sich das Modell sicher nicht, die Zufriedenheit der Bewohner ist trotz aller Mühen jedoch enorm und weist den Weg für weitere Projekte selbstbestimmten Bauens in großen Einheiten.
Das nach finnischen Maßstäben singuläre »Etagenwohnhaus Tila« (tila bedeutet Raum) wirkt auf den ersten Blick nicht besonders einzigartig. Das Gebäude fällt nämlich nicht durch spektakuläre Formen auf, sondern fügt sich harmonisch in die neue Wohnsiedlung Arabianranta (s. db 11/2007, S. 16) ein. Es ist aus denselben Materialien gebaut wie die Nachbarhäuser – roter Ziegel, Beton und Stahl. Größenmäßig entspricht es den Vorschriften des Bebauungsplans und bautechnisch den üblichen Standards. Ganz wie im normalen finnischen Geschosswohnungsbau bilden die Zwischenwände die tragende Struktur und bestehen die Zwischendecken aus Betonelementen bzw. Hohlkörperdecken. Gemäß den strengen finnischen Normen ist die Gebäudehülle stark gedämmt und jede Wohnung mit einer mechanischen Lüftung versehen, die Heizenergie wird dem örtlichen Wärmenetz entnommen.
Die Gebäudegestalt bietet zunächst nichts Besonderes, doch die Proportionen der Fassade sind ungewöhnlich. Sie ist in Felder von der Höhe zweier Geschosse unterteilt und zeugt von den Innenraumlösungen, die das Haus interessant machen. Seinen architektonischen Kern bildet ein 5 m hoher, sich über die gesamte Baukörpertiefe erstreckender Wohnraum mit einer Grundfläche von 102 m² oder mit zwei Raummodulen zu je 50 m². Sie verteilen sich auf vier Regelgeschosse. Das EG hat eine normale Höhe und nimmt als Arbeitszimmer nutzbare Räume auf, die direkt von außen und auch über interne Treppen vom ersten Stock aus erreichbar sind. Das DG verfügt anstelle von Balkonen über Terrassen.
Leitgedanke der architektonischen Gestaltung war diese Raumidee, aus der sich die funktionalen und architektonischen Lösungen direkt ergeben. Es ist deutlich zu sehen, dass mit dem Konzept keine außergewöhnlichen oder dramatischen Formen oder »Wow-Effekte« angestrebt wurden. Vielmehr gelang es, mit minimalistischen Mitteln einen offenen Rahmen für vielgestaltiges Wohnen zu schaffen. Dieser »Rahmen-Ansatz« zeigt sich auch an der zurückhaltenden und unauffälligen Gestaltung der Details, die sich neutral in die Gesamtheit einpassen. Formen und Materialien erscheinen recht rau und simpel. Die verwendeten Baustoffe (roter Ziegel für die Fassade, graue Betonflächen sowie feuerverzinkter und lackierter Stahl) schaffen ein sachliches, strenges und zugleich harmonisches Gesamtbild.
Das Gebäude hat zwei Gesichter. Die schützend geschlossene Eingangsseite mit ihren Laubengängen zeigt mit ihrer Großzügigkeit Anklänge an Industriearchitektur. Die Balkonseite dagegen öffnet sich maximal hin zu Hof und Licht, die kleinteilige Fensterteilung signalisiert traditionelle Wohnkultur.
Den Gebäudekern bilden 5 m hohe, leere Räume, die gerade eben so den gesetzlichen Mindestanforderungen an eine Wohnung entsprechen. Ein Punkt, über den die Bauaufsichtsbehörde glücklicherweise mit sich verhandeln ließ. Anders als im herkömmlichen finnischen Wohnungsbau gibt es bauseitig keine Kücheneinrichtung, sondern nur die nötigen Anschlüsse, und – abgesehen vom Badezimmer neben dem Eingang – auch keinerlei Raumaufteilung. Dem Gebäudekonzept gemäß erwirbt der Bewohner einen »leeren Rohraum«, den er individuell ausgestalten kann. Der Rohraum ist im Anschaffungspreis billiger als eine herkömmliche Wohnung.
In sämtlichen Wohnungen fand eine »nutzerorientierte Eigenplanung« statt. D. h., nach Fertigstellung der Gebäudestruktur und Übergabe an die einzelnen Eigentümer zogen sich Bauträger, Baufirma und im Prinzip auch die Architektin komplett zurück, denn alle Eigentümer wollten ihren Rohraum selbst nach den eigenen Vorstellungen ausbauen. Einige beauftragten Architekten, andere entwarfen selbst und beteiligten sich auch aktiv an der Umsetzung. Für alle Einzelpläne waren baubehördliche Genehmigungen einzuholen. Dabei bot Pia Ilonen aber ihr Hilfe an und versorgte dazu alle Beteiligten mit einer detaillierten Informationsbroschüre mit Richtlinien und gesetzlichen Anforderungen.
In den entstandenen Raumlösungen zeigen sich individuelle Auswahlentscheidungen und Gewichtungen, v. a. Materialien und Raumaufteilungen sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Allen Lösungen ist eine gewisse Reduziertheit gemein, die Außenstehende auch als etwas typisch Finnisches ansehen könnten. Gemeinsame Merkmale sind die Galerien in variierender Größe und Wohnbereiche mit großer Raumhöhe. Der Unterschied zu normalen Etagenwohnungen und Standardlösungen ist groß, v. a. der enormen Raumhöhe wegen. Die Individualität ist unübersehbar. Die lichte Balkonwand mit ihrer raumhohen Verglasung schafft in allen Wohnungen eine ähnliche, wiedererkennbare Atmosphäre.
Die Bewohner betonen, dass für sie natürlich das Ziel, zu einer Wunschwohnung zu kommen, im Vordergrund stand, mindestens als ebenso wichtig empfinden sie aber auch den Verwirklichungsprozess auf dem Weg dahin. Durch Nachbarschaftshilfe, gemeinsame Materialbeschaffung, gegenseitige Arbeitseinsätze und Erfahrungsaustausch lernte man einander bereits vor dem Einzug kennen. Diese Erfahrung der Gemeinschaftlichkeit wissen die Bewohner zu schätzen.
Zögerliche Bauwirtschaft
Die Verwirklichung des Vorhabens basierte nicht, wie sonst üblich, auf der Initiative eines etablierten Akteurs der Baubranche, sondern geht auf Aktivitäten einer Einzelperson zurück. Die am offenen Wohnungsbau interessierte Architektin Pia Ilonen hatte an einer Exkursion nach Holland teilgenommen. Sie berichtet, wie sie die künftigen Bewohner an einem Reihenhausobjekt mitbauen sah. Spontan fragte sie die mitgereisten Beamten der Baubehörde, ob man in Helsinki nicht etwas Ähnliches ausprobieren könne? Man antwortete ihr, sie könne so etwas doch auf den Weg bringen. Ilonen strengte daraufhin erste Sondierungen bei Baufirmen an. Ihr Rohraum-Konzept stieß jedoch auf Ablehnung: »Zu vage. Kauft eh keiner. Gesetze und Vorschriften stehen dagegen.« Eine zweite Sondierungsrunde bei Baubehörde und Stadtplanungsamt in Helsinki brachte Grünes Licht für das Vorhaben und man wies auch gleich ein Grundstück zu. Schließlich fand sich auch ein Investor. Interessenten für die Wohnungen zu finden war leicht, es meldeten sich Tausende. Das Vorhaben stand zunächst unter einem glücklichen Stern. Während der Bauphase aber änderte sich die Konstellation, denn auf der Baustelle kam es zu elementaren Fehlern. Das Bauunternehmen erwies sich als inkompetent. Das fertige Haus musste teilweise abgerissen und neu errichtet werden, ehe die Bewohner in den Rohräumen ihre eigenen Pläne verwirklichen konnten.
Nischenprodukt
In Finnland basiert der Wohnungsbau eigentlich noch auf dem seit den 50er Jahren gängigen modernistischen Begriff von der Kernfamilie und deren Wohnbedürfnissen. In der heutigen postindustriellen Wohlstandsgesellschaft hat sich jedoch ein breites Spektrum verschiedener Lebensweisen und Patchwork-Familien entwickelt. Vor dem Hintergrund der modernen pluralistischen Lebensweisen und individualistischen Vorstellungen vom Wohnen erkundet das Etagenwohnhaus Tila neue Wege. Es zeigt, dass die Idee des offenen Bauens ausgezeichnet der Verwirklichung individueller Lebensweisen entgegenkommt.
Aber – wird das Rohraum-Konzept zu einem breiten Neuerungstrend im finnischen Wohnungsbau? Die Idee verlangt von den Bewohnern viel Eigeninitiative und Interesse am Planen und Bauen. Es ist nicht zu erwarten, dass sich die breite Masse als derart aktiv und interessiert erweist. Andererseits träumen in Finnland viele Menschen traditionell vom Eigenheim und möchten sich, soweit sie es können, an der Planung und auch der Errichtung ihres Hauses beteiligen. Insofern kann man das Projekt zumindest als eine urbane Antwort auf den Wunsch nach einem Eigenheim sehen. Im Vergleich etwa zu Holland und Dänemark sind die Raumlösungen im finnischen Wohnungsbau relativ stereotyp. In der Wohnkultur wäre mehr Vielfalt wünschenswert. Konzepte wie das Etagenwohnhaus Tila leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. Ohne Übertreibung kann man es als ein richtungweisendes und bedeutendes Vorhaben bezeichnen, denn es erschließt neue Horizonte der Wohnkultur.db, Di., 2012.01.17
17. Januar 2012 Jorma Mukala