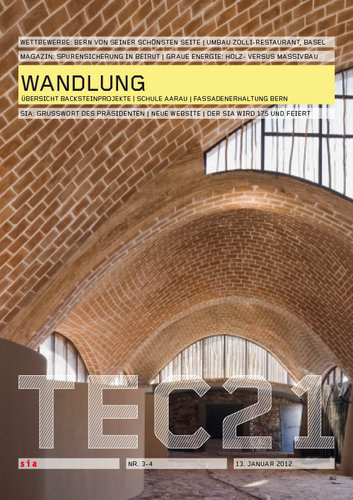Editorial
Mauern haben Schutz- und Tragfunktion. Seit Menschengedenken werden sie aus Holz, Lehm und Stein gebaut. Mit der Industrialisierung sind neue Baumaterialien, vor allem Stahl, Beton und Glas, hinzugekommen, und die Mauern haben sich zu transparenten Hüllen gewandelt. Dennoch ist der Backstein nach wie vor einer der meistverwendeten Baustoffe. Heute verschwinden die Steine jedoch in der Regel hinter Dämmschichten und Putz. Das Material und damit auch seine Qualitäten bleiben im Verborgenen.
Dass etwa hochdämmender Ziegel in Einsteinmauerwerk ohne aussenliegende Dämmung verwendet werden kann und eine Alternative zu den gängigen Kompaktfassaden darstellt, ist nur ein Aspekt. Das Material bietet viel Gestaltungsspielraum: Nicht nur Stahlbeton ermöglicht ungewöhnliche Formen, und transparente Hüllen müssen nicht ausschliesslich aus Glas bestehen. Es ist das Material selbst, seine Farbigkeit und Oberfläche, das es als lebendiges Gestaltungselement neu zu entdecken gilt. Denn nicht nur Glas spiegelt seine Umgebung und ändert damit sein Aussehen, auch eine Backsteinwand kann ihr Gesicht mit den unterschiedlichen Witterungsbedingungen wandeln.
Wir betrachten in dieser TEC21-Ausgabe die unterschiedlichen Ausführungen der Wand und die Vielfalt der Baustoffe. Dazu haben wir zwei Projekte in den Fokus gerückt, die unterschiedlicher nicht sein könnten und sinnbildlich für den Rahmen des Möglichen stehen: Die massiv gestampften Aussenschalen der Erweiterungsbauten der Schulanlage Gönhard in Aarau sind ein Beispiel, dass Ton auch ganz andere Formen der Verarbeitung erlaubt und etwa als Lehmwand unter Zugabe von Trasskalk eine beständige Aussenhaut darstellen kann. Die Instandsetzung der Fassade der Weichenbauhalle auf dem Von-Roll-Areal in Bern erzählt hingegen eine ganz andere Geschichte. Die Arbeit mit dem Bestand geriet zur archäologischen Spurensuche, bei der das alte Mauerwerk fein säuberlich, mit beinahe chirurgischer Präzision, herausgelöst und wiederverwendet wurde. Nur dort, wo die alten Zementsteine nicht ausreichend zur Verfügung standen, wurden sie durch neue, eigens entwickelte ergänzt.
Entscheidend für beide Projekte ist die Neugier, die die Planenden dem Material entgegenbringen. Sie ermöglicht, dass Wandelemente, Steine oder Fliesen eigens für Projekte entwickelt und in Kleinserien produziert werden oder dass alte Techniken wiederbelebt und in eine zeitgemässe Anwendung überführt werden. Diese Wandlungsfähigkeit ist nicht zuletzt das Ergebnis einer Suche, auf die sich ArchitektInnen und IngenieurInnen begeben – oftmals gemeinsam mit den ausführenden Firmen.
Andrea Wiegelmann
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Bern von seiner schönsten Seite | Umbau Zolli-Restaurant, Basel
16 MAGAZIN
Spurensicherung in Beirut | Graue Energie: Holz- versus Massivbau | Das Werk Rudolf Steiners | Neubauten – in Kürze | Naturgefahren im Siedlungsraum
30 GEHT DER BACKSTEIN IN DIE LUFT?
Frank Kaltenbach
Verband ist nicht gleich Verband: Ein Überblick über die Potenziale von Ziegelmauerwerk – vom keramischen Vorhang bis zum tragenden Gewölbe.
35 VARIATION IN TON
Andrea Wiegelmann
Was passiert eigentlich, wenn der Ton nicht zu Stein geformt und gebrannt, sondern in Form von Lehm unter Beimischung von Trasskalk verarbeitet wird? Eine Schulerweiterung in Aarau lotet die Möglichkeiten aus.
40 «MIT DEN SPUREN DES GEBRAUCHS UMGEHEN»
Alexander Felix, Andrea Wiegelmann
Wie man Fassaden zum Sprechen bringen kann, davon erzählt der Umbau der Weichenbauhalle auf dem Von-Roll-Areal in Bern. Die Architekten Christian Hönger und Lorenzo Giuliani und die Projektleiterin Julia Koch berichten im Gespräch mit TEC21 von ihrem beinahe archäologischen Umgang mit dem bestehenden Mauerwerk.
45 SIA
Grusswort des Präsidenten | Mitteilungen aus dem Normenwesen | Neue Website | Ausschreibungen | Der SIA wird 175 und
feiert | Publikationsverzeichnis 2012 | Gesunde Arbeitsbedingungen schaffen
52 MESSE
Informationen zum Angebot der Swissbau 2012 und Standbesprechungen
61 FIRMEN
69 IMPRESSUM
70 VERANSTALTUNGEN
Geht der Backstein in die Luft?
Dass Ziegelmauerwerk sich nicht hinter Wärmedämmverbundfassaden verstecken muss, ist längst bekannt. Wie vielfältig das Potenzial des Baustoffs tatsächlich ist, zeigt ein Überblick. Die vorgestellten Beispiele reichen vom Massivbau über den keramischen Vorhang bis hin zu tragenden Gewölbekonstruktionen. Was darüber hinaus möglich sein könnte, davon geben zwei noch nicht realisierte Projekte einen Eindruck.
Es scheint wie eine Szene in einem Science-Fiction-Film: Vollautomatisch programmierte Minihubschrauber greifen sich ziegelsteingrosse Module und türmen sie wie von Geisterhand zu einer 6 m hohen, röhrenartigen, visionären Megastruktur im Miniaturformat auf (Abb. 1 und 2). Weshalb berührt uns das Bild des an einem «Quadcopter»[1] hängenden Modulsteins so sehr? Es stellt alles auf den Kopf, was wir mit Mauerwerk verbinden: Masse, Tektonik, Tradition, vor allem aber den Massstab. Hat sich nicht vor fast 10 000 Jahren das Normformat der Ziegel aus der Grösse der menschlichen Hand entwickelt? Die vollautomatische robotische Fertigung spielt in der Praxis heute noch keine Rolle. Welchen Gestaltungsspielraum Sichtmauerwerk bietet, zeigen dagegen zahlreiche herausragende Beispiele. Die Erfolgsfaktoren liegen dabei, so scheint es, in der konsequenten Entwicklung von Kleinserien und der sorgfältig abgewogenen Mischung aus Handarbeit einerseits und Vorfertigung andererseits – also sowohl in traditionellen Methoden als auch in innovativen Material- und Fertigungstechnologien.
Einfach massiv
Traditionell von Hand versetztes massives Ziegelmauerwerk kann auch heute noch wirtschaftlich realisiert werden, wie das Beispiel der Mittelpunktbibliothek in Berlin-Köpenick zeigt. Voraussetzung dafür ist, dass einerseits keine bautechnisch problematischen Anschlüsse zu bewältigen sind und andererseits die seismologische Einstufung des Grundstücks gering ist. Für die Süd-, Ost- und Westfassade der 2009 fertiggestellten Bibliothek wählten die Berliner Architekten Bruno Fioretti Marques eine massiv gemauerte, 64cm dicke fünfköpfige Aussenwand (vgl. TEC21 18/2009), die damals gültige Energiesparverordnung (EnEV) konnte durch eine stärkere Wärmedämmung der Nordfassade und des Dachs als Ausgleichsmassnahme eingehalten werden; den aktuellen und den künftigen Vorgaben der EnEV entspricht der Aufbau jedoch nicht mehr. Um den Neubau in das historische Backsteinensemble am Alten Markt in Köpenick einzubinden, wählten die Architekten das vor Ort verwendete Reichsformat 250 × 120 × 65 mm. Der unregelmässige, «wilde» Mauerwerksverband verstärkt den archaischen Charakter einer mittelalterlichen «Wissensburg». Nur die an der Fassade sichtbare Ziegellage besteht aus Steinen mit scharfen Kanten. Das innere der Massivwand ist aus kostengünstigeren Ziegeln geringerer Oberflächenqualität gemauert, die zu den Innenräumen hin weiss geschlämmt sind (Abb. 3 und 4).
Scheinbar massiv
Umfasst das architektonische Konzept grossformatige Öffnungen, Auskragungen oder Brückenkonstruktionen, überwiegen die Vorteile einer Stahlbetonkonstruktion mit vorgehängter Ziegelhülle. Doch wie lässt sich diese gestalten, um der Wirkung von massivem Mauerwerk so nahe wie möglich zu kommen? Beim Dominikuszentrum im Norden Münchens fasste der Architekt Andreas Meck Platzbelag, Deckenuntersichten und Fassaden mit Klinkern im Format 200×115×61.5mm zu einer Einheit zusammen (Abb. 5 und 6). Als Bodenbelag ist der Ziegel hochkant gestellt, an den Decken der Durchgänge sind die Steine als 14 mm dünne Riemchen in Betonfertigteile eingelegt und bilden mit durchlaufenden Fugen eine modulare Bekleidung. Die vorgeblendete Fassade ist dagegen im Verband gemauert und vermittelt den Eindruck eines Massivbaus: Vertikale, durchlaufende Dehnfugen treten nur in grossen Abständen auf. In Breite und Oberfläche – das dunkle Silikon ist mit Sand bestreut – gleichen sie den Mörtelfugen. Der «Wittmunder Torfbrandklinker» und die Durchmischung von Ziegeln unterschiedlicher Textur, besonders die hervorstehenden gekrümmten Ziegel oder «Gurken», verleihen dem Neubau den Charme von gealtertem Mauerwerk und geben dem Auge Halt auf den weiten Flächen – dieses Motiv hatte Alvar Aalto bereits 1949 bei seinem Baker House in Cambridge eingesetzt. Im traditionellen Ringbrandofen wird das Torffeuer im Kreis über die Ziegel hinweggeführt, anstatt die Lehmziegel gleichmässig durch den Ofen zu fahren. So werden die obersten Ziegellagen wesentlich höheren Temperaturen ausgesetzt als die unteren. Sie verformen sich unkontrolliert und werden üblicherweise aussortiert.
Wärmedämmendes Hybridmauerwerk
Das Mauerwerk des Kolumba-Museums in Köln von Peter Zumthor ist massiv gemauert, kommt ohne zusätzliche Wärmedämmung aus und trägt dennoch nicht die Geschossdecken, sondern nur sich selbst (vgl. TEC21 48/2007). Das Prinzip der Verzahnung grossformatiger wärmedämmender Hochlochziegel auf der Raumseite mit kleinen Formaten als Aussenhaut ist jedoch keine Neuerfindung: Vitruv kannte solche Hybridmauerwerke als «Eplekton», die Architekten Burkard Meyer hatten sie 1997 beim Schulhaus Brühl in Gebenstorf und 2004 beim Mehrfamilienhaus Martinsbergstrasse in Baden eingesetzt (Abb. 7 und 8). Um den hohen Dämmziegel und den flachen «Kolumbaziegel» im Format von 540×90 bzw. 210×37mm aufeinander abzustimmen und durchlaufende Dehnfugen zu vermeiden, mussten Ziegel und Mörtel als elastisches Gesamtsystem neu entwickelt werden. Das transluzente «Filtermauerwerk» im Bereich des archäologischen Grabungsfeldes besteht dagegen aus einer zweischaligen Membran aus 160mm breiten Kolumbaziegeln. Der unregelmässige, gewebeartige Lichtfilter aus vielen kleinen Öffnungen entsteht durch das Weglassen einzelner Ziegel (Abb. 9–11).
«Pullovermauerwerk» als Fertigteil
Das Wechselspiel aus geschlossenen und perforierten Mauerwerksabschnitten kann auch mit weniger Aufwand realisiert werden. Beim Neubau des Zentrums für Alterspsychiatrie der Klinik St. Pirminsberg in Pfäfers sollte das einheitliche Erscheinungsbild eines klaren Baukörpers dominieren, und funktionale Elemente wie Öffnungsflügel, Loggien, Dachterrassen sollten hinter dem Schleier einer Ziegelmembran verborgen bleiben. Dabei bietet das perforierte Mauerwerk praktische und psychologische Vorteile: Es wirkt als Absturzsicherung vor den Öffnungen, ohne den Eindruck des Eingesperrtseins zu vermitteln. Im Gegensatz zu Kolumba streben huggenbergerfries Architekten aus Zürich eine klare Gliederung der Fassaden an: Die geschosshohen, vorgefertigten Elemente wurden im Werk von Hand aufgemauert und mit vertikalen Bewehrungsstangen in den zylinderförmigen Aussparungen der einzelnen Ziegel gesichert. Sie konnten so auch für den Transport stabilisiert werden. An der Ober- und Unterseite sind sie von Betonfertigteilen eingefasst. Die prismatische Textur entsteht durch die abgeschrägten Vorderseiten der in zwei Formaten eigens für das Projekt entwickelten, hellgelben Ziegel – auf einen längeren Stein folgt jeweils ein kürzerer. Bei den perforierten Feldern wird nur der längere Ziegel eingesetzt, der Platz für den kürzeren bleibt ausgespart. Die Trapezform des Steins ergibt sich aus den Anforderungen. Nach aussen dient er der von Holzschindeln inspirierten Fassadengestaltung. Um die Ziegel beim Aufmauern exakt positionieren zu können, bilden die Innenseiten eine ebene Fläche (Abb. 12 und 13).
Geschwungener Ziegelvorhang
Das kleine Format des Ziegels ermöglicht nicht nur ornamentale Muster und feinmaschige Öffnungen, die – ganz im Sinne Gottfried Sempers – an Gewebe erinnern. Ziegelwände eignen sich auch hervorragend, um gewellten Grundrisslinien zu folgen und sich so selbst auszusteifen. Nur mit der in Grundriss und Ansicht geschwungenen Aussenwand versetzen Königs Architekten aus Köln ihre Kirche in Schillig – an der deutschen Nordseeküste – scheinbar in Bewegung. Der lokale Bockhorner Klinker wurde in einem zweiten Brand unter Sauerstoffentzug «gedämpft», um eine dunklere Farbe anzunehmen. Am schmalen Hochpunkt konnte die scharfkantige Hülle nur als Betonfertigteil mit Klinkerriemchen realisiert werden (Abb. 14).
Membranartige Gewölbe
Mit ein- und zweifach gekrümmten Flächen lassen sich unterschiedliche Arten von Gewölben mauern. Eine in Vergessenheit geratene, jedoch äusserst effiziente Spielart ist das «Guastavino»- oder «Katalanische» Gewölbe: Mehrere Lagen aus flachen Keramikfliesen sind übereinander mit versetzten Fugen vermörtelt und folgen dem Verlauf der Gewölbekrümmung. Gemeinsam mit den Tragwerksplanern John Ochsendorf, Cambridge, Massachusetts, und Michael Ramage, Cambridge, England, arbeitet der südafrikanische Architekt Peter Rich, Johannesburg, an zeitgemässen Anwendungen. Bei seinem Mapungubwe Interpretation Centre im gleichnamigen Nationalpark in Zimbabwe kommen die Vorteile der Bauweise zum Tragen. Durch den minimalen Verbrauch an Ressourcen und den Einsatz einfachster technischer Hilfsmittel realisierte er ein kulturelles, ökologisches und soziales Anschauungsprojekt: Angelernte Arbeitslose der ortsansässigen Landbevölkerung gruben den Lehm vor Ort aus der Erde, pressten ihn zu über 200.000 Platten und mauerten die Gewölbe im Freivorbau unter Zuhilfenahme von einfachsten Gerüsten. Die Ziegeldome korrespondieren zudem formal mit den historischen Steinkreisen der einst dort ansässigen Kultur (Abb. 15 und Titelseite).
Massiv und gleichzeitig transluzent?
Die Übergänge zwischen dem massiven und membranartigen Erscheinungsbild von Ziegelbauten können durchaus fliessend sein. Peter Zumthor realisiert dies bei Kolumba mit einer selbstverständlichen, archaischen Architektursprache. Herzog & de Meuron dagegen versuchen, diese Ambivalenz bei ihrem 64.5 m hohen, pyramidenförmigen Turm des Tate Modern Project in London mit einer spektakulären, irritierend skulpturalen Architektur herzustellen: In abgestuften horizontalen Läuferlagen wird die scharfkantige Geometrie der geneigten Flächen der Gebäudehülle «verpixelt» aufgelöst. Der perforierte Ziegelschleier ist mit Edelstahldübeln vor eine Betonunterkonstruktion gehängt. Er soll das Licht bei Tag filtern und bei Nacht den Baukörper «erglühen» lassen. Die Unterkonstruktion besteht aus Betonfertigteilen, die wiederum vor das Tragwerk in Stahlbeton gehängt sind. Inwieweit es den Architekten gelingen wird, diesen innovativen Erweiterungsbau mit der bestehenden Tate Modern in der ehemaligen Bankside Power Station – einer der monumentalsten Baumassen aus Mauerwerk – zu einer Einheit zu verschmelzen, bleibt abzuwarten (Abb. 16).
Anmerkung:
[01] Als Quadcopter bezeichnet man Luftfahrzeuge, die vier in einer Ebene angeordnete, senkrecht nach unten wirkende Rotoren oder Propeller nutzen. Die Maschinen können senkrecht starten und landen. Vorteil ist, dass alle drei Achsen allein durch Variation der Drehmomente der Rotoren angesteuert werden. Aufwendige Taumelscheiben wie bei einem Hubschrauber sind nicht erforderlich.TEC21, Fr., 2012.01.13
13. Januar 2012 Frank Kaltenbach
Variation in Ton
Dass Ton in seiner ältesten Verwendungsform, gebunden im Baustoff Lehm, auch heute noch genutzt werden kann, belegen die Erweiterungsbauten der Schulanlage Gönhard in Aarau, die 2012 fertiggestellt werden. Boltshauser Architekten aus Zürich haben die äussere Schale der Baukörper als Trasskalkwände realisiert. Die Zugabe von Trasskalkmörtel verbessert die Eigenschaften des Lehms – ein Beispiel dafür, wie der Lehmbau weiterentwickelt wurde. Gleichzeitig spannt die Innengestaltung mit der Verwendung von Keramikfliesen den Bogen zu einer der feinsten Verarbeitungsvarianten von Ton. Die Neubauten zeigen die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten des Materials und sind zugleich Sinnbild für den wandelbaren Charakter der Wand.
Die Schulanlage Gönhard ist das grösste Primarschulhaus der Stadt Aarau. 1952 als Ensemble aus Pavillonbauten von Hans Hauri errichtet, gliedern die Baukörper Pausenhöfe und Grünbereiche und zeugen damit vom Geist ihrer Entstehungszeit. Die Stadt Aarau hatte 2006 infolge einer notwendig gewordenen Instandsetzung der heute denkmalgeschützten Schule sowie der Anpassung an veränderte Bedürfnisse im Schulbetrieb fünf Generalplanerteams beauftragt, Lösungsvorschläge nach einem vorgeschalteten Studienauftrag mit Präqualifikation zu erarbeiten. Das Konzept der siegreichen Zürcher Architekten überzeugte durch die schlüssige Zuordnung der unterschiedlichen Nutzungen, die sensible Positionierung der Neubauten, einen respektvollen Umgang mit den Altbauten sowie durch seine Wirtschaftlichkeit. Dabei wurde das Angebot in den bestehenden Klassentrakten und Lehrerbereichen durch Neuorganisation und die dadurch mögliche Bereitstellung zusätzlicher Räume verbessert. Zudem ergänzen eine neue, unterkellerte Aula, zwei eingeschossige Gruppenräume und zwei Pausenunterstände das Ensemble (Abb. 1). Die Baumassnahmen fanden bei laufendem Betrieb statt. Jeweils ein Klassentrakt wurde umgebaut, während der Unterricht in ein Provisorium auf dem Gelände ausgelagert war. Die Massnahmen erfolgten in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege. Während die neuen Anbauten bereits fertig sind, wird die dritte Sanierungsetappe 2012 abgeschlossen. Sowohl die erneuerten bestehenden Bauten als auch die Erweiterungen erfüllen die Anforderungen des Minergiestandards.
Miteinander von Alt und Neu
Steht man vor der Schule, wird die Qualität der Ergänzungsbauten nachvollziehbar. Die Körper sind präzise platziert und ergänzen das bestehende Ensemble sinnfällig. Das Spiel zwischen Gebäuden und Freiräumen, die Gliederung der Aussenbereiche in eine Folge von Höfen und angrenzenden Grünflächen, wird durch die Neubauten gestärkt. Die Gruppenräume sind gelenkartig über schmale Flurbereiche an die Kopfenden der Klassentrakte angebunden und bilden den Abschluss der Pausenhöfe, während die unterkellerte Aula an der Stelle der ehemaligen, nicht mehr genutzten Hauswartwohnung direkt neben dem Hauptzugang liegt und diesen räumlich fasst (Abb. 2). Sie wird über die bestehende Eingangshalle erschlossen und bildet mit dem Verbindungstrakt und der Sporthalle einen rückwärtigen Hof. Die beiden Pausenunterstände stehen mit Abstand zu den Höfen und markieren die Übergänge zum angrenzenden Strassenraum (Abb. 3).
Die Gliederung der Fassaden ist eine Reaktion auf den Kontext und das Raumprogramm: Die dem Lernen gewidmeten Gruppenräume liegen mit geschlossenem Rücken zum Strassenraum. Sie betonen die konzentrierte Nutzung im Inneren und die Intimität der Höfe, zu denen sie sich mit einem grossen Fenster öffnen. Ausserdem schaffen sie Blickbezüge zu den Klassentrakten. Die Aula dagegen öffnet sich auch an der zur Strasse orientierten Längsseite mit grossformatigen Fenstern und stellt ihr Innenleben aus. Die bewusste Platzierung der Öffnungen ist eine Reaktion auf den baulichen Kontext. Die aus dem rechten Winkel geneigten Wände der Neubauten verweisen auf die Volumen des ehemaligen Singsaals sowie der Windfänge zwischen den Verbindungsbauten.
Trasskalkwände – Ausdruckskraft des rohen Materials
Die Fassaden der Gruppenräume und der Aula sind zweischalig, mit zwischen den Betonschalen liegender Dämmung ausgeführt. Die innere Schale besteht aus Stahlbeton, die äussere Schale aus 22cm starken Trasskalkelementen. In der Oberfläche der gestampften Wände zeichnen sich die schräg angeordneten Latten der Schalungselemente ab (Abb. 6). Die Wände (60–420cm×22cm×275cm) wurden im Werk produziert und jeweils in einem Stück hergestellt. Aufgrund des Gewichtes mussten sie jedoch für den Transport auf die Baustelle in Elemente mit einem maximalen Gewicht von 5.86t geteilt werden. Dazu wurden in die Schalung vertikale Metallbänder eingelegt, die nach dem Ausschalen als «Sollbruchstellen» die Teilung erlaubten. Die einzelnen Elemente wurden vor Ort wieder zusammengesetzt. Die horizontale Schichtung, die das lagenweise Verdichten durch das Stampfen erzeugt, bleibt so erhalten. Die aus der Herstellung bedingte Oberfläche wird damit zum Gestaltungselement. Einerseits unterstreicht das lebendige Material den massiven Eindruck der Wände, andererseits erzeugt seine beinahe stoffliche Wirkung eine Leichtigkeit, die mit den pavillonartigen Fassaden der Klassentrakte harmoniert. Das Nebeneinander von Trasskalkwänden, Putzflächen und hölzernen Brüstungen ist verblüffend selbstverständlich (Abb. 3).
Die Sorgfalt, die einst Hans Hauri in die Ausführung der Fassade legte, prägt auch die Ergänzungsbauten. Die Proportionen sind stimmig, die Details überlegt. So sind Sockel und Attika in Ortbeton ausgeführt und formulieren einen massiven Rahmen für die Trasskalkschalen, der die sich aufdrängende Analogie zu einem Vorhang noch betont. Gleichzeitig schaffen sie präzise Gebäudekanten, die die Plastizität der Volumen herausarbeiten. Auch die zu ihrem Fuss hin konisch zulaufenden Fertigteilstützen, die die Dachkonstruktion der Pausenunterstände und das Eingangsdach mittragen, erhalten allein durch diese Formgebung ihre Präsenz und der unter den Dächern entstehende Raum seinen Abschluss (Abb. 2 und 3).
Veredelter Ton – Aussen roh, Innen fein
Diese gewissenhafte Detaillierung setzt sich im Inneren fort. Die sorgfältige Materialisierung, die sich im Altbau findet, die Korridore mit den Natursteinböden und die holzverkleideten, in Teilen bemalten Decken, das grosse Wandmosaik in der Eingangshalle sowie die Mosaik- und Sgraffitoarbeiten an den Wänden der Flurbereiche zeugen von hoher gestalterischer Qualität (Abb. 8). Die Neubauten spiegeln diesen Anspruch wider. Während die beiden Gruppenräume entsprechend ihrer Nutzung zurückhaltend ausgestattet sind, übersetzt die Aula den Gestaltungsanspruch in eine zeitgemässe Ausführung.
Die Wände sind mit dreidimensionalen, ornamentalen Keramikfliesen verkleidet, die die Wandflächen zwischen den grossen Fensterelementen füllen. Die 25×25cm grossen Fliesen sind eigens für die Aula in Handarbeit angefertigt worden. Sie wurden vor Ort zu grösseren Wandelementen von 75 × 75 cm verklebt, anschliessend vor die Unterkonstruktion geklebt und stellenweise verschraubt (Abb. 4 und 7). Die dahinter durchschimmernden, rot gestrichenen Gipskartonplatten sind zur Verbesserung der Raumakustik entweder absorbierend (gelocht) oder schallhart (glatt) ausgeführt.
Auch im Bodenbelag finden sich Keramikfliesen, sie sind – versehen mit einem Blättermus-ter, das von den Schulkindern in Zusammenarbeit mit der Keramikkünstlerin Marta Rauch entwickelt wurde – im Estrich eingelegt. Das Muster steht aus den Platten hervor, die in vier Feldern im Bodenaufbau eingepasst sind. Die abschliessende Lehm-Kasein-Spachtelung lässt abgeschliffen von den Platten nur das Motiv sichtbar, das sich als dezentes Muster abzeichnet (Abb. 5). Die Lage der Platten gibt zudem Hinweis auf die Tragstruktur der frei spannenden Deckenkonstruktion. Die kreuzförmig diagonal durch den Raum laufenden Unterzüge gliedern den Raum und betonen dessen eigenen, durch die aus dem rechten Winkel gedrehten Wände entstehenden Charakter (Abb. 4 und 5).
Vielfalt des Materials
Gestaltfindung, Materialwahl und räumliche Disposition zeichnen die Ergänzungsbauten der Schulanlage Gönhard aus. Die feinen Keramikarbeiten in der Aula stellen den rauen, geschalten Oberflächen der Trasskalkelemente im Aussenbereich eine weitere Stufe der Materialverarbeitung zur Seite. Die Plastizität der Fassaden – die durch Tageslicht und Witterung bedingten Veränderungen der Oberflächen aussen wie die stoffliche Wirkung der Keramikarbeiten innen – geben dem Begriff «Wand» eine eigene Betonung. Die Elemente zeugen von der intensiven Auseinandersetzung mit den Eigenschaften, der Verarbeitung und den Einsatzmöglichkeiten von Ton. Um das Material so vielfältig anzuwenden, bedarf es der Neugier: Das Ausloten der Möglichkeiten ist dafür ebenso eine Voraussetzung wie die Kenntnis um die Eigenschaften des Baustoffs. Die Erweiterungsbauten in Aarau sind vor diesem Hintergrund auch ein Beispiel für die Kooperation zwischen dem Architekten Roger Boltshauser und dem Lehmbauspezialisten Martin Rauch.TEC21, Fr., 2012.01.13
13. Januar 2012 Andrea Wiegelmann