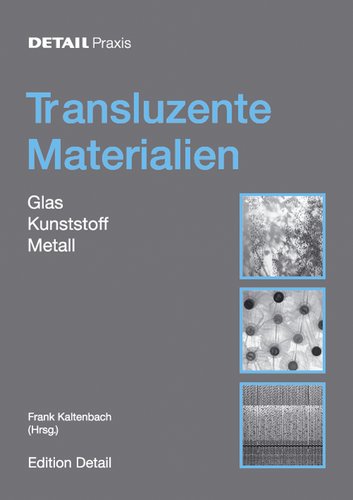Ein Hauch von Titanic
In Helsingör legte das Architekturbüro BIG ein historisches Dock trocken und verwandelte es in eine unterirdische Erlebniswelt. Zu Besuch im Dänischen Schifffahrtsmuseum.
In Helsingör legte das Architekturbüro BIG ein historisches Dock trocken und verwandelte es in eine unterirdische Erlebniswelt. Zu Besuch im Dänischen Schifffahrtsmuseum.
Man sieht es bis zuletzt nicht. Keine Landmark. Kein lautes Etwas, das aus der Stadtsilhouette hervorsticht wie all die anderen riesigen Schifffahrtsmuseen in Oslo, Portsmouth oder Greenwich, London. Denn im Gegensatz zu seinen Museumskollegen hat das Danish Maritime Museum kein historisches Flaggschiff vorzuweisen, keine Kon-Tiki, keine Cutty Sark, keine Mary Rose und keine Victory, die im Maßstab 1:1 an Land gespült wurden und die es nun einzuhausen galt.
Mit seinen bunten Galionsfiguren und Kronen aus Gold, die sich rund um das Besegeln und Bereisen des Erdballs drehen, und seinen schweigenden Artefakten, die es erst zu erlesen und begreifen gilt, begnügt sich das Danish Maritime Museum mit einer unterirdischen, kaum sichtbaren Geste, mit einem fast vollständigen Verschwinden in der Stadt.
Das Projekt vor den Bastionen von Schloss Kronberg, rund eine Eisenbahnstunde nördlich von Kopenhagen, ist Resultat eines internationalen Wettbewerbs, den das dänische Architekturbüro BIG (Bjarke Ingels Group) 2007 gewonnen hat. Zum Zentrum gemacht wird hier kein Schiff und auch nicht irgendein anderes Objekt kleinerer Größe, sondern das Baugrundstück selbst.
Das 150 Meter lange und 25 Meter breite Trockendock mit seinem schiffsartigen Hohlraum im Stadtgrundriss und seinen rundum laufenden Holzbalken, die die Schiffe einst vor der harten Kaimauer schützten, vermittelt ein authentisches Gefühl für vergangene Zeiten. Immerhin. Denn entgegen der Wettbewerbsausschreibung baute Architekt Bjarke Ingels den Freiraum nicht zu, sondern lässt ihn als abgesenktes Atrium nahezu unangetastet.
Helsingör liegt direkt am Öresund. Von hier laufen die großen Fährschiffe zum benachbarten Schweden aus, dessen Häuser am gegenüberliegenden Ufer mit bloßem Auge gut zu erkennen sind. Eines der letzten historischen Docks hier ist noch mit Wasser geflutet. Die Schiffe können direkt vom Meer in diese etwas groß geratene, rumpfförmige Parklücke einfahren. So muss auch das Dock des Schifffahrtsmuseums vor dem Umbau ausgesehen haben.
Wo ist das Museum?
Doch nachdem das im 17. Jahrhundert errichtete Schloss Kronberg, das mit seinen vier Wachtürmen an den Ecken die strategisch wichtige Meerenge zwischen Nordsee und Ostsee beherrscht, unter Unesco-Schutz gestellt und sein Innenleben wieder nach historischem Vorbild restauriert wurde, hatte ein neuer Plan hergemusst. Für das Schifffahrtsmuseum, das bis dahin in den Burgräumlichkeiten untergebracht war, musste ein neuer Standort gefunden werden.
Man steht unmittelbar vor dem Schloss, doch von Museumsneubau nicht die geringste Spur. Doch plötzlich tut sich vor einem ein riesiger Graben auf, der von gläsernen Brücken durchkreuzt wird. Natursteinpoller, die das alte Trockendock säumen, wissen zu verhindern, dass Autos gegen die gläsernen, fast unsichtbaren Brüstungen des Grabens fahren. Kaum zu glauben, dass die Stadt den - wie man im Architektenjargon sagt - Negativraum eigentlich zuschütten und bebauen wollte.
Architekt Bjarke Ingels, ein cooler, sich gut ermarktender Mann von 39 Jahren, taucht sichtlich gut gelaunt aus dem Nichts auf. Sein Haarschnitt sieht aus, als würde ihm frischer Wind ins Gesicht blasen, der aufgestellte Kragen erinnert an traditionelle Kapitänsmäntel. 2007, kurz vor dem Wettbewerb des Schifffahrtsmuseums, hat er sein Büro gegründet. Heute plant er Wolkenkratzer in aller Welt und betreibt neben Kopenhagen ein zweites Büro in New York.
„Das Dock schien uns damals eine Möglichkeit zu sein, ein Museum zu errichten, das weltweit einzigartig ist“, sagt Ingels. „Ich wollte einen Raum schaffen, der mit Rampen, Brücken, Durchsichten und Reflexionen in seiner gesamten Länge und Breite zu spüren ist.“ Und das ist er in der Tat. Man blickt hinunter in ein leeres Dock, das weitestgehend unangetastet blieb. Die eigentlichen Museumsräume befinden sich auf zwei unterirdischen Geschoßen um diesen Graben herum. Das offene Atrium kann man zwar begehen, in den Innenräumen jedoch kommt man mit dem alten Betongemäuer lediglich im Café in Berührung.
Wie eine breite Wanne mit leichtem Gefälle führt eine zickzackgeformte Rampe in den Graben hinab. Wie eine Billardkugel prallt man hier gegen die Betonwand des Docks und wird sofort wieder zum Eingang umgelenkt. Im Anschluss daran beginnt die Szenografie, die von den niederländischen Architekten xy gestaltet wurde. Wie Eisberge driften die Schiffsmodelle und Vitrinen durch den Raum. Beginnend mit einem originalen, kleinen roten Leuchtturm - also doch ein gebautes Artefakt im Maßstab 1:1 -, wird der schlauchartige Raum in künstliches, blaues Tiefseelicht getaucht und weitet sich kontinuierlich auf, um erst am Ende, an einem Rondell aus Galionsfiguren, wieder von Tageslicht erhellt zu werden.
Haptische Betonmauern
Dramatische Blicke tun sich hier auf: Die Plattform der Straßenbrücke sticht in die Dockmauer. Das Auditorium scheint frei über dem Graben zu schweben. Und die steil aufsteigenden Tribünen mit ihren Schlitzen machen neugierig auf mehr, laden ein, erklommen zu werden. Die abgeschabte Oberfläche der Betonwand tritt, von hier aus betrachtet, besonders sinnlich, besonders haptisch in Erscheinung.
Die Treppen am Bug, die wie Leitern an die Kaimauer gelehnt scheinen, werden mit jedem Schritt immer schmäler und wirken, als würden sie gleich von der Betonmauer rutschen. Wie könne man nur solche Treppen bauen? Das sei ja lebensgefährlich, beschwert sich ein Besucher. Die Ordnung ist im Chaos. Ein bisschen erinnert das Ganze an die Titanic.
Die erlebnisreichsten Räume bieten jedoch nicht die Ausstellungsräume, sondern die verglasten, teils geneigten Brücken und Auditorien, die das Dock wild durchkreuzen. Wie in einem Film tauchen durch die Reflexionen Schatten und Silhouetten auf unterschiedlichen Ebenen auf und verschwinden wieder. Fast hat man das Gefühl, hin- und herzutaumeln wie bei heftigstem Seegang.
Technisches Detail am Rande: Die Bodenplatte musste mit hunderten Stahlseilen bis in 40 Meter Tiefe in festem Grund verankert werden. Durch das Ablassen des Wassers fehlt die einstige Last - und das Dock würde unweigerlich nach oben aufschwimmen, wie ein richtiges Schiff aus Beton eben.
Den Architekten gelang, das Leben auf hoher See mit zeitgemäßen Mitteln auf abstrakte Weise als Erlebniswelt neu zu erfinden. Dass es funktioniert, zeigen die ersten Paare, die sich am Bug des Docks in Pose setzen, ganz wie die Protagonisten beim filmischen Untergang des wohl berühmtesten Schiffs der Schifffahrtsgeschichte.
Der Standard, Fr., 2013.10.25