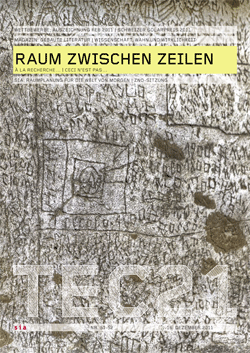Editorial
«Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass die Dinge der Erde nur sehr wenig Realität besitzen und dass es wahre Wirklichkeit nur in den Träumen gibt», heisst es in Charles Baudelaires «Paradis artificiels» (1869). Wenn Träume, die sich in Geschichten abspielen, Gestalt annehmen, kann das erzählende Architektur sein, wie im Museum für den norwegischen Schriftsteller Knut Hamsun von Steven Holl: einer Verkörperung des Athener Turms der Winde, von dem Johan Nagel, Protagonist des Romans «Mysterien» (1892), träumte («Gebaute Literatur», S. 16). Analog soll das «Museum der Unschuld», das in Istanbul im Bau ist, den gleichnamigen Roman des Schriftstellers Orhan Pamuk einfangen (Veranstaltungshinweis, S. 70). Man darf gespannt sein, ob die ausgestell-ten Gegenstände die Räume werden füllen können, die sich zwischen den Romanfiguren Kemal und Füsun auftun – mit dem «Unsagbaren, dem Weissen zwischen den Worten» (Max Frisch), wie es Markus Seifermann und Uwe Schmidt-Hess vorschwebt, den Gründern des Architekturbüros ’Patalab.
Die Artefakte – Türknäufe, Kronleuchter, Puppentorsi, Plattenspieler –, die Seifermann in «Lost Space of Stiller» («À la recherche ...», S. 30) versammelt, sind geheimnisvoller: Die Nadel des Plattenspielers kratzt Spuren in den Abguss einer Wachsschallplatte, ein Trichter transportiert die Botschaft akustisch. Die Arbeit illustriert nicht Epi-soden des Werks von Max Frisch, sondern öffnet ’pataphysische Räume – Welten, die uns entgehen, weil wir unsere Wahrnehmung an Prothesen delegieren. Was von uns Menschen im Zeitalter der Maschinen, die unsere Motorik ersetzen, und der Elektronik, die uns das Denken abnimmt, übrig bleibt, offenbaren die gefesselten Torsi.
Auch im «Poet’s Garden» gibt es einen Apparat, der eine Gravur in Wachs ätzt. Schmidt-Hess, sein Urheber, will der Maschine menschliche Sensibilität einhauchen. Er reduziert die Sprache auf den Rumpf der Buchstaben. Nicht der Inhalt, sondern der Schreibrhythmus liefert den Code, um den Raum abzustecken – einen atmenden, pulsierenden Raum und mithin eines der Organe, die sich der Mensch amputiert hat ... («Ceci n’est pas ...», S. 36).[1]
Zweifach verschlüsselt ist das «Steinerne Buch» von Fernando Oreste Nannetti («Wissenschaft, Wahn und Wirklichkeit», S. 21). Die in die Wand gekratzten Buchstaben erinnern an steinzeitliche Ritzzeichen. Sie zu lesen, gleicht der Entzifferung von Hieroglyphen, und kryptisch sind auch die Botschaften ...
Rahel Hartmann Schweizer
Anmerkung:
[01] Umgekehrt macht das Luft-Vakuum-System eines Pianola im Centre für Dylan Thomas in Swansea (www.dylanthomas.com) den Rhythmus von dessen berühmtestem Buch «Unter dem Milchwald» akustisch wahrnehmbar. In die Notenrolle gestanzt wurde die von Richard Burton gesprochene Blindenschriftübersetzung
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Auszeichnung FEB 2011 | Schweizer Solarpreis 2011
16 MAGAZIN
Gebaute Literatur | Bücher | Wissenschaft, Wahn und Wirklichkeit | Stirling und die Krise der Moderne | Hardbrücke in Zürich wieder offen
30 À LA RECHERCHE ...
Tina Cieslik
Die Installation «The Lost Space of Stiller» des Architekten Markus Seifermann wagt eine räumliche Annäherung an das Standardwerk der Identitätssuche: Max Frischs Roman «Stiller». Sie regt an, über die Gren-zen des architektonischen Alltagsgeschäfts hinauszudenken.
36 CECI N’EST PAS ...
Rahel Hartmann Schweizer
Der «Poet’s Garden» von Uwe Schmidt-Hess ist keine Grünanlage, sondern ein Maschinen-Park, der Buchstaben in einen pneumatischen architektonischen Körper übersetzt. In einem komplexen Transformationsprozess verwandelt sich Schrift in Raum.
46 SIA
Raumplanung für die Welt von morgen | ZNO-Sitzung | Frisch ab Werk(-Vertrag)
51 FIRMEN
53 PRODUKTE
69 IMPRESSUM
70 VERANSTALTUNGEN
Ceci n’est pas …
Der «Garten des Poeten», mit dem Uwe Schmidt-Hess sein Diplom an der Bartlett School of Architecture in London absolviert hat, ist keine Grünanlage, sondern ein poetischer Maschinen-Park. Der Titel der Installation verweist denn auch auf ihre surrealistische Heimat.[1] Die Apparatur erschüttert Denk- und Sehgewohnheiten, wenn sie in einem komplexen Transformationsprozess Schrift in Raum verwandelt. Ideell ist Johann Wolfgang von Goethe der Bezugspunkt des in Weimar sozialisierten Architekten. Inhaltlich ist es der Argentinier Julio Cortázar und dessen Kultroman «Rayuela». Mit ihm verbindet den Baukünstler die Suche nach dem Garten Eden.
«Hier atmet alles; Diese Schatten auf dem Gesims; das Zimmer hat Lungen, etwas schlägt und pulst. Ja, die Elektrizität ist eleatisch, sie hat uns die Schatten versteinert. Jetzt sind sie nur noch Teil der Möbel und der Gesichter. Aber hier ist es anders … Sehen Sie mal diesen Sims, wie sein Schatten atmet, wie die Volute auf und ab steigt.»[2] Die Passage stammt aus dem Roman «Rayuela» von Julio Cortázar (1914–1984, vgl. S. 20). Der Titel des 1963 publizierten und alsbald zum Kult avancierten Romans verweist auf das Himmel-und-Hölle-Spiel, das Kinder auf der Strasse spielen. So surreal oder ’pataphysisch und gespenstisch wie das Zitat mutet die Szenerie im «Garten des Poeten» an3: Vier aus einem scheinbar wirren Haufen von Gestängen zusammengebaute, diffizil anmutende, leicht wackelige Maschinen rattern leise vor sich hin. Nur eine der Apparaturen weist ein auf den ersten Blick identifizierbares Gerät auf: eine Schreibmaschine. Sie signalisiert das narrative Potenzial der Installation. Allerdings, um Kurzschlüssen vorzugreifen: Die Schreibmaschine schreibt nicht, sie liest. Sie liest, was Maschine Nr. 1 und Nr. 2 schreiben, um das Produkt – durchaus im mathematischen Sinn – auf die vierte Maschine zu übertragen. Diese formt daraus ein räumliches Gebilde, eine Art Wachsmodell, auf das der Begriff «Bau-Körper» in besonderer Weise zutrifft: sich aufblähend und zusammenziehend, scheint er zu atmen …
Schreibrhythmus als Impulsgeber
Vertraut mit den Installationen Jean Tinguelys oder Roman Signers erwartet man ein Zusammenwirken der Maschinen in einer Kausalkette. Doch die innere Logik der Maschinerie von Uwe Schmidt-Hess (vgl. Kasten S. 30) ist komplexer, vielschichtiger. Der Wachsklumpen der ersten Maschine findet ein Pendant in der Kerze der zweiten, dessen Glasscheiben tauchen in der dritten, der umfunktionierten Schreibmaschine, wieder auf. Und diese ist ihrerseits bestückt mit einem Stoffband, das schon an der ersten Maschine aufgefallen ist. Das unförmige Etwas der vierten Maschine, das sich bläht und wieder in sich zusammenfällt, hingegen wirkt zunächst autonom bzw. von Geisterhand betrieben.
Den Stoff (durchaus im Doppelsinn von Material und «Geschichte», «Erzählung») schreiben Maschine Nr. 1 und Nr. 2. Die erste Maschine erzeugt auf einem Rollband eine Spur aus Wachs. Dieser tropft von einem Paraffinklumpen, der von einem Lötkolben zum Schmelzen gebracht wird (Abb. 1). Analoges geschieht auf Maschine Nr. 2. Hier liefert eine brennende Kerze den Rohstoff. Als «Malgrund» dienen diesmal zwei rotierende Glasscheiben.
Das Wachs ist nun nicht, wie bei Maschine Nr. 1, sowohl «Tinte» als auch Zeichen, sondern bildet nur die Grundierung. Das eigentliche «Schriftbild» graviert eine Art Grammophonnadel, die an einem Schwenkarm montiert ist (Abb. 2). Ist das Band der ersten Maschine bzw. eine der Glasplatten der zweiten beschrieben, werden sie in die dritte, die Schreibmaschine, eingespannt (Abb. 3). (Gleichzeitig werden Band und Glasscheibe in Maschine Nr. 1 und Nr. 2 durch unbeschriebene «Blätter» ersetzt.) In Gang gesetzt wird die Schreibmaschine ganz klassisch durch Tippen auf die Tastatur. Dabei spielt es keine Rolle, welche Tasten man wählt, entscheidend ist der Rhythmus, in dem getippt wird. Dieser bestimmt den Takt des Motors, der Band und Scheibe bewegt. Die auf ihnen fixierte Wachsspur taktet nun ihrerseits über zwei Laserpointer und zwei Lichtsensoren den Motor der vierten Maschine (Abb. 4): Die Laserstrahlen sind auf das Band und die Glasscheibe gerichtet. Werden die Strahlen von «vorüberziehenden» Wachspartikeln unterbrochen, fällt auch das Signal auf den Sensor aus, bis eine Leerstelle auf Band bzw. Scheibe den Kontakt wieder schliesst. Dieser Wechsel zwischen Ein und Aus wird via Kabelverbindung auf die beiden Motoren – je einen für die Impulse, die durch das Band und die Scheibe ausgelöst werden – der vierten Maschine übertragen und bewirkt dort das Sich-Aufblähen und -Zusammenziehen der Wachshaut: Schriftzeichen werden in einen Baukörper übersetzt. In einem labyrinthischen Umformungsprozess transformiert sich Schrift in Raum – noch dazu in einen beweglichen Raum!
«Gärtner» als Operateur
Uwe Schmidt-Hess spielt mit Analogien und unterwandert sie gleichzeitig. Er evoziert die Illusion eines Perpetuum mobile, doch eine eigentliche Initialzündung, die den ganzen Prozess in Gang setzt, gibt es nicht. Es bedarf mehrerer Eingriffe, die von einem «Gärtner» besorgt werden. Die Kerze muss entzündet und der Strom für den Lötkolben angeschlossen werden. Wenn die Kerze heruntergebrannt ist bzw. der Lötkolben den Paraffinklumpen abgeschmolzen hat, muss das Wachs ersetzt werden. Die Tastatur der Schreib-Lese-Maschine muss bedient werden, und die Glasplatten sowie das Band wollen nach Vollendung eines Zyklus ausgewechselt sein. Dieser Akt wiederum erinnert an ein anderes Medium – an eine Filmrolle, die, wenn sie abgespult ist, aus dem Projektor entfernt und durch eine neue Rolle ersetzt wird. Und Kinematografie bedeutet nichts anderes als das Aufzeichnen von Bewegung.
«Enigma»: Dechiffriermaschine und Morseschreiber
Auch ist nicht die durch die Kerze freigesetzte Energie das Agens, sondern ihr Rohstoff (der fossile Brennstoff) – nicht aber als Energielieferant, sondern als Medium. Das Wachs ist auf mehreren Ebenen der Informationsträger: Erstens ist es das Signal, um die Maschine Nr. 2, d.h. die Bewegung der Glasplatten und des Schwenkarms, in Gang zu setzen. Denn erst, wenn eine ausreichende Menge Wachs auf eine Glasplatte getropft ist, wird der Bewegungsmechanismus ausgelöst. Zweitens bildet es den Malgrund für die Einritzungen des Schwenkarms und fungiert drittens als Impulsgeber für den Takt der vierten Maschine. Schliesslich figuriert das Wachs auch als Membranhülle, die die Frequenz des Signals aufsaugt und die «Botschaft», sich aufblähend und in sich zusammenfallend, verräumlicht – eine Medienhülle. Die Schreib-Lese-Maschine verschlüsselt ebenso wie sie decodiert. Sie operiert wie ein Morseschreiber, der beliebige Zeichen in Rhythmen verwandelt, welche die Drehzahl des Motors bestimmen, der die Bewegung von Band und Scheibe antreibt. Als Dechiffriergerät funktioniert sie, wenn sie entziffert, was auf Band und Scheibe «geschrieben steht», indem sie diese auf Wachsspuren abtastet, die das Signal auf den Sensor «steuern».
Architektur: «Unscharfe» Imagination statt messbares Nichts
Wenn sich Uwe Schmidt-Hess auch nicht auf Marshall McLuhan beruft, so erweist sich die Installation doch als Inkarnation von dessen 1967 postulierter These «das Medium ist die Botschaft» – und vice versa.4 Das Wachs fungiert als Medium und verkörpert die Botschaft. Gleichzeitig untergräbt er das Fundament von McLuhans Theorie, die Metapher, wonach Medien, verstanden als Artefakte – vom steinzeitlichen Faustkeil bis zum elektrischen Licht – als Ausweitungen des Körpers zu verstehen sind: das Rad als Prothese (oder Amputation) des Fusses oder die Kleidung als Ausweitung der Haut (anstatt in Geschichten wie in Kleider zu schlüpfen, wie in Frischs «Mein Name sei Gantenbein», vgl. «À la recherche …») Im Zeitalter der elektronischen Medien amputiert der Mensch gar sein Zentralnervensystem und damit sein Bewusstsein. Schmidt-Hess will das Bewusstsein sensibilisieren und die Automatenmonotonie aufbrechen. Er knüpft an McLuhans Beispiel der Uhr an, die nicht nur ein Messinstrument ist, sondern die Form von Zeit als linearen, gleichförmigen Ablauf von identischen Einheiten «erschafft» und die ursprüngliche Vorstellung von Zeit als Zyklus verdrängt – der Jahreszeiten, des Wechsels zwischen Tag und Nacht, der Mondphasen, der Sonnenwenden. In seiner Diplomarbeit hat Schmidt-Hess dem Berufsstand ins Stammbuch geschrieben: «With the escape of the machines out of the factory architecture itself turned into a factory producing absence in space – contamination of nothingness behind fancy facades. […] architects have to turn into watch makers developing new devices against synchronization for the navigation through the territory of shifting spaces.»[5]
Die vier Apparaturen laufen nicht synchron. Jede hat ihren eigenen Rhythmus. Verzögerungen unterlaufen die Präzision. Der ureigenste Charakter der Maschine, die – sobald sie eingeschaltet ist – in einem regelmässigen Rhythmus taktet, wird aufgeweicht. Diese Unschärfen öffnen Imaginationsräume. Schmidt-Hess hat sie in Plänen und Fotografien festgehalten und die «Geschichte» so noch einmal transkribiert (Abb. 5–7, 9, 10).
Écriture automatique
Es ist eine «écriture automatique»[6], eine von Automaten erzeugte «Erzählung», die Raum greift. Die Installation erinnert denn auch ebenso an Max Ernsts Experimentieren mit der alten Drucktechnik der «Frottage» (Durchreiben), die als Adaption des automatischen Schreibens in der Kunst gilt, wie an die ebenfalls von dem surrealistischen Künstler geübte «Grattage», bei der übereinander aufgetragene Malschichten mit einer Klinge weggekratzt bzw. abgeschabt werden. Die Assoziation mit einem Reissbrett, auf dem früher Architektenpläne entstanden, liegt ebenfalls nah, zumal bei der zweiten Maschine mit den Glasplatten und dem Schwenkarm. Diese lässt aber auch an eine Planchette denken, die Mitte des 19. Jahrhunderts als «Medium» für spiritistische Sitzungen aufkam. Gertrude Stein und Leon M. Solomons experimentierten mit einem solchen «Brettchen» – bestehend aus Glas und mit einem metallenen Schwenkarm versehen als Halterung für einen Bleistift –, um das «unbewusste » Schreiben zu provozieren, und publizierten die Ergebnisse 1896 unter dem Titel «Normal Motor Automatism». In der Literatur fanden sich die einflussreichsten Apologeten der «écriture automatique» in Surrealistenkreisen.
Poesie: Das Geistige, das in der Raumhülle atmet
Mit Cortázars «Rayuela» beruft sich Schmidt-Hess aber auf ein Werk, das dem magischen Realismus zugerechnet wird. Wohlverstanden: «Rayuela» ist nicht die Matrize (siehe Editorial) für den «Garten des Poeten». Aber die Beziehungen sind eklatant. So sind die Anspielungen im Roman auf die «écriture automatique» in geradezu emblematischer Weise sprechend für die Maschinen-Installation: «In jener Zeit war es so gewesen, als sei das, was er schrieb, bereits vor ihm ausgebreitet gewesen, schreiben hiess, eine Lettera 22 über unsichtbare, aber vorhandene Worte zu führen wie den Diamanten über die Rille einer Schallplatte.»[7] Nämliches gilt, wenn Cortázar von seinem Alter Ego berichtet, dessen Schreiben werde von Impulsen ausgelöst und von einem Rhythmus angetrieben.[8] Das Resultat gipfelt in einem Satz, der, ohne Interpunktion auf einem Blatt Papier endlos wiederholt, eine Wand bildet. Als Mauer kann sie nur dehalb wahrgenommen werden, weil an einer Stelle ein Wort fehlt und eine «Öffnung zwischen Ziegelsteinen»[9] lässt, durch die Licht einfällt. Das Resultat des rhythmischen Tippens ist also keine Erzählung, sondern eine Architektur. Der Schlüssel aber, der ins Schloss passt, liefert die Struktur des Romans, dessen Kapitel man nicht in ihrer linearen Abfolge lesen soll, sondern von 73 zu 1, von 2 zu 116, von 3 zu 84 etc. hüpfend, um am Ende nicht in den Himmel zu kommen, sondern in einer Endlosschlaufe hin- und herzuspringen zwischen 58 und 131. Analog bricht Schmidt-Hess die Linearität, die logische Verknüpfung der Textelemente auf, und der maschinelle Prozess mündet im Poetengarten im binären Ein-Aus, das die Wachshaut anschwellen und in sich zusammenfallen lässt.
Das Problem der Figuren in «Rayuela» ist, dass die Wissenschaft mit ihrer Entdeckung der physiologischen Natur unserer Hirnleistungen den jahrhundertealten Gegensatz zwischen Geist und Körper aufgehoben, uns mithin aus dem Paradies der Fantasie, des Traums, der Imagination und ihrer Sprache, der Poesie, vertrieben hat: «Das Gedächtnis entspräche demnach der Anordnung der Nukleinsäuremoleküle im Gehirn, die die Rolle von Lochkarten in den modernen Computern übernehmen» (vgl. Editorial). «Das Cogito […] unterscheidet sich vermutlich weniger, als wir dachten, von solchen Dingen wie Nordlicht oder einem Foto mit Infrarotstrahlen. […] womöglich (ist es) genau umgekehrt, und am Ende ist das Nordlicht ein geistiges Phänomen, und dann haben wir, was wir haben wollten …»[10]: Und zwar Uwe Schmidt-Hess’ Garten Eden, in dem er die poetische Maschine geschaffen, der Materie Geist eingehaucht hat: wenn sich sein Imaginationsraum pneumatisch bläht, widerhallt sowohl die am Anfang dieses Beitrags zitierte Passage als auch: «cogito, das wie ein Atmen wäre […]: Pneuma und nicht Logos.»[11]
Anmerkungen:
[01] Der Verweis zielt auf René Magrittes Werk «La trahison des images (Ceci n’est pas une pipe)», in dem er die Pfeife naturalistisch wiedergab, mit der Bildunterschrift aber betonte, dass es sich eben nur um die gemalte Wiedergabe handelte. Magritte ging es darum, Denk- und Sehgewohnheiten ins Wanken zu bringen. Die für die Surrealisten wichtigen Träume sollten daher «nicht einschläfern, sondern aufwecken». René Magritte, «Die Wörter und die Bilder» in, ders., Sämtliche Schriften, München / Wien 1981, S. 41 ff.
[02] Julio Cortázar, Rayuela (dt. Rayuela: Himmel und Hölle) 1963, hier: Suhrkamp 2010, S. 57. Das Zitat stellte Schmidt-Hess einem Essay voran, das er 2005 im Janus Head publizierte: Uwe Schmidt-Hess, «Spatial Melancholia: The Construction of Sensitive Machines», Janus Head, Winter 2005, S. 212–230, hier: 225. Eleatisch: Eine der vorsokratischen Schulen war die der Eleaten. Ihr Begründer Parmenides betrachtete die wirkliche Welt als unvergängliches und unveränderliches Sein, im Gegensatz zu Heraklits «panta rhei»
[03] Zum ersten Mal war «Poet’s Garden» 2010 im Architekturforum Ostschweiz in St. Gallen zu sehen, zusammen mit einer verkleinerten Fassung von Markus Seifermanns «Lost Space of Stiller» (siehe «À la recherche …», S. 30)
[04] Marshall McLuhan, The Medium is the Massage: An Inventory of Effects (1967). Über den Druckfehler im Titel beim Erscheinen des Buches soll McLuhan sich amüsiert und ihn zu einer Ausweitung seiner These bewogen haben, wonach Medien modellierende Massagen menschlicher Wahrnehmung seien
[05] Uwe Schmidt-Hess, «Spatial Melancholia: The Construction of a Sensible Machine», Thesis, 2005, S. 22
[06] Der Begriff «écriture automatique» geht auf Pierre Janet zurück, der ihn 1889 prägte als Bezeichnung für seine Methode, Patienten in der Psychotherapie unter Hypnose oder in Trance zum Schreiben anzuhalten, um das Unbewusste zu thematisieren. André Breton avancierte in den 1920er-Jahren zum pointiertesten Verfechter der Technik, mit der das Potenzial des spontanen Schreibens ausgelotet werden sollte
[07] Julio Cortázar, Rayuela (dt. Rayuela: Himmel und Hölle) 1963, hier: Suhrkamp 2010, S. 502
[08] wie Anm. 7, S. 460
[09] wie Anm. 7, S. 428
[10] wie Anm. 7, S. 420, 512
[11] wie Anm. 7, S. 486TEC21, Fr., 2011.12.16
16. Dezember 2011 Rahel Hartmann Schweizer