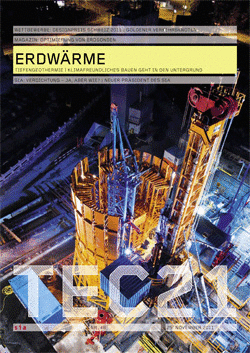Editorial
Als vor etwa zehn Jahren in Basel das Konzept für ein Geothermiekraftwerk zur Strom- und Wärmeproduktion vorgestellt wurde, schien es, als sei die perfekte Energiequelle gefunden – ein nahezu unerschöpfliches, erneuerbares Wärmereservoir, rund um die Uhr verfügbar, dessen Nutzung weder gefährliche Abfälle oder Abgase pro-duziert noch mit grossen Kraftwerkanlagen die Landschaft beeinträchtigt. Umso herber war die Enttäuschung, als das Projekt im Januar 2007 abgebrochen wurde. Der Grund dafür waren einige in Basel deutlich spürbare Erdbeben, hervorgerufen durch das hydraulische Aufbrechen des Gesteins in 5000 Metern Tiefe zur Erzeugung eines «Durchlauferhitzers». Der Wirbel, den diese verursachten, war um einiges grösser als die -effektiven Schäden an Gebäuden. Der damit einhergehende Vertrauensverlust in Bevölkerung und Politik warf jedoch die Bemühungen zur Realisierung eines Geothermiekraftwerks in der Schweiz um Jahre zurück. Nun aber wagt das vor einem Jahr gegründete Kompetenzzentrum Geo-Energie Suisse einen neuen Anlauf. Im Zentrum steht dabei die Weiterent-wicklung der Technologie, um das Risiko spürbarer Erdstösse zu minimieren («Tiefengeothermie ohne Nebenwirkungen?»). Genauso wichtig wird es aber sein, die politische und gesellschaftliche Akzeptanz dafür zu schaffen. Das setzt wie bei jeder Technologie einen gesellschaftlichen Konsens darüber voraus, welche Risiken die Gesellschaft zu tragen bereit ist und in welchem Verhältnis diese zum erwarteten Nutzen stehen.
Beim Betrieb von Kernkraftwerken, Stauanlagen oder Flughäfen in dicht besiedelten Gebieten etwa sind die akzeptierten Risiken heute recht hoch. Wird dieser Diskurs bei der Tiefengeothermie nicht offen geführt, droht der neue Anlauf in langen politischen Auseinandersetzungen zu versanden und eine entscheidende Chance für die energiepolitische Wende in der Schweiz ungenutzt zu verstreichen.
Im Gegensatz zur Tiefengeothermie ist die oberflächennahe Nutzung von Erdwärme mittels Erdwärmesonden in der Regel mit geringen Risiken verbunden und hat sich in der Schweiz gut etabliert. Beim Bau der Sonden besteht aber noch Optimierungspotenzial, wie ein Forschungsprojekt zeigt («Optimierung von Erdwärmesonden», S. 11). Der Untergrund kann jedoch nicht nur zum Bezug von Erdwärme, sondern auch als saisonaler Speicher genutzt werden, in den im Sommer Abwärme eingelagert und im Winter als Heizwärme wieder bezogen wird. In dicht besiedelten Arealen mit gemischter Nutzung bietet sich zusätzlich die Vernetzung der Gebäude mittels eines Anergienetzes an, in das Gebäude mit Kühlbedarf ihre Abwärme einspeisen können, die dann – nach Zwischenspeicherung im Erdwärmespeicher – anderen Gebäuden zum Heizen zur Verfügung steht («Klima-freundliches Bauen geht in den Untergrund»).
Claudia Carle
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Designpreis Schweiz 2011 | Goldener Verkehrsknoten
11 MAGAZIN
Optimierung von Erdsonden
16 TIEFENGEOTHERMIE OHNE NEBENWIRKUNGEN?
Peter Burri, Peter Meier
Durch die Weiterentwicklung der Technologie für Geothermie-Kraftwerke soll das Risiko für spürbare Erschütterungen minimiert und die Wirtschaftlichkeit erhöht werden.
21 KLIMAFREUNDLICHES BAUEN GEHT IN DEN UNTERGRUND
Leonid Leiva
Mit Erdwärmespeichern zur saisonalen Speicherung von Abwärme lassen sich Energiekreisläufe schliessen. Besonders vorteilhaft ist dies in Kombination mit Anergienetzen.
28 SIA
Verdichtung – ja, aber wie? | Neuer Präsident des SIA
30 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Tiefengeothermie ohne Nebenwirkungen?
Tiefengeothermie hat längerfristig das Potenzial, einen signifikanten Beitrag zur Stromversorgung der Schweiz zu leisten, noch dazu mit vielen Vorteilen gegenüber anderen erneuerbaren Energien. Dafür muss es aber gelingen, die Technologie, die in der Schweiz erstmals in Basel erprobt wurde, so weiterzuentwickeln, dass keine spürbaren Erschütterungen mehr auftreten können und die Wirtschaftlichkeit steigt. Das vor einem Jahr gegründete Kompetenzzentrum Geo-Energie Suisse bündelt die bisher wenig koordinierten Aktivitäten und arbeitet an vielversprechenden Technologien.
Die Sicherung unseres künftigen Energiebedarfs ist eine der grössten Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte, und dies nicht erst seit dem von Bundesrat und Parlament beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie. Zwei Rechenbeispiele können uns die Grösse dieser Aufgabe vor Augen führen: Beispiel 1: Der weltweite Verbrauch an Primärenergie von derzeit 140 Mio. GWh steigt ca. 1.5 – 2 % pro Jahr.[1] Das ist in etwa eine Verdopplung innerhalb der nächsten 40 Jahre. Wenn wir als Gedankenspiel annehmen, dass diese gesamte zusätzliche Nachfrage durch Kernenergie gedeckt werden sollte, so müssten wir weltweit pro Tag ein neues Kernkraftwerk von 1 GW (z.B. Gösgen) ans Netz bringen, und das für die nächsten 40 Jahre. Das ist pro Jahr etwa so viel wie die gesamte Leistung aller heute weltweit bestehenden 440 Kernkraftwerke.
Beispiel 2: Der Stromverbrauch in der Schweiz stieg im Jahr 2010 um 4 % oder 2300 GWh.[2] Das ist fast 50-mal mehr als die gesamte Jahresproduktion der installierten Fotovoltaik in der Schweiz von 50 GWh im Jahr 2009.[3] Die zwei Beispiele zeigen, dass es für die Deckung des künftigen Energiebedarfs keine einfache Lösung gibt – vor allem keine, die auf nur einem einzigen Energieträger beruht. Die Herausforderung kann nur gemeistert werden, wenn wir einerseits Wege zu höherer Energieeffizienz und geringerem Pro-Kopf-Verbrauch finden und anderseits alle wirtschaftlich machbaren erneuerbaren Energiequellen entwickeln. Daneben werden im Übergang auch fossile Brennstoffe weiter eine Rolle spielen müssen, vor allem Gas.
Viele Vorteile
Eine erneuerbare Energiequelle mit grossem Potenzial ist die Tiefengeothermie. Die Erde ist ein riesiges Wärmereservoir, das sich – durch den natürlichen Zerfall von radioaktiven Elementen in der Kruste – ständig selbst erneuert. In 5000 Metern Tiefe werden auch in nicht vulkanischen Gebieten Temperaturen von 150 bis über 200 °C erreicht. Theoretisch würde die Erdwärme ausreichen, um den globalen Energiebedarf zu decken. Auch wenn nicht die ganze Energiemenge abgeschöpft werden kann, hat Erdwärme den grossen Vorteil, dass sie zeitlich uneingeschränkt Energie liefern kann (konstante Bandenergie). Hier besteht der grosse Unterschied zu Energiequellen wie Wind und Sonne, die immer Ersatzenergien zur Kompensation ihres schwankenden Energieangebotes bedingen. Andere erneuerbare Energieträger, die ebenfalls Bandenenergie erzeugen, besitzen entweder ein beschränkt ausbaubares Potenzial (Wasserkraft) oder sind von der verfügbaren Menge her limitiert (Biomasse). Weitere Vorteile geothermischer Kraftwerke sind, dass sie das Landschaftsbild kaum beeinträchtigen und keine Abfälle oder Abgase produzieren.
Tiefengeothermie: Zwei verschiedene Systeme möglich
Geothermie wird in der Schweiz bereits genutzt: Rund ein Drittel aller neuen Heizungen sind Wärmesonden und nutzen damit oberflächennahe Erdwärme.[4] Für eine grössere Wärmeproduktion oder für die Stromerzeugung braucht es aber höhere Temperaturen und damit viel tiefere Bohrungen. Bei dieser sogenannten Tiefengeothermie kommen zwei verschiedene Systeme zur Anwendung: Bei hydrothermalen Systemen wird ein von Natur aus durchlässiges, wasserführendes Gestein – meistens Sedimente – in wenigen tausend Metern Tiefe angebohrt und als «Durchlauferhitzer» genutzt, indem in einem Kreislauf kaltes Wasser in die Tiefe gepumpt wird, das sich dort erhitzt und dann wieder an die Oberfläche gelangt, wo mittels Dampfturbine und Generator Strom erzeugt wird. Für eine effiziente Stromerzeugung sind Temperaturen von mehr als 150 °C erforderlich und damit grössere Tiefen, in denen das Gestein oft dicht und undurchlässig ist. Der «Durchlauferhitzer» muss daher in diesen sogenannten petrothermalen Systemen künstlich erzeugt werden, indem das Gestein durch Einpressen von Wasser aufgebrochen wird («Enhanced Geothermal Systems» [EGS]) (Abb. 1, 2).
Hydrothermale Systeme nur an wenigen Orten realisierbar
Hydrothermale Wärmekraftwerke gibt es in Europa seit Jahrzehnten (vgl. TEC21 11/2007). Im Pariser Becken und im deutschen Alpenvorland sind über 50 in Betrieb. Strom wird erst in wenigen Anlagen produziert, z.B. im grossen Rahmen aus vulkanisch geheizten Aquiferen in der Toskana (Larderello) mit einer Leistung von wenig unter 1 GW sowie in wenigen kleinen Anlagen im Rheingraben und in der Region München mit meist unter 5 MW elektrischer Leistung. Wirtschaftlich ist das wegen der relativ tiefen Wassertemperaturen nur, wenn gleichzeitig auch die Wärme genutzt wird. In der Schweiz wurden bisher, mit Ausnahme von Basel, nur hydrothermale Projekte getestet (Abb. 5). Hydrothermale Systeme verlangen aber geologische Situationen, die generell relativ selten anzutreffen sind: Sedimente kommen in grösseren Tiefen – mit Temperaturen, die auch Stromerzeugung ermöglichen – nur in einer schmalen Zone im Alpenvorland vor. In der Schweiz kommt erschwerend hinzu, dass die in Bayern angetroffenen Aquifere westwärts, also gegen die Schweiz zu, weniger durchlässig sind und daher oft zu wenig Wasser liefern. Die Erkundungsbohrung des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich im Triemli-Quartier traf vor zwei Jahren z.B. kein genügend durchlässiges Gestein an. Hydrothermale Systeme werden daher in Zukunft zwar möglicherweise einen wertvollen Beitrag leisten, die Energieversorgung der Schweiz aber nicht wesentlich verbessern.
Petrothermale Systeme schweizweit möglich
Diese Voraussetzungen legen in der Schweiz eine Konzentration auf petrothermale Systeme nahe, denn diese Technik könnte theoretisch überall in der Schweiz angewandt werden. Erstmals ist die künstliche Schaffung eines grossen durchlässigen Systems im tiefen Untergrund im Jahr 2006 bei der 5000 Meter tiefen Bohrung Basel-1 gelungen. Dabei traten allerdings entgegen den Erwartungen mehrere von der Bevölkerung wahrnehmbare Erdbeben auf, die zum Abbruch des Projektes führten. Trotzdem konnten wertvolle Erfahrungen mit der Schaffung eines künstlichen Durchlauferhitzers im Granit gesammelt werden. Nach Schätzungen der Axpo liessen sich in der Schweiz rund 17 TWh Elektrizität pro Jahr mit Geothermie erzeugen. Das ist mehr als das Potenzial von Wind, Sonne und Biomasse zusammen (Abb. 7).5 Allein mit hydrothermalen Kraftwerken ist dieses Potenzial nicht realisierbar. Das BFE rechnet daher viel vorsichtiger mit 4 bis 5 TWh.[6] Gelingt es aber, die petrothermale Technik weiterzuentwickeln und entsprechende Kraftwerke ohne unerwünschte Nebenwirkungen zu realisieren, sind die Zahlen der Axpo realistisch.
Herausforderungen und Hindernisse
Während hydrothermale Geothermieanlagen eine gewisse technologische Reife erlangt haben, steht die Technologie bei petrothermalen Projekten weltweit immer noch im Entwicklungsstadium. Die Herausforderungen liegen im künstlichen Aufbrechen des Gesteins und in den möglichen Nebenwirkungen, die die Erzeugung von Rissen im Untergrund haben kann. Dabei werden durch Einpressen von Wasser unter hohem Druck (bis zu einigen 100 bar) in den Untergrund bestehende Klüfte und Schwächezonen aufgebrochen. Diese Methode wird in der Öl- und Gasindustrie seit Jahrzehnten weltweit angewandt, um die Durchlässigkeit des Gesteins und damit die Produktionsraten zu steigern. Das geschieht aber stets in Sedimentgesteinen und nicht in kristallinem Gestein, der häufigsten Gesteinsart in den Tiefen, die in der Schweiz für petrothermale Anlagen infrage kommen (Abb. 6). Jedes Aufreissen einer Kluft erzeugt ein akustisches Signal, das von empfindlichen Instrumenten an der Oberfläche als Erschütterung aufgezeichnet werden kann. Die Signale erlauben ein Orten der entstandenen Risse. In der Bohrung Basel-1 wurden etwa 15 000 einzelne Erschütterungen gemessen, von denen fünf bis sechs stark genug waren, um vom Menschen wahrgenommen zu werden. Die aufgezeichneten Risssignale erlauben es den Wissenschaftern, genau zu erkennen, wie gross das künstlich geschaffene Reservoir ist; in Basel wäre eine zweite Bohrung in diese «Risswolke» hineingebohrt worden, um einen Wasserkreislauf installieren zu können (Abb. 2 und 3).
Aus diesem hydraulischen Aufbrechen ergeben sich auch die wesentlichsten Fragen zur Anwendung der Methode. Die künftigen Pilotprojekte müssen zeigen, dass das Aufbrechen (Fracturing) ohne leicht wahrnehmbare Erschütterungen erfolgen kann und dass sich die Methode schweizweit vielfach und innerhalb wirtschaftlicher Vorgaben anwenden lässt.
Verbesserte Technologie aus der Öl- und Gasindustrie
Die Resultate aus Basel und weitere Forschungsergebnisse aus der Felsmechanik zeigen, dass die Magnitude der Erschütterungen mit verbesserten Methoden mit hoher Wahrscheinlichkeit kontrolliert werden kann. Dazu werden vor allem erprobte Techniken aus der Öl- und Gasindustrie beigezogen: von einer senkrechten Bohrung gehen in der Tiefe viele horizontale Bohrungen ab, was für ein wesentlich grösseres Volumen sorgt, aus dem Gas bzw. Wärme gewonnen werden kann (Abb. 4). Dieses grössere Gesteinsvolumen könnte dann mit wesentlich mehr, dafür aber sanfteren Stimulationen aufgebrochen werden, sodass in Kombination mit einem genauen Überwachungssystem die Erschütterungsnormen eingehalten werden könnten.
Technologien, die aus der Öl- und Gasindustrie übernommenen werden können, sind zwar ausgereift und vielfach erprobt, aber oft teuer. Da gefördertes heisses Wasser nicht denselben Preis wie Öl oder Gas erzielt, müssen die Bohrkosten wesentlich gesenkt werden, etwa durch Standardisierung und das Erstellen von serienmässigen Geothermieanlagen Trotzdem lässt sich jetzt schon zeigen, dass geothermische Stromgewinnung innerhalb der erneuerbaren Energien konkurrenzfähig ist.[5] Kraftwerke in Deutschland, die Strom und Wärme erzeugen, wie Unterhaching bei München oder Landau in Rheinland-Pfalz, können bereits wirtschaftlich betrieben werden. Eine attraktive Möglichkeit für die Schweiz wäre, kleine, dezentrale Gaskombikraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung mit Geothermiekraftwerken zu kombinieren. Damit würde es möglich, Gaskombikraftwerke mit einer wesentlich besseren CO2-Bilanz zu erstellen.
Zu wenig Informationen über den Schweizer Untergrund
Ein Handicap in der frühen Phase der Exploration für Tiefengeothermie ist die Tatsache, dass der tiefe Untergrund der Schweiz sehr viel schlechter mit Seismik und Bohrungen untersucht ist als in unseren Nachbarländern. Nachdem die Industrie bisher bereits über 200 Mio. Franken in tiefengeothermische Projekte investiert hat, böte sich hier die Möglichkeit zur Förderung einer Zukunftstechnologie auf Bundesebene, ohne dass der Bund direkt in Kraftwerkprojekte investieren müsste. Eine regionale Erforschung der Schweiz mit Explorationsbohrungen, kombiniert mit moderner Seismik, wäre dringend notwendig, auch für viele andere Nutzungen des Untergrunds wie CO2-Lagerung (vgl. TEC21 37/2011), Untergrundspeicher z.B. für Gas, Wassernutzung, Lagerung von Schadstoffen, Erdöl- und Erdgasexploration sowie auch für die Erdbebenforschung und -vorhersage. Eine solche Erforschung des tiefen Untergrundes der Schweiz würde allerdings Investitionen von mehreren hundert Millionen Franken bedingen.
Neues Kompetenzzentrum bündelt die Schweizer Aktivitäten
Bei der Erforschung der Geothermie in der Schweiz ging es bisher immer um lokale Einzelprojekte, deren Auswahl oft mehr von lokalpolitischen Faktoren bestimmt wurde als von der technisch-geologischen Eignung. Zwischen den Projekten gab es wenig Erfahrungsaustausch, sodass das Risiko besteht, dass Fehler wiederholt werden – ein teures Vorgehen, denn Tiefengeothermie-Projekte verlangen Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe und sind in der Explorationsphase risikoreich. Aus dieser Erkenntnis heraus haben sieben Schweizer Energiefirmen Ende 2010 die Firma Geo-Energie Suisse gegründet, um Risiko und Kosten der Pionierprojekte in der Tiefengeothermie zu teilen.[8] Ziel ist es, ein Inventar der idealen Standorte zur geothermischen Stromgewinnung in der Schweiz zu erstellen, die Technologie mit den Erfahrungen aus dem Basler Projekt weiterzuentwickeln und dann gemeinsam ab ca. 2014 die technisch, wirtschaftlich und politisch besten Standorte mit Bohrungen zu testen. Geo-Energie Suisse setzt dabei aus oben genannten Gründen den Schwerpunkt auf petrothermale Systeme. Neben Strom wird dabei als Nebenprodukt auch Wärme erzeugt, deren Nutzung beim Projekt in Basel aus wirtschaftlichen Gründen zwingend war. Mit der Erhöhung der Effizienz petrothermaler Systeme wird sich der Schwerpunkt mehr auf die Erzeugung von Elektrizität verlagern. Damit wären die Projekte nicht mehr an die Nähe zu Wärmeverbrauchern gebunden und könnten theoretisch überall erstellt werden.
Ausblick
Wenn es gelingt, die Technologie der Erzeugung von künstlichen Risssystemen im kristallinen Untergrund wie oben angedeutet weiterzuentwicklen, könnten in der Schweiz im Prinzip hunderte solcher Geothermiekraftwerke gebaut werden. Geologisch kommen dafür die meisten Gebiete der Schweiz infrage (Abb. 6). Geothermiekraftwerke eignen sich daher ideal für die geplante dezentrale Energieversorgung des Landes. Wenn sich die Umweltverträglichkeit von petrothermalen Kraftwerken auch im Hinblick auf Erschütterungen klären lässt, können auch wieder Geothermiekraftwerke in Nähe der Ballungszentren gebaut werden, wo zusätzlich zum Strom noch Wärme genutzt werden kann.
Anmerkungen:
[01] BP Statistical Review of World Energy, 2011
[02] Bundesamt für Energie: Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2010
[03] Bundesamt für Energie: Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2010
[04] HEV: Bohrung einer Erdsonde für die Wärmepumpe; www.hev-schweiz.ch/bauen-wohnen/ heizsysteme
[05] Axpo: Strom für heute und morgen, Stromperspektiven 2020 – neue Erkenntnisse. 2010, 2. Auflage
[06] Grundlagen für die Energiestrategie des Bundesrates. Bundesamt für Energie, Mai 2011
[07] P. Burri: A Revolution in Gas, Swiss Bulletin for Applied Geology Vol. 15/2 2010
[08] Azienda Elettrica Ticinese (AET), Elektra Baselland (EBL), Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz), EOS Holding SA (EOS), Energie Wasser Bern (ewb), Gasverbund Mittelland AG (GVM), Industrielle Werke Basel (IWB)TEC21, Fr., 2011.11.25
25. November 2011 Peter Burri, Peter Meier
Klimafreundliches Bauen geht in den Untergrund
Erdwärmespeicher ermöglichen die saisonale Speicherung von sommerlicher Abwärme im Untergrund, damit sie im Winter zum Heizen genutzt werden kann. Bei der Konzeption solcher Speicher gilt es, den Bauaufwand gegen die gewünschte Speichertemperatur abzuwägen. Vor allem in dicht bebauten Gebieten mit Wohn- und Gewerbegebäuden bietet sich die Integration in ein Anergienetz an, das Gebäude mit unterschiedlichen thermischen Bedürfnissen miteinander verbindet.
Der emissionsarme Betrieb von Gebäuden ist im Zuge des Klimawandels zu einer wichtigen Rahmenbedingung modernen Bauens geworden. Gebäude, deren Beheizung und Kühlung möglichst ohne fossile Brennstoffe auskommt, sind ein wichtiger Beitrag dazu. Ein Konzept, das in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist die saisonale Speicherung von niederwertiger Wärme und Kälte im Gründungsbereich von Gebäuden. Diese erst seit ein paar Jahrzehnten zunächst theoretisch verfolgte Idee sieht die Lagerung von überschüssiger Sommerwärme im Untergrund vor sowie deren späteren Bezug zu Heizzwecken im Winter, entweder direkt oder mittels Wärmepumpen. Das Konzept ermöglicht gleichzeitig die Speicherung von Kälte zur Kühlung in den Sommermonaten: Indem die Wärme während der kalten Jahreszeit vollständig aus dem Speicher bezogen wird, entsteht dort eine Wärmesenke, in die der sommerliche Wärmeüberschuss befördert werden kann. Dieser Wärmeüberschuss, der gespeichert wird, stammt von Kühlprozessen, Industrieprozessen, anderen Abwärmequellen oder aus Solarkollektoren. Durch die saisonale Speicherung ergibt sich somit ein doppelter Gewinn: Zum einen wird der Bedarf an aufwendiger Kühlung reduziert und zum anderen die Abwärme, die bisher an die Umgebung abgegeben wurde, vorerst gespeichert und später im Gebäude selbst genutzt – Energiekreisläufe werden geschlossen.
Konzeption von Erdwärme speichern
In den Untergrund geleitet wird die Wärme mittels Erdwärmesonden. Die Bohrtiefen, in denen die Speicher angelegt werden, reichen von 20 bis 250 Metern. Durch die U-förmigen Sonden aus Polyethylen fliesst eine Flüssigkeit – Wasser oder ein Gemisch aus Wasser und Glykol, die als Wärmeträger fungiert. Das Bohrloch wird um die Sonden herum mit einem Material verfüllt, das den Wärmeübertragungswiderstand zwischen Wärmeträgerfluid in der Sonde und umgebendem Erdreich senkt (vgl. Artikel «Optimierung von Erdwärmesonden» S. 11). Die Sonden werden in Rastern oder als konzentrische Ringe angeordnet mit einem Abstand zwischen den Sonden, der je nach der angestrebten Temperaturverteilung und Bohrtiefe zwischen 2 und 7 Metern schwanken kann. Oft wird die Wärme nur im zentralen Bereich gespeichert – mit dem Ergebnis, dass die Mitte des Speichers eine höhere Temperatur aufweist als dessen Randbereich. Extrahiert wird die Wärme dann zunächst aus dem äusseren, kälteren Bereich und später aus der wärmeren Region in der Mitte. Dieses Be- und Entladekonzept minimiert die Wärmeverluste, die sich durch die Angleichung der Speichertemperatur an jene der Umgebung des Erdwärmespeichers ergeben würden. Insgesamt können diese Verluste bis zu 20 % der gespeicherten Energie ausmachen.
Erforderliche Eigenschaften des Untergrundes
Ideal für einen Erdwärmespeicher ist der Untergrund, wenn er aus wassergesättigten Tonen oder Tonsteinen besteht. Neben einer relativ hohen Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs ist auch eine geringe Wasserdurchlässigkeit wichtig, denn die Präsenz von Grundwasser ist einem Erdwärmespeicher generell abträglich. Wasser, vor allem wenn es grosse Strömungsgeschwindigkeiten aufweist, kann die Wärme sehr effizient vom Speicher wegtragen. Deshalb wird ein Erdwärmespeicher in der Regel oberhalb des Grundwasserhorizonts angelegt. Dies limitiert an manchem Standort die erreichbare Bohrtiefe und somit die mittlere Temperatur im Speicher, aber dieser Nachteil kann in den meisten Fällen mit mehr Sonden wettgemacht werden. Dies allerdings vergrössert die vom Speicher in Anspruch genommene Fläche. Die Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes sollte weder zu hoch noch zu tief sein: Ist sie zu tief, kann nur wenig Wärme übertragen werden, ist sie zu hoch, mehren sich die Verluste. Grundwasser kann zwar als Speicher dienen, aber nur, wenn die Strömungsgeschwindigkeit tief ist.
Wärmenutzung via Erdwärmesonden oder direkt
Eine bei der Planung eines Erdwärmespeichers häufig auftretende Fragestellung betrifft die optimale Bohrtiefe. Je tiefer gebohrt wird, desto höher wird die mittlere Erdtemperatur, die dann näher bei der Speichertemperatur zu liegen kommt. Durch den kleineren Temperaturgradient werden die Wärmeverluste minimiert. Doch Bohrungen sind teuer: Die Kosten pro Bohrmeter schwanken je nach Untergrund zwischen 60 und 120 Franken. Und in der Regel braucht ein Erdwärmespeicher zwischen 30 und mehreren hundert Sonden. Deshalb muss das Optimum der Bohrtiefe zwischen Speichertemperatur, mittlerer Erdtemperatur, Menge bzw. Temperatur der Abwärme und Bohrkosten gesucht werden.
Die Investition in einen Speicher ist abhängig von dessen Grösse. Die Grösse wiederum hängt eng mit der Frage nach der erwünschten Speichertemperatur sowie mit der Entscheidung zusammen, ob Wärmepumpen verwendet werden oder die Wärme direkt extrahiert wird. Ist der Speicher für hohe Temperaturen (über 50 °C) ausgelegt, muss er ein grosses Volumen einnehmen. Dies liegt daran, dass es bei grösseren Volumina leichter ist, das Oberflächen-Volumen-Verhältnis und somit die Wärmeverluste durch Kontakt mit der kälteren Umgebung zu reduzieren. Höhere Temperaturen bieten den Vorteil, dass die Wärme direkt, also ohne Veredelung durch eine Wärmepumpe, genutzt werden kann. Das heisst, bei der Entscheidung über Grösse und Temperatur des Speichers muss der Bauaufwand gegen die Investition in eine Wärmepumpe abgewogen werden.
Anergienetze nutzen Synergien
Matthias Sulzer, Geschäftsführer der Gebäudetechnikfirma Lauber Iwisa AG und Dozent für Energie- und Gebäudetechnik an der Hochschule Luzern, beschäftigt sich mit dem systemischen Verhalten von Erdwärmespeichern. Er ist ein Befürworter von eher tiefen Speichertemperaturen unter Verwendung von Wärmepumpen, denn tiefe Speichertemperaturen ermöglichen auch die Speicherung von tiefwertiger Energie (Anergie, vgl. Kasten und Abb. 1 S. 21), wie sie in vielen Prozessen als Abwärme anfällt. Die Speicher sollten dann entsprechend in ein Anergienetz integriert werden. Solche Anergienetze nutzen Niedertemperaturwärme (8 bis 20 °C) aus Kühlprozessen, Tunnelwärme oder Solarwärme aus einem Verbund von Wohn- und Gewerbegebäuden. Durch deren thermische Vernetzung lassen sich die Synergien zwischen den Gebäuden nutzen, weil Bürogebäude eher Kühlungsbedarf haben, während Wohnhäuser hauptsächlich Heizwärme brauchen. Die aus der Kühlung der Bürogebäude anfallende Überschusswärme kann daher zur Beheizung von Wohnungen genutzt werden. Weil die beiden Prozesse in verschiedenen Jahreszeiten stattfinden, sind dafür allerdings Langzeitspeicher notwendig. Aus diesem Anergienetz können Wärmepumpen laut Sulzer günstig und effizient mit Quellwärme versorgt werden. Somit müsse nicht jeder einzelne Hausbesitzer eigene, teure und schlecht genutzte Erdwärmesonden bohren. «Und das Bankgebäude zwei Strassen weiter muss nicht mit grossen Investitionen die Abwärme aus dem Serverraum über Kühltürme an die Umwelt abgeben.»
Verschiedene Ansätze in der Praxis
Dieser Ansatz wird inzwischen auch bei Projekten verfolgt, die ursprünglich als Hochtemperaturspeicher konzipiert wurden. In Neckarsulm (D) beispielsweise wurde ein Erdwärmespeicher für Temperaturen bis 70 °C geplant, damit eine Direktnutzung möglich wäre. Nach zehn Jahren Betriebserfahrung wird er nun gemäss Empfehlungen von Experten der Universität Stuttgart in ein neues Nutzungskonzept überführt und mit einer Wärmepumpe kombiniert.[1] Dadurch gewinnt das System an Robustheit, denn dank der Wärmepumpe ist es weniger empfindlich gegen Schwankungen der Speichertemperatur. Bei einer direkten Nutzung würde die Heizung nicht funktionieren, wenn der Speicher zu «kalt» ist. Von Anfang an mit einem Niedertemperatur-Anergienetz geplant wurde das Areal «Suurstoffi », das derzeit als neues Quartier in der Gemeinde Risch Rotkreuz ZG entsteht (Abb. 2–5).[2] Die Überbauung mit rund 600 Wohnungen und 2500 Arbeitsplätzen soll mithilfe eines saisonalen Erdwärmespeichers ihren Wärmebedarf völlig CO2-frei decken. Eine Fotovoltaikanlage vor Ort deckt den Strombedarf sämtlicher haustechnischer Anlagen. Ähnliche Konzepte werden auf dem Hönggerberg-Campus der ETH Zürich, bei der Familienheim- Genossenschaft Zürich sowie auf dem Richti-Areal in Wallisellen ZH implementiert (vgl. Kasten S. 24).
Auf höhere Speichertemperaturen für eine Direktnutzung der Wärme ohne Wärmepumpen setzt hingegen Basler & Hofmann beim eigenen Geschäftsgebäude in Esslingen, das vor rund einem Jahr fertiggestellt wurde (Abb. 8). Dessen Beheizung stützt sich auf Erdwärmespeicher im Untergrund. Die Direktnutzung des Speichers soll dank einem modernen Heizsystem mit einer tiefen Vorlauftemperatur von 26 °C möglich sein, denn dadurch genügt es, den Speicher im Sommer auf rund 35 °C aufzuwärmen. Die Planer wussten, dass diese Temperatur erst nach fünf Jahren erreichbar wäre. Das hatten Berechnungen der Fachhochschule Tessin gezeigt und daraufhin war der Einsatz einer Wärmepumpe zur Heizunterstützung in den ersten Heizperioden vorgesehen worden. Aber eine Überraschung kam hinzu: Zu Beginn der ersten Heizperiode nach dem Erstbezug des Gebäudes im Oktober 2010 hatte der Speicher noch nicht die geplante Temperatur von 28 °C erreicht, sondern erst 23 °C. Dies wird vonseiten der Planer bei Basler & Hofmann in erster Linie auf das Auftreten von Hangwasser im Bereich des Speichers zurückgeführt. Das Hangwasser habe Wärme aus den oberen Metern des Speichers weggetragen. Wenn es gelingt, das Durchsickern von Wasser zu verhindern, sollte sich der Speicher in den vorgesehenen fünf Jahren aber in den optimalen Temperaturbereich einschwingen. Allerdings bleibt die genaue Temperatur im Speicher nach wie vor von kaum kalkulierbaren Faktoren abhängig wie von der Sonneneinstrahlung und deren zeitlicher Verteilung, von der Aussentemperatur im Winter oder vom Komfortbedürfnis der Nutzer. In Esslingen zum Beispiel ging man bei der Planung von einer Raumtemperatur von 21 °C im Winter aus; die Nutzer fanden es aber erst bei 23 °C behaglich, sodass dem Speicher entsprechend mehr Wärme entnommen werden musste. Die lange «Einfahrtzeit», bis die Speicher mit Wärme gefüllt sind und optimal genutzt werden können, ist ein weiterer Grund, der für niedrige Speichertemperaturen spricht. Ein Speicher mit einer Temperatur bis zu 20 °C würde sich laut Sulzer in weniger als drei Jahren füllen. Sulzer ist überzeugt, dass Erdwärmespeicher in Kombination mit Wärmepumpen und Anergienetzen einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz in der Schweiz leisten können.
Wenn in den nächsten 20 Jahren die klima- und energiepolitischen Ziele umgesetzt werden sollen, müsse man mindestens 60 % der Ölheizungen (ca. 30 000 GWh/a) durch Wärmepumpen ersetzen. Sulzer:«Um diese Wärmepumpen vor allem in dicht bebauten Gebieten effizient und kostengünstig zu versorgen, sind Anergienetze erforderlich.» Erdwärmespeicher würden den Ausgleich zwischen Wärmeeintrag in und Wärmebezug aus dem Anergienetz gewährleisten. «Ich bin überzeugt», sagt Sulzer, «dass solitäre Wärmespeicher und Wärmegewinnungsanlagen in dicht bebauten Gebieten weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll sind. Eine thermische Vernetzung solcher Gebiete ist ebenso sinnvoll wie die heutige elektrische Vernetzung.»
Anmerkungen / Literatur:
[01] Mündliche Auskunft von Thorwald Ritter, Stadtwerke Neckarsulm (D)
[02] www.suurstoffi.ch – Thomas Schmidt, Hans Müller-Steinhagen: Erdsonden- und Aquifer-Wärmespeicher in Deutschland. OTTI Profiforum Oberflächennahe Geothermie, Regenstauf, 14.–15. April 2005TEC21, Fr., 2011.11.25
25. November 2011 Leonid Leiva