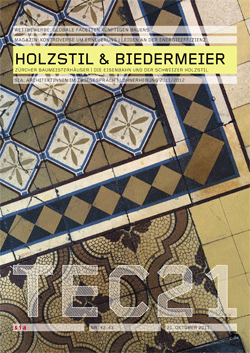Editorial
Noch immer leidet die Wahrnehmung von Architektur aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter der rigorosen Ablehnung, die sie im 20. Jahrhundert erfahren hat. Bis heute besuchen Architekturschaffende, die sich mit der vormodernen Baugeschichte beschäftigen, mit Vorliebe romanische Kirchen, Palladio-Villen oder Bauten von Klassizismusmeistern wie Karl Friedrich von Schinkel – allesamt ausgesprochene Solitärbauten. Dabei gilt es heute, im urbanen Kontext zu bauen. Da wären doch eigentlich historische Vorbilder für dichte Bebauungsformen und multifunktionale Gebäude von grossem Interesse. Und da hat das 19. Jahrhundert, das europäische Jahrhundert der Verstädterung, einiges zu bieten.
Dieses Heft behandelt zwei Gruppen von Bauzeugen aus jener Zeit: die Zürcher Baumeisterhäuser und Bauten im Schweizer Holzstil.
Während die Zürcher Baumeisterhäuser von Kleininvestoren in einer lokalen stilistischen Ausprägung erstellt wurden, war der Schweizer Holzstil ein internationaler Stil, zu dessen Verbreitung akademi-sche Architekten, Architekturlehrbücher, frühe Chalet-Fabriken und – in diesem Heft speziell beleuchtet – Bahn-gesellschaften beitrugen. Die «Laubsäge-Architektur» wurde später verteufelt, die Baumeisterhäuser dagegen wurden nur lange übersehen.
Doch sie haben viele Gemeinsamkeiten: Beide wurden spät wiederentdeckt, über beide weiss man wenig, und beide sind gefährdet. Gebaut wurden sie von etwa 1830 bis zum Ersten Weltkrieg. In jener Epoche entstand die Eisenbahn, die Städte explodierten, die technologische Entwicklung beschleunigte sich rasant, und die Bauteil-produktion wurde industrialisiert. Das alles prägte sowohl die Baumeisterhäuser als auch die Bauten im Schwei-zer Holzstil. Beide sind in quasiserieller Produktion entstanden, teilweise noch handwerklich, aber bereits mit standardisierten und vorfabrizierten Bauteilen aus Katalogen, die mit der Bahn transportiert wurden. Ihre Archi-tektur ist meist bescheiden, aber in Entwurf und Ausführung sorgfältig und bietet Qualitäten, die heute wieder gefragt sind.
Baumeisterhäuser und Bauten im Schweizer Holzstil zeugen von einer Zeit, als die Städte verdichtet wurden, die Ressourcen knapp waren, das Bauen bereits industrialisiert wurde, aber noch ohne Erdöl und mit wenig Strom auskam – also von Bedingungen, wie sie künftig beim Bauen nachhaltiger Siedlungsformen wieder gelten wer-den. Diese Bauten sind deshalb durchaus die eine oder andere Studienreise wert – dazu aber müssen sie über-leben. Sie verdienen deshalb mehr Wertschätzung und besseren Schutz.
Ruedi Weidmann
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Globale Facetten künftigen Bauens
14 PERSÖNLICH
Peter Zuber, 1939–2011 | Ämter und Ehren | Baudynamikpreis für Peter G. Trombik
16 MAGAZIN
Kontroverse um Erneuerung | Leiden an der Energieeffizienz | 40 Wakkerpreise
22 ZÜRCHER BAUMEISTERHÄUSER
Ruedi Weidmann, Nathalie Cajacob
Das Amt für Städtebau der Stadt Zürich hat die «Baumeisterhäuser» aus dem 19. Jahrhundert entdeckt. Die multifunktionalen Bauten sind ein Modell für dichtes, urbanes Bauen.
29 DIE EISENBAHN UND DER SCHWEIZER HOLZSTIL
Ruedi Weidmann
Der Erfolg des Schweizer Holzstils im 19. Jahrhundert hängt eng mit dem Bau der Eisenbahnen zusammen. Dieser noch wenig bekannte Bezug rückt Laubsägeli-Bauten in ein neues Licht.
37 SIA
Ausgezeichnetes SIA-Haus | A&K-Reise nach Nevada | Architektinnen im Zwiegespräch | Lohnerhebung 2011/2012
41 MESSE
Die Hausbau- und Energiemesse 2011 informiert über Themen wie LED, Sonnenenergie oder Elektromobilität. Mit Herbstseminar und Rahmenprogramm.
42 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Zürcher Baumeisterhäuser
Der Abbruch eines legendären Haushaltwarengeschäfts bewegte das Amt für Städtebau der Stadt Zürich dazu, sich mit den «Baumeisterhäusern» zu beschäftigen, die nach und nach aus dem Stadtbild verschwinden. Die einfachen Bauten entstanden während des Verstädterungsprozesses im 19. Jahrhundert und überzeugen mit solider Bausubstanz, einfacher Technik, praktischen Grundrissen, gemischten Nutzungen und Beiträgen an lebendige Stadträume – also mit Merkmalen des nachhaltigen Bauens.
Es kommt selten vor, dass eine neue Denkmalgattung entdeckt wird. Dem Amt für Städtebau der Stadt Zürich ist nun ebendies gelungen. Der Abbruch des Haushaltwarengeschäfts Schmuklerski an der Badenerstrasse gab 2006 den Anstoss zu einer eingehenden Untersuchung der Zürcher «Baumeisterhäuser». In Zusammenarbeit mit dem Institut für Denkmalpflege und Bauforschung der ETH Zürich wurde die Bedeutung dieser Bauten aus verschiedenen Perspektiven analysiert. Resultat ist eine reich bebilderte und gut gestaltete Publikation, die in sieben kurzen Beiträgen einen bisher übersehenen Bautyp für die Architekturgeschichte erschliesst und dabei in vorbildlicher Weise nicht nur seine baugeschichtlichen, sondern auch seine soziokulturellen Qualitäten und sein Potenzial für die weitere Stadtentwicklung beleuchtet. Die Untersuchungsresultate werden bis zum 18. November auch in einer Ausstellung im Baugeschichtlichen Archiv präsentiert (vgl. Kasten).
Entstehung im politischen Umbruch
Die einfachen Wohn- und Handwerkerhäuser entstanden ab 1831 zu Hunderten in den nun entstehenden Vorstädten und im Gebiet der 1833/34 abgetragenen Stadtbefestigung.[1] Die Bezeichnung Baumeisterhäuser hat sich im Amt für Städtebau etabliert, da die Häuser nicht von akademisch ausgebildeten Architekten, sondern von Baumeistern mit handwerklichen Wurzeln entworfen und gebaut wurden. Die frei stehenden Bauten mit rechteckigem Grundriss weisen über einem meist gewerblich genutzten Erdgeschoss ein bis drei Stockwerke mit je einer Mietwohnung auf. Stilistisch orientierten sich ihre Erbauer am Klassizismus der vornehmen Zürcher Architektur, den sie mit bescheidenen Mitteln übernahmen. Dieser reduzierte Klassizismus ist auch schon als Biedermeierarchitektur bezeichnet worden.[2] Eine typologische Wurzel sind die Kosthäuser, die Fabrikanten seit dem frühen 19. Jahrhundert als Arbeiterunterkünfte errichteten.
Die 1830er-Jahre brachten der Stadt Zürich grosse Umbrüche. Die liberale Kantonsverfassung von 1831 garantierte die bürgerlichen Freiheiten. Zwei davon, die Niederlassungsfreiheit und die Handels- und Gewerbefreiheit, hatten Folgen für die Siedlungsentwicklung: Von nun an durfte sich jeder Kantonsbürger in jeder Gemeinde des Kantons niederlassen und irgendein Gewerbe eröffnen. Das löste eine Zuwanderung in die Städte und einen anhaltenden Bauboom aus. Das Ende der Zunftmonopole bedeutete auch eine Liberalisierung des Bausektors. Nach dem Abbruch der ausgedehnten Anlagen der Zürcher Stadtbefestigung wurde ein Grossteil des Bodens an Private verkauft; der Grundstückshandel entwickelte sich. Nebst grossbürgerlichen Wohnsitzen wurden auf dem neuen Baugrund viele Baumeisterhäuser gebaut. Sie boten in die Stadt ziehenden Arbeiter- und Handwerkerfamilien Unterkunft. Baumeisterhäuser entstanden auch um die stadtnahen Siedlungskerne beim Kreuzplatz, auf der Platte oder in Aussersihl, entlang der Ausfallstrassen und in den umliegenden Gemeinden Riesbach, Hottingen, Unter- und Oberstrass, Wiedikon, Wollishofen und Wipkingen, die 1893 eingemeindet wurden. Ähnliche Häuser findet man auch in Ortschaften in Zürichs Umgebung, die im 19. Jahrhundert stark wuchsen, in Uster etwa oder in den Seegemeinden. Doch nicht überall kommen sie vor. In Basel beispielsweise setzten sich bereits ab 1851 der Staat und gemeinnützige Gesellschaften für den Bau von Arbeitersiedlungen ein, weshalb der Anreiz zum spekulativen Wohnungsbau geringer war.
Kleine Bauherren, gemischte Bewohnerschaft
Die Bauherren waren vorwiegend Handwerkermeister, Gewerbetreibende oder Wirte. Solange der Zustrom vom Land anhielt, war der Bau von Mietshäusern für diese kleinen Investoren ein sicheres Geschäft. Es kam zwar vor, dass Handwerker ein Wohnhaus mit Werkstatt für sich selber bauen liessen, viele Neubauten wurden jedoch schon im folgenden Jahr veräussert – ihre Bauherren spekulierten auf einen baldigen gewinnbringenden Verkauf. Einen Teil des Erlöses investierten sie nicht selten in den Bau des nächsten Hauses.
Die Baumeisterhäuser reagierten auf das neue Bedürfnis nach separat mietbaren Wohneinheiten für Familien aus Mittelstand und Unterschicht. Die Bewohnerschaft war oft gemischt. Sie umfasste etwa einen Handwerker, der sein Geschäft im Erdgeschoss betrieb und mit seiner Familie im ersten Stock wohnte, und in den übrigen Wohnungen Handwerker, Kleingewerbler, niedrige Angestellte oder Facharbeiter mit ihren Familien und Untermietern.[3]
Anfgang und Ende eines Hybridhaustyps
Das «Gassengesetz» von 1834 regelte die Bebauung der neuen Wohngebiete. Es schrieb unter anderem Strassenbreite (12 m für Haupt-, 9 m für Nebenstrassen), maximale Gebäudehöhe (21 m) und Mindestabstand zur Nachbarparzelle (1.8 m) vor. Das ermöglichte eine relative hohe Ausnutzung des Bodens. 1863 beschloss der Regierungsrat, mit einem neuen Baugesetz «Übelstände zu beseitigen, die aus der jahrelangen planlosen baulichen Entwicklung der Stadt hervorgegangen» waren. Die Grenzabstände wurden grösser, dafür durften Gebäude aber neu auch direkt auf die Grundstücksgrenze gesetzt werden, wenn sie mit einer Brandmauer versehen waren. Das erlaubte eine höhere Ausnutzung und förderte den Bau von Doppelwohnhäusern oder das Aneinanderreihen mehrerer Häuser in einer Blockrandbebauung.
Steht am Anfang der Baumeisterhäuser die Kantonsverfassung von 1831, so ist es das mit der ersten Eingemeindung 1893 in Kraft tretende kantonale «Baugesetz für Ortschaften mit städtischen Verhältnissen», das das Ende der Baugattung besiegelt. Nun durfte ohne gültigen Quartierplan nicht mehr gebaut werden, was dem ungeregelten Erstellen einzelner Häuser ein Ende setzte.[4] Die grossflächige Erschliessung durch das kommunale Strassennetz förderte grössere, einheitliche Überbauungen durch Terraingesellschaften und andere potente Investoren. Schon das kantonale Baugesetz von 1863, vor allem aber das von 1893 schrieben grössere Abstände für die offene Bebauung vor und erleichterten andererseits in Geschäfts- und Industriequartieren das Zusammenbauen. Das förderte eine klare Aufteilung der Stadt in dichte Gebiete mit Blockrandbebauung und in locker bebaute und durchgrünte bürgerliche Wohnquartiere. In Letzteren wurden gewerbliche Nutzungen immer öfter verboten. Das Stadtgebiet wurde damit funktional, typologisch und sozial aufgeteilt. Für das Baumeisterhaus mit seiner gemischten Nutzung und seiner gemischten Bewohnerschaft blieb da kein Platz mehr. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu Ersatzneubauten durch dichtere Blockrandbebauung.
Innen flexibel, aussen offen zur Stadt
Durch ihre quasiserielle Herstellung, das Ausnutzen der baugesetzlich erlaubten Spielräume und wegen des Fehlens von individuellen, repräsentativen Ansprüchen sind sich die Baumeisterhäuser typologisch alle recht ähnlich. Varianten bestehen bei der Grösse, den Anbauten und beim Innenausbau. Im Erdgeschoss befanden sich oft Gewerberäume, Läden oder Gaststätten. Seitlich oder rückwärtig angebaute Werkstätten und Lager sind ein weiteres häufiges Kennzeichen. Die Geschosswohnungen zeichnen sich durch eine kluge Raumaufteilung aus. Sie verfügen über einen rechteckigen Grundriss und regelmässig befensterte Fassaden. Die Zimmer sind meist von gleicher Grösse und daher flexibel verwendbar. Häufig ist ein Zimmer direkt vom Treppenhaus her zugänglich, was die Aufnahme von Untermietern vereinfachte. Die Wohnräume sind nicht riesig, aber gut proportioniert, nicht lichtdurchflutet, aber hell dank Fenstern auf allen vier Seiten.
Auffällig sind die grossen städtebaulichen Qualitäten: Die frei stehenden Häuser erlauben Durchblicke, mit ihren Anbauten schaffen sie vielfältig nutzbare Zwischenräume. Bis heute findet man darin gewerbliche Nutzungen, die für die Quartiere identitätsbildend sind. Viele Erdgeschosse sind auf die Strasse und die Passanten orientiert und wirken einladend. Die enge Nachbarschaft der Bauten und die Vielfalt der rückwärtigen Zwischenräume, die oft weder ganz privat noch ganz öffentlich sind, bereichern die Stadtstruktur. Damit sind Baumeisterhäuser – vor allem im Ensemble – eine urbane Typologie, die wertvolle räumliche und soziale Beiträge an einen lebendigen öffentlichen Stadtraum leistet.
Handwerk und Industrie
Die Materialien zeugen von der traditionellen Handwerkskunst des 19. Jahrhunderts und von den Anfängen der Bauteilindustrie. Sie sind von so hoher Qualität, dass sie anderthalb Jahrhunderte oft gut überdauert haben. Die Wände der Wohnräume bedeckten halb- oder deckenhohe Holztäfelungen, Tapeten und Einbauschränke. Küchen- und Korridorböden wurden mit industriell hergestellten, bunt gemusterten Zementfliesen belegt (vgl. äusseres Titelbild). In den Zimmern waren breite Holzdielen oder Eichenparkett im Fischgräten- oder Kassettenmuster verlegt. An den Decken fanden sich Stuckmotive aus Katalogen. Zimmerund Wohnungstüren waren mit geätzten Glasscheiben gefüllt. Die Ausstellung im Baugeschichtlichen Archiv Zürich zeigt solche Originalbauteile; sie stammen aus Häusern an der Seefeldstrasse, die letztes Jahr abgebrochen wurden, und aus dem Bauteillager der kantonalen Denkmalpflege.
Die Häuser waren anfänglich dicht bewohnt, meist gab es mehr Menschen als Zimmer. Der Ausbaustandard war schlicht: Wasser vom Brunnen, Plumpsklo auf dem Treppenabsatz, Zimmeröfen zum Heizen, Einfachverglasung mit Vorfenstern, die im Sommer durch Klappläden ersetzt wurden. Kanalisationsleitungen, fliessend Wasser und Gas wurden erst ab etwa 1870 verlegt, Strom um 1900.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden im Baugewerbe noch traditionelle Konstruktionstechniken angewandt. Der Bauprozess war kaum mechanisiert. Baumeister und Handwerker errichteten die Häuser mit einfachen Techniken und traditionellen Baumaterialien von Hand. Ab der Jahrhundertmitte entstanden jedoch Fabriken, die Baumaterialien herstellten und diese mittels Katalogen und per Eisenbahn vertrieben. Auch in Zürich boten erste Grossziegeleien, Ofen- und Fensterfabriken sowie Produzenten von Sanitärteilen Produkte an, die zunehmend standardisiert und maschinell hergestellt waren. Solche Bauteile wurden in den Baumeisterhäusern verwendet. Sie sind von guter Qualität. Wenn sie gepflegt worden sind, erfüllen sie ihre Aufgaben auch nach 150 Jahren noch und verleihen den Räumen einen spezifischen, handwerklich-frühindustriellen Charme.
Ein Beispiel für die einfachen Techniken ist eine Kellerlüftung, die in mehreren Baumeisterhäusern anzutreffen ist: Eine Kelleröffnung ist aussen vergittert, das Fenster ist innen angeschlagen. Zwischen Gitter und Fenster führt ein in der Mauer eingelassener Kanal senkrecht bis zu einer Öffnung über dem Kellerboden. Durch diesen Kanal fällt nachts und im Winter immer etwas kalte und deshalb trockene Luft in den Keller, dort erwärmt sie sich auf die Temperatur der Mauern und des sie umgebenden Erdreichs und nimmt dabei Feuchtigkeit auf. Wo das simple System nie verschlossen wurde, sind die Keller bis heute trocken.
Baumeisterhäuser im Nachhaltigkeitstest
Wie nachhaltig ist der Erhalt eines Baumeisterhauses? Um dies zu prüfen, liess das Amt für Städtebau die Immobilienberatungsfirma Wüest & Partner ein kaum umgebautes und ein denkmalgerecht erneuertes Haus auf ihre Nachhaltigkeit hin überprüfen (Abb. 7 8). Beide schnitten überdurchschnittlich gut ab. Nur bei den Merkmalen «Konstruktion, Materialien, Technik» und «Energie, Ökologie, Wasser» wies das unrenovierte Haus deutliche Schwächen auf. Am renovierten Haus zeigte sich aber, dass diese Mängel bereits mit einer zurückhaltenden Erneuerung behoben werden können. Das gute Ergebnis rührt daher, dass die Merkmale der Baumeisterarchitektur weitgehend heutigen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen: Sie befinden sich an zentralen Lagen mit guter Infrastruktur, und dank flexiblem Grundriss und guter Bausubstanz haben sie eine zukunftstaugliche Grundstruktur, die ohne tiefe Eingriffe auf heutige Standards gebracht werden kann.
Gattung unter Druck
Die Zürcher Baumeisterhäuser sind in Gefahr. Ein grosser Teil ist schon verschwunden, gerade in den letzten Jahren wurden viele durch Neubauten ersetzt. Immerhin noch etwa 600 finden sich auf Stadtgebiet (vgl. Abb. 5). Wegen der verschärften Energieanforderungen sind viele sanierungsbedürftig. Sie liegen meist in Zonen, die eine höhere bauliche Dichte erlauben. Deshalb lastet auf ihnen ein grosser Erneuerungsdruck. Wie will die städtische Denkmalpflege darauf reagieren? Laut deren Leiterin, Karin Dangel, steht die Strategie noch nicht fest. Aus denkmalpflegerischer Sicht wäre eine Ergänzung des Inventars der schützenswerten Bauten wünschbar. Die Denkmalpflege habe den Auftrag, das Inventar periodisch zu überprüfen und bei neuen Erkenntnissen Ergänzungen vorzunehmen. Der Umgang mit den Baumeisterhäusern müsse jedoch mit der laufenden Revision der Bau- und Zonenordnung koordiniert werden. Diese Aussage deutet darauf hin, dass sich der heute schon bestehende Zielkonflikt zwischen der nötigen Verdichtung nach Innen und dem Erhalt von Bauzeugen bald noch verschärfen dürfte.
Reservoir für die Zukunft
Gerade am Fall der Baumeisterhäuser lässt sich aber gut argumentieren, dass der Erhalt von Bauzeugen nicht nur aus kompensatorischen Gründen wichtig ist. Ensembles von Baumeisterhäusern sind mehr als nur idyllische Oasen der Ruhe in der Hektik der Stadtentwicklung. Als multifunktionale Bauten für eine sozial durchmischte Bewohnerschaft mit starken Beiträgen an die räumliche Qualität der städtischen Umgebung stellen sie geradezu ein Lehrmittel für verdichtetes Bauen dar. Niemand kann heute behaupten, zu wissen, wie Häuser und Quartiere künftig gestaltet werden müssen, damit eine höhere Dichte Akzeptanz findet. Da ist es gut, im Genpool der historischen Artenvielfalt Beispiele zu finden, an denen sich bewährte Qualitäten untersuchen lassen, die dann für heutige Bauaufgaben übersetzt werden können. Die Baumeisterhäuser bilden ein Reservoir an städtebaulichen Prinzipien und an einfachen Materialien und Bautechniken, die sich 150 Jahre lang bewährt haben – notabene schon, als es noch kein Erdöl gab und die Ressourcen ebenfalls knapp waren. Sie können damit als Pool bewährter kultureller Praktiken für das Bauen im postfossilen Zeitalter dienen. Damit weisen sie nicht nur auf die Stadt von einst, wie Stadtrat André Odermatt im Vorwort der Publikation schreibt, sondern können auch Inputs für deren Zukunft liefern.
Deshalb gehören sie ins Portfolio der Denkmalpflege, wie Patrick Gmür, Direktor des Amts für Städtebau, in der Einleitung schreibt: «Den bisher verkannten Häusern, die immer mehr unter Erneuerungsdruck stehen, gebührt mehr Anerkennung.» Schützenswert scheinen vor allem Ensembles aus mehreren Baumeisterhäusern, da so sichtbar bleibt, dass sie von einer Etappe der Stadterweiterung zeugen und da ihre aussenräumlichen Qualitäten in der Gruppe besonders gut spürbar sind – was nicht heisst, dass gut erhaltene Einzelbauten nicht auch schutzwürdig sein können.
Anmerkungen:
[01] Angaben zur Typologie des Baumeisterhauses beruhen, wo nicht anders angegeben, auf der erwähnten Publikation
[02] Hanspeter Rebsamen: Carl Ferdinand von Ehrenberg, 1806–1841. Der Gründer des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins und sein Wohnhaus in Zürich, in: Unsere Kunstdenkmäler 1/1963, S. 13
[03] Vgl. dazu auch Hans-Peter Bärtschi: Industrialisierung, Eisenbahnschlachten und Städtebau – die Entwicklung des Zürcher Industrie- und Arbeiterstadtteils Aussersihl. Basel, 1983, S. 263 f.
[04] Daniel Kurz: Die Disziplinierung der Stadt. Moderner Städtebau in Zürich 1900 bis 1940. Zürich, 2008, S. 42TEC21, Fr., 2011.10.21
21. Oktober 2011 Ruedi Weidmann, Nathalie Cajacob
Roldie Eisenbahn und der Schweizer Holzstil
Der Schweizer Holzstil kam im 19. Jahrhundert in Mode. Nach 1900 war die «Laubsäge-Architektur» verpönt. Heute ist sie bei historischen Hotels wieder beliebt. Bisher kaum untersucht wurden die engen Bezüge zwischen dem Bau der Eisenbahnen und der Verbreitung dieses merkwürdigen Stils, der internationalen Kulturaustausch und industrielle Vorfertigung mit traditioneller Ikonografie und patriotischen Gefühlen verband.
Der Schweizer Holzstil hat viele Namen: Schweizerstil, Schweizerhausstil, Schweizerhäuschenstil, Chaletstil, Laubsäge(li)-Architektur usw. Er kommt nicht nur in der ganzen Schweiz vor, sondern auch im Ausland, vor allem in Skandinavien und Osteuropa. Seine Wurzeln liegen in der Mythologisierung des einfachen Lebens der Schweizer Bergbauern in der Romantik des 18. Jahrhunderts durch Denker wie Jean-Jacques Rousseau oder Architekten wie Eugène Viollet-le-Duc. Entwickelt wurde der Stil von akademischen Architekten in Deutschland, Frankreich und England. Sie bauten die ersten «Chalets suisses» oder «Schweizerhäuser» im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert in den Parks europäischer Fürsten und Könige, so etwa Karl Friedrich Schinkel in den 1830er-Jahren in Potsdam.[1]
Internationales akademisches Konstrukt
Der Schweizer Holzstil ist ein internationaler Stil ohne Regionalismen und gehört zum Historismus (im Unterschied zu dem um 1900 aufkommmenden Heimatstil, der zur nachhistoristischen Reformarchitektur gehört und mit Vorliebe Regionalismen aufnimmt[2]). Er basiert zwar auf dem Studium von Berner Oberländer und Waadtländer Holzhäusern, doch wurden deren Formen weitgehend abgewandelt und mit dem Klassizismus verschmolzen.[3] Architektur- lehr- und Musterbücher, die in den 1820er-Jahren aufkamen und zur Verbreitung des Stils beitrugen, zeigten eine wachsende Fülle an Formen.
Von den europäischen Akademien und Fürstenhöfen gelangte der Stil seit den 1830er- Jahren auch in die Schweiz und wurde zunächst für Villen und vor allem am Genfersee verwendet. Als um 1854 der Eisenbahnbau einsetzte, entwarfen die Architekten der Bahngesellschaften viele Bahnbauten im Schweizer Holzstil, und um 1860 wurde er in allen Landesgegenden für Hotelbauten beliebt. Bei der Datierung, der Verbreitung und einer möglichen Periodisierung besteht in der spärlichen Literatur jedoch viel Unsicherheit. Der Schweizer Holzstil zeichnet sich in der Regel durch klassizistische Gliederung und Proportionierung der Baukörper, feingliedrige Holzkonstruktionen und reiches Holzdekor aus. Letzteres orientiert sich an alpin-bäuerlichen und an klassischen Vorlagen. Es ist nicht wie in der traditionellen Holzarchitektur aus konstruktiven Bauteilen herausgearbeitet, sondern besteht aus ausgesägten Brettern, die an die Konstruktion genagelt oder geleimt wurden. Konstruktion und Dekor wurden nach standardisierten Mustern und Massen vorgefertigt und vor Ort nur noch montiert. Einige «Chalet-Fabriken» stellten Dekor und ganze Häuser industriell her und vertrieben sie über Kataloge. Man trifft aber auch auf gemauerte Häuser oder Fachwerkbauten mit Holzstildekor, die dann als spätklassizistischer Historismus mit hölzernem Zierwerk bezeichnet werden können.
Die Rolle der Eisenbahn
Während die Bedeutung der Hotelarchitektur und der Chalet-Fabriken bei der Verbreitung des Schweizer Holzstils schon verschiedentlich gewürdigt wurde[4], scheint die wichtige Rolle, die die Eisenbahn spielte, bisher übersehen worden zu sein. Dass es Bahnhöfe und Güterschuppen im Schweizer Holzstil gab, wird in der Literatur erwähnt, doch der Zusammenhang zwischen dem Bahnbau und der landesweiten Verbreitung des Holzstils ist bisher nicht untersucht worden. Dabei sind die Bezüge vielfältig, und es läge viel schönes Material bereit.
Eine nationale Architektur für die Bahnen
Der Bau der Eisenbahnen setzte in der Schweiz verspätet ein. Ab 1854 begannen jedoch zahlreiche Bahngesellschaften in heute kaum mehr vorstellbarem Tempo und in wildem Konkurrenzkampf Strecken zu bauen. Neben Ingenieuren für den Trasseebau stellten sie auch Architekten an, die sich um die nötigen Hochbauten kümmern mussten. Oft wurden sie aus Deutschland geholt, wo sie bereits Erfahrungen im Bahnbau gesammelt hatten.
Bei der Planung der ersten Bahnhöfe stellte sich den Bahngesellschaften und ihren Architekten die Frage, welcher Baustil für diese neue Art von Gebäuden angemessen war. «Der Baustil soll einfach und bescheiden, aber solid, anständig und des Gegenstandes würdig, überall sparsam, aber nirgends ärmlich sein», empfahl 1843 Friedrich Eisenlohr, Architekt der Grossherzoglich Badischen Eisenbahn, die in der Schweiz stark beachtet wurde.[5]
Dieses Konzept kam den Bahngesellschaften, die immer in Geldnot waren, entgegen. Im jungen Bundesstaat stellte sich aber auch die Frage nach einer nationalen Architektur.[6] Die Bahngesellschaften profitierten unmittelbar davon, dass mit der Staatsgründung von 1848 aus dem Konglomerat der vorher faktisch unabhängigen Kantone ein Bundesstaat wurde.
Vier Jahre nach der Staatsgründung erliess das Bundesparlament das Eisenbahngesetz. Es übertrug die Konzessionshoheit zwar den einzelnen Kantonen, doch legte es für die Konzessionserteilung landesweit geltende Regeln fest und schuf damit die Voraussetzung für einen zügigen Ausbau des Bahnnetzes. Die Bahngesellschaften wollten diese existenzielle Verbundenheit mit dem nationalen Gedanken, aber auch ihre überregionalen territorialen Ansprüche in ihren Bauten ausdrücken. Sie suchten dafür eine landesweit gültige, nationale Architektur, die bis dahin nicht existiert hatte. Johann Georg Müller, Architekt der Zürich-Bodensee- Bahn, schrieb dazu: «Eine jede Bahnlinie sollte in ihren Gebäulichkeiten einen veredelten Ausdruck der im Lande üblichen Bauweise enthalten, deshalb war es vor allem mein Bestreben, den verschiedenen Compositionen in ihrem Äusseren einen nationalen Charakter zu verleihen. So wird neben der Befriedigung der praktischen Bedürfnisse – die allerdings stets zuerst im Auge behalten wurden – auch vorteilhaft auf die Wiederbelebung einer nationalen Bauweise im Volke hingewirkt.»[7] Dafür bot sich der Schweizer Holzstil an.
Normierte Holzstilbahnhöfe
Um schneller vorwärtszukommen, entwarfen die Bahnarchitekten Normpläne, die als Vorlagen für Zwischenstationen und Nebengebäude immer wieder verwendet wurden. So schufen etwa der Architekt Ludwig Rudolf Maring aus Basel und der deutsche Ingenieur Friedrich Wilhelm Pressel 1854 zusammen für das gesamte Streckennetz der Schweizerischen Centralbahn (SCB) «Normalpläne» – im Schweizer Holzstil (Abb. 4). Sie entwarfen Hochbauten für drei Klassen von Bahnhöfen, unterschieden nach Grösse, Zahl und Gestaltung der Gebäude, die je nach Bedeutung einer Station ausgeführt wurden. Die Standardisierung ermöglichte Zeitgewinn und Kosteneinsparungen durch die Vorproduktion normierter Bauteile und durch routinierte Abläufe bei der Montage, diente aber auch der Betriebssicherheit: Bahnbeamte fanden sich so auf allen Stationen zurecht. Nur an wichtigen Stationen wurden spezielle Bauten entworfen und die Pläne den lokalen Behörden vorgelegt. Diese grösseren Aufnahmegebäude der ersten Generation wurden meist in einem sachlichen Spätklassizismus errichtet, der für die republikanischen Tugenden der Zweckmässigkeit und der Einfachheit stand.[8]
Praktisch alle Schweizer Bahngesellschaften verwendeten den Schweizer Holzstil für kleine und mittelgrosse Aufnahmegebäude und noch häufiger für Güterschuppen, Remisen und kleine Nebengebäude wie Aborte oder Wärterbuden. Er eignete sich nicht zuletzt, weil seine leichten Holzkonstruktionen günstig waren, rasch gebaut und bei Bedarf auch gut demontiert, transportiert und erneut aufgebaut werden konnten. Wie Maring für die SCB schufen die Architekten Jakob Friedrich Wanner für die Nordostbahn, Conrad Bär für die Schweizerische Nationalbahn und die Tösstalbahn sowie Johann Jenzer für die Bernischen Staatsbahnen solche Normpläne und verwendeten den Schweizer Holzstil. Dasselbe galt für die Bahngesellschaften in der französischen Schweiz. Viele dieser Bauten wurden später durch grössere ersetzt oder mussten Erweiterungen der Gleisanlagen weichen. Bis heute überlebt haben am ehesten die Güterschuppen. Bahnhofgebäude nach Marings Plänen existieren noch an den einstigen SCB-Linien Basel–Olten (vor allem an der alten Hauensteinlinie[9]), Olten–Luzern, Olten–Bern und Bern–Thun. In Urtenen-Schönbühl BE an der alten Linie Olten–Bern hat die Gemeinde Marings Aufnahmegebäude von 1865 (eine Variante des Typs zweiter Klasse mit angebautem Güterschuppen) samt einer Remise von 1873 und einem Dienstgebäude von 1895 gekauft und mithilfe der SBB-Fachstelle für Denkmalschutzfragen sorgfältig restaurieren lassen. Dabei wurden sogar verloren gegangene Verzierungen rekonstruiert (Abb. 7, 8).[10] Ein Glücksfall ist auch die wiedergefundene Perronhalle von Marings erstem Basler Bahnhof (Abb. 1–3).
Nachahmer am Bahnhofplatz
Als modernster Bau im Ort und neuer Pol der Siedlungsentwicklung hatte der Bahnhof Vorbildwirkung. Die vielen Bahnhöfe im Schweizer Holzstil fanden bald Nachahmer, oft in Bahnhofsnähe oder durch Bauherrschaften, die mit der Bahn oder dem nun wachsenden Reiseverkehr zu tun hatten. Der Schweizer Holzstil wurde rasch beliebt, besonders für Gastwirtschaften am Bahnhofplatz, aber auch für Hotels, Gewerbebauten, Einfamilienhäuser und Kleinbauten. In den Jahren nach der Staatsgründung war Nationalismus die Gesinnung der Stunde, im Schweizer Holzstil konnte er sich ausdrücken. Durch den häufigen Einsatz in allen Landesteilen trugen die Bahngesellschaften dazu bei, den Stil schweizweit zu verbreiten.
Sie bauten vereinzelt auch Wohnhäuser für ihre Angestellten oder unterstützten diese bei Bauvorhaben mit Baukrediten, der Abgabe von Bauland und Plänen aus dem Baubüro der Bahn – auch im Schweizer Holzstil. Wenn auf den Bahnhöfen neue Hochbauten nötig wurden, griffen sie bis zur Jahrhundertwende auf die Normalien der 1850er-Jahre zurück, und auch nach der Verstaatlichung der Bahnen erstellten die SBB von 1902 bis zum Ersten Weltkrieg noch neue Nebengebäude im Schweizer Holzstil (vgl. Abb. 6 und inneres Titelbild).
Verdammt und wiederentdeckt
Der Schweizer Holzstil war keine kurze Mode, sondern von etwa 1830 bis 1914 ein valabler Baustil für mannigfache, namentlich moderne Bauaufgaben wie Bahnbauten, Hotels und Einfamilienhäuser. Um 1900 begann eine Kampagne, die bald vom 1905 gegründeten Heimatschutz getragen wurde, die den Schweizer Holzstil als unschweizerisch und industriell verfemte und stattdessen den Heimatstil propagierte. Auch den Verfechtern der architektonischen Moderne ab den 1920er-Jahren galt die «Laubsägeli-Architektur» oder «Zimmermannsgotik » als dekorativ überladen, unecht und verlogen, und sie führten die Kampagne des Heimatschutzes bis nach dem Zweiten Weltkrieg fort. Die Ablehnung war derart tief, dass bis in die 1970er-Jahre zahlreiche Grandhotels – zum Teil mit staatlicher Hilfe – abgebrochen oder purifiziert wurden.[11] Diese «Verfolgung» wirkt bis heute nach. Noch immer ist das Verständnis für den Wert von Bauten im Schweizer Holzstil nicht überall vorhanden.
Pionierarbeit geleistet haben die Autorinnen und Autoren des Insa[12], die deren Bedeutung erkannt haben. Im Bereich der Hotelarchitektur haben einige Publikationen und die Icomos- Initiative «Historisches Hotel des Jahres» zur Rehabilitierung und zur Rettung verbliebener Häuser beigetragen. Die SBB haben die Bedeutung ihrer Bauten im Schweizer Holzstil erkannt und versucht, wo es geht, die Landstationen und die Laubsägeli-Güterschuppen zu erhalten und für Läden oder Velostationen zu nutzen. Bei der öffentlichen Denkmalpflege ist der Wert des Schweizer Holzstils heute theoretisch wohl unbestritten. Doch ist diese Wertschätzung offensichtlich noch nicht bis in alle Gemeinden gedrungen.
Gefährdete Bahnhofrestaurants
Während Kleinbauten im Schweizer Holzstil wie Kioske meist längst verschwunden sind (Abb. 13, S. 28) und Hotels und einzelne Gewerbebauten per Zufall überlebt haben, sind vor allem Einfamilienhäuser und bahnhofnahe Gasthäuser erhalten geblieben. Hier trifft man jedoch auf unterschiedliche Zustände. So ist etwa das 1863 erbaute ehemalige Restaurant «Helvetia» an der Zuchwilerstrasse 40 in Solothurn (Abb. 9) zwar im Insa (Bd. 9, S. 207) und in den Kunstdenkmälern der Schweiz (Bd. 113, S. 278) verzeichnet, es wird aber gegenwärtig ohne Baueingabe und damit ohne Wissen der Denkmalpflege renoviert.
In Horgen ZH demonstriert am Bahnhof Horgen-Oberdorf das gut unterhaltene ehemalige Restaurant Bahnhof als «Chalet India», dass sich der Schweizer Holzstil auch als Kulisse für asiatische Gastrokultur eignet. Die kantonale Denkmalpflege hat 1980 die Renovation des Gebäudes unterstützt, seither ist es geschützt (Abb. 13). Bei der Station Sihlbrugg am anderen Ende des Zimmerbergtunnels steht hingegen das Restaurant Waldhaus von 1897 seit Jahren leer und verfällt (Abb. 14). Es ist ein Bau von Jacques Gros, Erbauer des Grand Hotel Dolder in Zürich und einer der bekanntesten und erfolgreichsten Vertreter des Schweizer Holzstils.
Forschungsdesiderate
Solche Verluste müssten nicht sein. Wenn bei Bauten im Schweizer Holzstil konkrete Bezüge zu einem Bahnhof oder einer Bahngesellschaft feststellbar sind, können sie innerhalb einer Gemeinde als Ensemble betrachtet werden, auch wenn sie nicht nebeneinander stehen. Dann sind sie, abgesehen von ihrer architektonischen Qualität, sozial- und wirtschaftshistorische Zeugen für die Rolle, die einige wenige, aber wirkungsmächtige private Bahngesellschaften für die Architekturgeschichte der Schweiz spielten. Eine vertiefte Untersuchung der Verbindung von Bahnbau und Schweizer Holzstil könnte dessen Einschätzung erneut verändern.
Die Kunsthistorikerin Dorothee Huber bezeichnet ihn als damals «gleicherweise traditionsverbundene wie zeitgemässe Stilform».[13] Die Bauherren dieser Häuser waren nicht etwa heimattümelnd rückwärtsgewandte Menschen, sondern im Gegenteil Leute, die sich von der technischen Entwicklung gesellschaftlichen Fortschritt versprachen. Der Schweizer Holzstil steht damit für eine spezifische Verbindung von Industrie und Tradition, von Technik und Natur, von internationalem Kulturaustausch und Patriotismus bzw. Nationalismus im Denken des 19. Jahrhunderts. Im Grunde fehlt ein Grundlagenwerk über den Schweizer Holzstil in der Art, wie es Elisabeth Stürzel-Crettaz für den Heimatstil geschaffen hat.[14] Es müsste die ideologische Mischung im Denken der Entwerfer und der Besteller dieser Bauten untersuchen, die konkreten Bezüge zwischen dem Bahnbau und dem Bau von Holzstilbauten erfassen, die Mechanismen der Ausbreitung aufzeigen, den Zusammenhang zwischen der Möglichkeit des Bahntransports und der Industrialisierung im Bauwesen berücksichtigen, eine genauere Periodisierung versuchen – und natürlich ein Objektinventar anlegen.
Anmerkungen:
[01] Roland Flückiger-Seiler: Hotelpaläste zwischen Traum und Wirklichkeit. Schweizer Tourismus und Hotelbau 1830–1920. Baden, 2003, v. a. S. 22
[02] Elisabeth Stürzel-Crettaz: Heimatstil – Reformarchitektur in der Schweiz 1896–1914. Frauenfeld, 2005, S. 30–40
[03] Eugen Huwyler: «Klischees und Ideologien – Vom alpinen Blockbau zum ‹chalet suisse›» in: Heimatschutz 1/2004, S. 8–10
[04] Wie Anm. 1, S. 21–23, sowie: Heinrich Christoph Affolter: Die Bauernhäuser des Kantons Bern: Das höhere Mittelland. Bern, 2001, S. 409–411
[05] Zitiert nach Werner Stutz: Bahnhöfe der Schweiz. Zürich, 1983, S. 63
[06] Dorothee Huber: «Das Bauwerk in der Landschaft» in: Die obere Hauensteinlinie –Bahnbauten seit 1853. Zürich, 2009, S. 9–16
[07] Wie Anm. 5, S. 62
[08] Wie Anm. 6
[09] Die obere Hauensteinlinie – Bahnbauten seit 1853. Zürich, 2009
[10] Denkmalpflege des Kantons Bern: Berichte 1979–2004, Gemeinden J–Z. Zürich, 2011, S. 183–186
[11] Wie Anm. 1, S. 24–27
[12] Insa: Inventar der neueren Schweizer Architektur 1850–1920. Hrsg. von der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK. Bern, 1982–2004
[13] Wie Anm. 6, S. 12
[14] Wie Anm. 2
[15] Michael Hanak: «Stadtentwicklung um den Bahnhof Aarau» in: Michael Hanak, Hannes Henz, Ruedi Weidmann: Bahnhof Aarau – Chronik eines Baudenkmals. Zürich, 2011, S. 61–93
[16] Michael Hanak, Hannes Henz, Ruedi Weidmann: Bahnhof Aarau – Chronik eines Baudenkmals. Zürich, 2011TEC21, Fr., 2011.10.21
21. Oktober 2011 Ruedi Weidmann