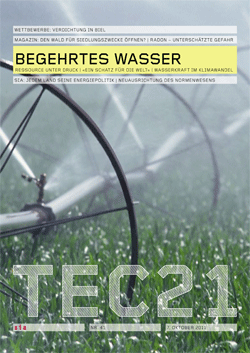Editorial
Die Verfügbarkeit von Wasser in ausreichender Menge und guter Qualität ist in den meisten Regionen der Schweiz bisher weitgehend selbstverständlich. Kurze Phasen, in denen sich das ändert – wie der Hitzesommer 2003, als die Grundwasserspiegel deutlich absanken, oder das vergangene Frühjahr, als Wasserkraftwerke eingeschränkte Produktion meldeten –, geraten in der Öffentlichkeit bald wieder in Vergessenheit. Allerdings genügt ein Blick ins Wallis oder ins Münstertal, um zu sehen, was es bedeutet, wenn Wasser knapp ist. Die dortigen Suonen bzw. Auals, teilweise mit enormem Aufwand gebaut, waren als Flurbewässerungssysteme existenziell für die Landwirtschaft. Die Wasserentnahmen durch die beteiligten Bauern waren und sind teilweise bis heute genau geregelt. Verstösse wurden streng bestraft.
Viel drastischer ist die Situation schon heute für knapp zehn Prozent der Weltbevölkerung, die unter Wasserstress oder Wassermangel leiden. Im Jahr 2050 werden sich neun statt der heute knapp sieben Milliarden Menschen diese ungleich verteilte Ressource teilen müssen. Verschärft wird die Situation durch den Klimawandel. Der Artikel «Ressource unter Druck» zeigt, wofür heute in den verschiedenen Regionen der Welt wie viel Wasser benötigt wird, wo die Wasserressourcen bereits knapp sind oder es bald werden könnten und wo das grösste Sparpotenzial besteht.
Knappheit führt zu Konflikten um die Verteilung, nicht nur zwischen den Bevölkerungen verschiedener Regionen, sondern auch zwischen dem Bedarf des Menschen und jenem der Natur. Dabei bleibt Letztere oft auf der Strecke. So ist durch den zunehmenden Flächen- und Wasserbedarf der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert die Hälfte der weltweiten Feuchtgebiete verloren gegangen. Das Okavango-Delta in Botswana ist vom gleichen Schicksal bedroht.
Wolfgang Kinzelbach, Professor für Hydromechanik an der ETH Zürich, erläutert im Interview mit TEC21 die Ursachen dieses exemplarischen Konflikts und spricht über Lösungsmöglichkeiten.
Der Hitzesommer 2003 und das trockene Frühjahr 2011 liessen erahnen, dass der Klimawandel die Wasserverfügbarkeit auch in der Schweiz zum Thema machen könnte. Der Beitrag «Wasserkraft im Klimawandel» beleuchtet einen Teilaspekt davon: Er stellt die Ergebnisse einer Studie vor, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserkraftnutzung in der Schweiz beschäftigt.
Durch den Rückzug der Gletscher und die Abnahme der Niederschläge sind zumindest langfristig und im Süden der Schweiz Einbussen bei der Stromproduktion zu erwarten. Auch im verwöhnten Wasserschloss Schweiz könnte Wasser also zu einer begehrten Ressource werden.
Claudia Carle
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Verdichtung in Biel
12 MAGAZIN
Den Wald für Siedlungszwecke öffnen? | Ämter und Ehren | Radon – die unterschätzte Gefahr | Fledermausverstecke fördern | Das versunkene Tal | Wasser – in Kürze
22 RESSOURCE UNTER DRUCK
Mirella Judith Wepf
Massnahmen gegen den zunehmenden Wassermangel müssen vor allem bei der Bewässerungslandwirtschaft und der Industrie – den grössten Verbrauchern – ansetzen.
26 «DAS OKAVANGO-DELTA IST EIN SCHATZ FÜR DIE WELT»
Claudia Carle, Daniela Dietsche
Beim Okavango-Delta in Botswana, einem der grössten und tierreichsten Feuchtgebiete Afrikas, zeigt sich exemplarisch der sich weltweit verschärfende Konflikt um Wasser.
32 WASSERKRAFT IM KLIMAWANDEL
Lukas Denzler Laut einer neuen Studie dürfte sich der Klimawandel in der Schweiz bis 2050 weniger dramatisch auf die Stromproduktion auswirken, als noch vor einigen Jahren befürchtet wurde.
38 SIA
Jedem Land seine Energiepolitik | Neuausrichtung des Normenwesens | Risikostoffe in Gebäuden
44 FIRMEN
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Ressource unter Druck
Knapp 10% der Weltbevölkerung leiden heute unter Wassermangel. Das Bevölkerungswachstum, der steigende Lebensstandard und der Klimawandel werden diese Problematik noch deutlich verschärfen. Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen muss vor allem bei den mengenmässig grössten Verbrauchern, der Bewässerungslandwirtschaft und der Industrie, ansetzen.
Etwa 1.4 Mrd. km3 Wasser gibt es auf der Erde, jedoch nur etwa 3 % dieser Vorräte sind Süsswasser (Abb. 1). Davon sind wiederum zwei Drittel in Gletschern und Permafrostböden gebunden. Knapp ein Drittel sind Grundwasservorkommen, und nur ein minimaler Anteil befindet sich in Flüssen, Sümpfen und Seen. Auch davon ist nur ein Bruchteil für die Nutzung zugänglich: etwa 9000 bis 13 000 km[3].
Derzeit werden aus diesen Wasservorräten vom Menschen jährlich rund 4500 km3 für den Bedarf in Haushalt und Industrie sowie für die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen entnommen. Diese Durchschnittszahl sagt allerdings wenig über die lokal sehr unterschiedlichen Gegebenheiten aus.
Im Jahr 2000 lebten rund 500 Mio. Menschen in 31 Ländern mit Wasserstress (weniger als 1700 m³/Kopf und Jahr) oder Wassermangel (weniger als 1000 m³/Kopf und Jahr) (Abb. 4).[1] Bis zum Jahr 2025 könnten es bis zu 3 Mrd. Menschen in 48 Ländern werden. Die Gründe dafür liegen im anhaltenden Bevölkerungswachstum, in der Zunahme des Lebensstandards, im steigenden Wasserbedarf für Agrotreibstoffe sowie im Klimawandel. In zahlreichen Regionen werden die vorhandenen Wasserreserven schon heute stark übernutzt, sodass die natürliche Erneuerungsrate durch Regen und Zufluss die Wasserentnahme dort nicht mehr ausgleichen kann. Das führt zur Absenkung der Grundwasserspiegel oder geht zulasten der Wasserökosysteme, was sich im Austrocknen von Flüssen, Seen und Feuchtgebieten äussert (vgl. S. 26).
Die Folgen des Klimawandels
Niemand kann genau vorhersagen, wie sich die Klimaerwärmung weltweit auswirken wird. Dementsprechend operiert auch der Weltklimarat (IPCC) nur mit Szenarien. Sicher ist: Das wärmere Klima wird auch die Dynamik des Wasserhaushalts beeinflussen. Dabei können einige wenige Regionen kurzfristig eher profitieren, viele Regionen müssen sich hingegen schwierigeren Umständen anpassen (Abb. 5).
In einigen Teilen Sibiriens und Skandinaviens kann der Rückgang des Permafrosts neue landwirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen. Im Gegensatz dazu stellen einzelne australische Weinbauern bereits heute auf die Produktion von Datteln um, da diese weniger Wasser benötigen. Auch der Mittelmeerraum wird voraussichtlich stark in Mitleidenschaft gezogen werden.
Im Sommer muss man sich dort auf längere Hitzeperioden von mehr als sechs Wochen mit Durchschnittstemperaturen von über 35 °C einstellen. Auch beim Wasserangebot wird man sich auf Veränderungen einstellen müssen. Im östlichen Mittelmeerraum hat der IPCC-Bericht 2007 bereits eine deutliche Abnahme der Niederschlagsmengen festgestellt, im Westen gab es dagegen noch keine signifikanten Veränderungen.[2] In der Schweiz werden sich die Vor- und Nachteile möglicherweise die Waage halten. Ein Nationales Forschungsprogramm untersucht derzeit, welche Veränderungen durch den Klimawandel auf die Schweiz zukommen und wie sich mit den veränderten Rahmenbedingungen umgehen lässt (vgl. Kasten). Die Winter werden in der Schweiz voraussichtlich wärmer und feuchter, die Sommer heisser und trockner.[3] Daher untersuchen beispielsweise die Wasserkraftunternehmen, wie sich dies auf die Stromproduktion auswirken wird (vgl. S. 32). Ebenso müssen Strategien entwickelt werden, wie die Bauern, die im Wasserschloss Schweiz bisher mehrheitlich ohne künstliche Bewässerung wirtschaften konnten, künftig arbeiten sollen.
Der grösste Wasserfresser weltweit: die Landwirtschaft
Weltweit gehen 70 % des Wasserverbrauchs auf das Konto der Landwirtschaft (Abb. 3). Auch die Zunahme der Weltbevölkerung wird diesen Bedarf weiter ansteigen lassen, denn die Bewässerungslandwirtschaft ist deutlich ertragreicher als der Trockenfeldbau. Derzeit werden rund 20 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche bewässert; zwei Drittel davon befinden sich in Asien.[4] In zahlreichen Ländern, beispielsweise in Spanien oder Marokko, zeichnen sich bereits heute Engpässe bei der Wasserversorgung ab. In diesen Gebieten wird der Druck, die Felder effizienter zu bewässern, deutlich zunehmen. Heute geschieht dies grösstenteils über Kanalsysteme oder Beregnungsanlagen. Beide Verfahren sind relativ kostengünstig, aber ineffizient. Ein Grossteil des Wassers versickert oder verdunstet ungenutzt. Mit modernen Mikrobewässerungen könnte der Wasserverbrauch um 30 bis 70 % gesenkt werden. Die sparsamste aller Bewässerungsformen ist das Tröpfchenverfahren, bei dem das Wasser durch ober- oder unterirdisch verlegte Leitungen direkt dem Wurzelbereich der Pflanze zugeführt wird. Positiver Nebeneffekt dieser gezielten Dosierung: Das Auswaschen von Mineralien und die Versalzung des Bodens werden vermindert. Auch das Unkrautwachstum geht zurück. Dadurch reduziert sich der Pestizidverbrauch. Nebst den Bewässerungssystemen sind auch verbesserte Anbaumethoden ausschlaggebend, insbesondere bei Agrarprodukten, die besonders viel Wasser verbrauchen, wie Baumwolle und Reis. In diesem Bereich gibt es interessante Ansätze. So zeigten Versuche mit der ökologischen Reisanbaumethode «System of Rice Intensification (SRI)», dass der Ertrag um mehr als 30 % gesteigert werden kann, während sich der Wasserverbrauch um 40 % reduziert.[5] SRI beinhaltet nebst gezielter Bewässerung und organischer Düngung auch klare Anweisungen bezüglich Pflanzenabstand etc. Auch der Biolandwirtschaft wird von Experten eine zukunftsträchtige Rolle in Bezug auf die Schonung der Wasserressourcen zugesprochen. Die Verwendung umweltfreundlicherer Dünger und Pflanzenschutzmittel sowie die grössere Bodenbedeckung schützen das Grundwasser und vermindern Verdunstung sowie Oberflächenerosion.
Die Rolle der Industrie
Wasser ist auch für die Industrie von zentraler Bedeutung, sei es bei der Papierproduktion oder der Reifenherstellung, bei der Stromerzeugung oder beim Rohstoffabbau. In den Industrieländern hat sich der Wasserverbrauch der Industrie in den vergangenen 20 Jahren stabilisiert. Eine effizientere Wassernutzung kann also auch bei solidem Wirtschaftswachstum erreicht werden. Doch das darf nicht über die vorhandenen Probleme hinwegtäuschen: Obwohl weltweit gesehen die Landwirtschaft beim Wasserkonsum dominiert, ist in Europa und Nordamerika die Industrie mit einem Anteil von rund 50 % der grösste Wasserverbraucher (Abb. 3). Ausserdem nimmt in Entwicklungs- und Schwellenländern der Bedarf der Industrie rasant zu. Hinzu kommt, dass in aufstrebenden Ländern wie China viele Industrieunternehmen ihre Abwässer nach wie vor ungereinigt in die Flüsse leiten. Dadurch ist die Wasserqualität in vielen Städten dramatisch gesunken. Es sind daher überall zusätzliche Initiativen erforderlich, um die Effizienz des Wassereinsatzes in der Industrie zu steigern, zum Beispiel durch bessere Reinigung und möglichst geschlossene Kreisläufe.
Die Schweiz importiert Wasser aus Ghana
Industrie und Landwirtschaft dürfen jedoch nicht nur lokal betrachtet werden, denn die globalisierte Wirtschaft hat komplexe Folgen für den Wasserhaushalt. So zeigte der WWF 2010 in seiner Studie «Der Wasser-Fussabdruck der Schweiz»[6], dass die Schweiz ihren aktuellen Wasserbedarf nur zu einem Drittel aus eigenen Ressourcen deckt. Der Wasserverbrauch in den hiesigen Haushalten und in der Industrie ist zwar beständig gesunken, der Import von sogenanntem virtuellem Wasser aber enorm gestiegen. Damit ist die Menge an Wasser gemeint, die zur Herstellung von Produkten benötigt wird. Am meisten «virtuelles Wasser» importiert die Schweiz aus Ghana, einem wichtigen Kakaolieferanten, gefolgt von der Elfenbeinküste, Brasilien, Frankreich und Italien.
Damit hat die Schweiz nach Ansicht der Umweltorganisation auch eine ökologische und soziale Verantwortung, denn in einzelnen Regionen hat dieser Wasserexport starke negative Auswirkungen auf die Ökosysteme und die Bevölkerung. Die Handlungsempfehlungen des WWF zielen nicht in erster Linie auf die Konsumenten, sondern hauptsächlich auf die Regierungen und Unternehmen. Zu den Forderungen gehören beispielsweise gesetzliche Rahmenbedingungen, die angemessene Wassermengen in Grundwasser und Oberflächengewässern sichern, oder die genaue Erfassung und Analyse der Zulieferketten von Produkten durch die Unternehmen.
Ein Lichtblick: die weltweite Trinkwasserversorgung
Zumindest in einem Bereich der Wasserversorgung zeichnet sich jedoch ein positiver Trend ab: Ging man im Jahr 2000 von 1.2 Mrd. Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser aus, rechnet man heute noch mit rund 800 Mio.[8] Und das Uno-Millenniumsziel, den Anteil der Weltbevölkerung ohne Zugang zu hygienisch einwandfreiem Wasser bis 2015 zu halbieren, hält Wolfgang Kinzelbach, Professor für Hydromechanik an der ETH Zürich, für erreichbar. Dieser Optimismus hat zwei Gründe: Der Anteil des Trinkwassers am gesamten Süsswasserbedarf des Menschen ist gering. Er macht nur ein Promille aus. Eine ausreichende Trinkwasserversorgung ist daher weniger ein Problem der Wasserquantität als der Wasserqualität.
Zahlreiche Techniken zur Aufbereitung von Trinkwasser sind vorhanden und oft mit ökonomisch geringem Aufwand umsetzbar. So lohnt es sich beispielsweise bereits, das Wasser nicht direkt aus einem Fluss zu schöpfen, sondern in einigen Metern Abstand einen Brunnen zu graben und so zu gefiltertem Wasser zu kommen. Insgesamt scheinen die internationalen Entwicklungsbemühungen für besseres Trinkwasser zu fruchten. In zahlreichen Regionen sind weitere Fortschritte durchaus realistisch, solange die politischen Umstände Investitionen und die Vermittlung des nötigen Know-hows nicht verunmöglichen.
Anmerkungen:
[01] United Nations Population Fund (UNFPA), 2001: State of the World Population 2001
[02] Vierter Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (AR4): Klimaänderung 2007
[03] OcCC, 2008: Das Klima ändert – was nun? Der neue UN-Klimabericht (IPCC 2007) und die wichtigsten Ergebnisse aus Sicht der Schweiz. OcCC – Organe consultatif sur les changements climatiques, Bern
[04] FAO Statistical Yearbook, 2010
[05] Vgl. u.a. Wikipedia oder die Homepage der Cornell University in Ithaca, New York (USA), http://sri. ciifad.cornell.edu
[06] Sonnenberg, A., Chapagain, A., Geiger, M., August, D., und Wagner, W., 2010: Der Wasser-Fussabdruck der Schweiz: Woher stammt das Wasser, das in unseren Landwirtschaftsprodukten steckt? WWF Schweiz, Zürich
[07] www.fao.org/nr/aquastat
[08] www.un.org/millenniumgoals/environ.shtmlTEC21, Fr., 2011.10.07
07. Oktober 2011 Mirella Judith Wepf
«Das Okavango-Delta ist ein Schatz für die Welt»
Das Okavango-Delta in Botswana ist eines der grössten und tierreichsten Feuchtgebiete Afrikas. Die zunehmenden Wasserentnahmen für die Bewässerung von Landwirtschaftsflächen am Oberlauf in Angola und Namibia bedrohen aber seine Existenz. Wolfgang Kinzelbach, Professor für Hydromechanik an der ETH Zürich, forscht seit zehn Jahren im Okavango-Delta. TEC 21 sprach mit ihm über die Ursachen des Konflikts, der exemplarisch ist für die sich weltweit verschärfende Konkurrenz um Wasser.
Das Okavango-Delta im Nordwesten Botswanas ist ein Binnendelta mit einer Fläche von mehr als 15 000 km2. Gespeist wird es aus dem Okavango, der im Hochland von Angola entspringt und durch Namibia nach Botswana fliesst (Abb. 3, 4). Nach dem Durchlaufen des sogenannten Pfannenstiels trifft der Fluss auf eine flache, mit Sedimenten verfüllte Grabenstruktur, die eine südliche Fortsetzung des Afrikanischen Grabenbruchs (Rift Valley) ist (Abb. 2). Wegen des geringen Gefälles fächert er sich in unzählige Arme auf. Das Wasser im Delta verdunstet zum grössten Teil, sei es über die Wasserfläche oder nach Versickerung über die Pflanzen (Transpiration). Nur ein geringer Anteil fliesst durch den Thamalakane bei Maun ab. Dank dem ganzjährig Wasser führenden Zufluss ist das Innere des Deltas ein permanenter Sumpf, der nach der Regenzeit wegen der jährlichen Flutwelle des Okavango gewaltig anwächst (Abb. 5). Diese Welle braucht für die letzten 300 km im flachen Gelände von Mohembo bis Maun rund vier Monate. Deshalb reicht die Wasserverfügbarkeit im temporären Sumpf des Deltas bis weit in die Trockenzeit hinein und wird dadurch zum Anziehungspunkt für viele Tierarten. Entsprechend attraktiv ist das Gebiet für Touristen.
Die Landschaft des Deltas ist einem steten Wandel unterworfen. Einen grossen Anteil daran haben die Tiere, allen voran die Termiten. Im Windschatten ihrer Bauten lagern sich Staub und Laub ab. Daraus entstehen Inseln, auf denen Pflanzen wachsen können. Diese Inseln sind eine Art «Müllhalde» für das beim Verdunsten des Wassers anfallende Salz: Die Pflanzen auf den Inseln nehmen Wasser auf und verdunsten es, wobei sich das im Süsswasser in geringer Konzentration enthaltene Salz lokal ansammelt. Wird die Salzakkumulation zu gross, sterben die Pflanzen ab und wachsen am Rand der Salzinseln weiter. Dank diesem Mechanismus bleibt der Salzgehalt in den übrigen Bereichen des Deltas erstaunlich gering (Abb. 8).
TEC21: Herr Kinzelbach, was fasziniert Sie am Okavango-Delta?
Wolfgang Kinzelbach: Wer einmal das Okavango-Delta besucht hat, möchte immer wieder hin. Das Gebiet ist zwar nicht so spektakulär wie beispielsweise die Serengeti mit den grossen Tierherden, aber es gibt extrem viele interessante Prozesse zu beobachten. Ein Beispiel: Die kleinen Unterschiede in der Topografie führen zu einer faszinierenden Dynamik. Alte Kanäle füllen sich mit Sedimenten und lassen das Wasser neue Wege suchen. Durch Torfbrände bricht das Gelände teilweise ein, und neue Gräben entstehen. Elefanten werfen Bäume um, wodurch Kanäle verstopft werden und austrocknen. Flusspferde arbeiten sich wie Dampfwalzen durch Papyrus und Schilf und schaffen so neue Kanäle. Alle diese Phänomene führen dazu, dass jedes Jahr mit der Flut eine neue Wasserlandschaft entsteht.
TEC21: Wie schätzen Sie die globale Bedeutung des Deltas ein?
W. K.: Das Okavango-Delta ist ein Schatz für die Welt. Es ist eines der weltweit wichtigen Feuchtgebiete. Wir haben seit 1900 die Hälfte der Feuchtgebietsfläche auf der Erde verloren, entweder durch den Verlust der Fläche oder des Wassers an die Landwirtschaft. Und es werden aufgrund des Bevölkerungsdrucks und des Drucks auf die Nahrungserzeugung immer noch viele Feuchtgebiete zerstört. Die Ramsar-Konvention1 versucht den Trend zu stoppen, um die Artenvielfalt dieser Gebiete zu schützen. Das Okavango-Delta ist das grösste der Gebiete, die unter dem Schutz der Konvention stehen.
TEC21: Und trotzdem ist es gefährdet. Können Sie erläutern, worin diese Gefährdung im Einzelnen besteht?
W. K.: Das Delta liegt in Botswana. Wie viel Wasser das Delta erreicht, entscheiden aber die Anlieger des Oberstroms in Angola und Namibia. Dort reicht der traditionelle afrikanische Landbau2 wegen der wachsenden Bevölkerung nicht mehr aus, um genügend Nahrung zu produzieren. Hinzu kommt, dass sich Angola nach dem Kriegsende nun wirtschaftlich zu entwickeln beginnt und unabhängig werden möchte von Nahrungsimporten. Daher will man viel mehr Wasser als bisher für die Landwirtschaft aus dem Okavango entnehmen. Die Ausdehnung der Landwirtschaft könnte auch die Wasserqualität im Zufluss vermindern. Das Wasser im Okavango ist heute nährstoffarm (oligotroph). Wird Dünger ausgewaschen, könnte dies zu einer Eutrophierung des Deltas führen.
TEC21: Wie gut bekannt waren die hydrologischen und wasserwirtschaftlichen Verhältnisse in der Region, als Sie mit Ihrem Forschungsprojekt begannen?
W. K.: Viele der Phänomene waren bereits gut erforscht, vor allem durch eine Forschungsgruppe an der University of the Witwatersrand in Südafrika und das Okavango Research Institute der University of Botswana. Wir als Ingenieure versuchen, diese qualitativ bekannten Vorgänge mit Zahlen zu belegen. Wir haben zum Beispiel ein Modell entwickelt, um zu zeigen, wie sich das Delta aufgrund einer Wasserentnahme im Oberstrom verändern würde.
TEC21: Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
W. K.: Wir haben ermittelt, dass man etwa 58 m³ Wasser pro Sekunde bräuchte, um das gesamte bewässerungswürdige Land in Angola zu bewässern.3 Das ist mehr als die Hälfte der rund 100 m³/s, die der Okavango heute in der Trockenzeit führt. Unsere Modellierungen ergeben, dass man höchstens 15 bis 20 m³/s entnehmen sollte, um das Delta nicht irreversibel zu stören. Sonst werden die regelmässig überfluteten Flächen stark abnehmen, und an den Stellen, die nicht mehr jährlich überflutet werden, wird das für die Tiere wichtige Grasland von Bäumen verdrängt (Abb. 6).
TEC21: Gibt es neben der Wasserentnahme im Zufluss und der Eutrophierung noch weitere Gefährdungen für das Delta?
W. K.: Ja, im Oberstrom sind Staudämme zur Stromerzeugung geplant. Unsere Berechnungen zeigen aber, dass sie zu klein sind, um sich stark auszuwirken. Das Wasser wird nicht wie bei der Bewässerung dem Fluss entnommen, sondern fliesst nur verzögert ab, was lediglich die Abflussspitzen dämpfen wird. Problematischer ist, dass die Dämme das Sediment im Oberstrom zurückhalten. Wenn weniger Sediment in den Unterlauf gelangt, wird sich das Delta tiefer eingraben. Dies würde eine Verringerung der Dynamik im jährlichen Wandel bedeuten.
TEC21: Lässt sich abschätzen, wie sich die Klimaveränderung auf das Delta auswirken wird?
W. K.: Wir wissen heute noch zu wenig, um sichere Aussagen zu machen. Das Delta liegt nahe der innertropischen Konvergenzzone4, deren Ausdehnung nach Süden die Klimamodelle nicht gut vorhersagen können. Die Modellprognosen für die Temperatur sind recht einheitlich, beim Niederschlag hingegen, ergeben 12 Modelle 12 unterschiedliche Prognosen. 10 von 12 Modellen sagen voraus, dass es trockener wird. In diesem Fall wäre der Einfluss des Klimas vergleichbar mit dem durch die befürchtete Wasserentnahme für die Landwirtschaft. Die grösste Gefahr für das Delta ist, dass beides eintrifft.
TEC21: Zumindest die Wasserentnahmen liessen sich vermeiden oder reduzieren. Gibt es Bestrebungen zu einem Interessenausgleich zwischen Ober- und Unterliegern?
W. K.: Angola, Namibia und Botswana haben sich in der Okavango River Commission, der Okacom, zusammengeschlossen, um eine Lösung zu finden. Zurzeit werden umfassende Bestandesaufnahmen des Einzugsgebiets gemacht und Daten zur Landnutzung, zur Bevölkerungsentwicklung und zu den Zuflüssen erhoben. Unsere Forschungsergebnisse werden in die Diskussionen der Kommission einfliessen. Die Verantwortlichen werden sich zuerst über die allgemeine Entwicklung der Region einigen müssen. Anschliessend wird es leichter sein, über konkrete Zahlen zur maximal erlaubten Wasserentnahme zu verhandeln.
TEC21: Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie für diesen Konflikt?
W. K.: Ich habe nachgerechnet, ob Botswana nicht einen Teil des Einkommens aus dem Tourismus an Angola abgeben könnte, damit dieses einen genügend grossen Zufluss nach Botswana garantiert. Denkbar wäre auch, dass Botswana wassersparende Bewässerungssysteme in Angola subventioniert. Aber die Gewinne, die Angola mit einem Ausbau der Landwirtschaft erzielen kann, sind so gross, dass die Einkünfte aus dem Tourismus in Botswana dies nicht aufwiegen können. Relativ neu ist die Idee, die Region mit dem grenzüberschreitenden Projekt ‹Kavango-Zambesi Transfrontier Conservation Area›5 für den Tourismus zu entwickeln. Das Potenzial ist vorhanden, denn es gibt noch eine ganze Reihe anderer Naturreservate. Man müsste beispielsweise die Verkehrsverbindungen verbessern, um sie für Touristen attraktiv zu machen. Wenn jedes Land vom Tourismus profitiert, ist vielleicht das Interesse grösser, das Delta zu erhalten.
TEC21: Die Touristen im Okavango-Delta kommen grösstenteils aus Europa und den USA. Müssten nicht auch die industrialisierten Länder einen Beitrag zur Erhaltung des Deltas leisten? W. K.: Will man die Natur dort für die Weltgemeinschaft erhalten, dann müssen internationale Gelder fliessen. Für den einfachen Botswaner wäre es interessanter, das gesamte Land in Weidefläche für Rinder umzuwandeln. Man muss die ökologischen Dienstleistungen, die im Okavango-Delta erbracht werden, bewerten und mit Ausgleichszahlungen belohnen. Es geht dabei um die Erhaltung eines Weltnaturerbes und einen gleichberechtigten Interessenausgleich. Das ist nicht zu verwechseln mit Entwicklungshilfe. Das Delta zu erhalten, sodass die nächsten Generationen dieses faszinierende Feuchtgebiet noch sehen können, ist wichtig. Die Weltbevölkerung wird bis 2050 auf neun Milliarden ansteigen. Da bleibt wenig Platz für die Natur
TEC21: Der Konflikt zwischen genug Wasser für die Menschen und genug Wasser für die Natur wird sich also verstärken. Wie lässt sich dieser entschärfen?
W. K.: Da die landwirtschaftliche Bewässerung den Grossteil des menschlichen Wasserverbrauchs ausmacht, muss man versuchen, die gleiche Menge Nahrung mit weniger Wasser zu erzeugen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: eine wassersparende Bewässerung und einen effizienteren Umgang mit der Nahrung. In Indien gehen zum Beispiel 30 % der Nahrungsmittel direkt nach der Ernte verloren. Sie werden durch Pilze vernichtet oder von Mäusen gefressen, da sie nicht korrekt gelagert sind. Bei uns landen 25 % des verkauften Brots in der Mülltonne. In den Supermärkten werden 20 % der Nahrungsmittel weggeworfen, ohne dass die Packung aufgemacht wurde. Offenbar sind Nahrungsmittel zu billig. Es spielt auch eine Rolle, was wir essen. Rund 37 % des Getreides weltweit werden zur Fleischproduktion an Tiere verfüttert. Würde man dieses Getreide direkt essen, könnten damit mehr Menschen ernährt werden.
TEC21: Könnte auch der Einsatz landwirtschaftlicher Kulturen, die weniger Wasser benötigen, zum Wassersparen beitragen?
W. K.: Es gibt Versuche, Pflanzen durch andere Sorten oder Arten zu ersetzen, die denselben Zweck erfüllen. Baumwolle verdunstet zum Beispiel sehr viel Wasser, eine genmanipulierte Sorte jedoch nur die Hälfte. Natürlich gibt es Kritiker, aber grundsätzlich sind solche Dinge möglich.
TEC21: Ein Konkurrent bei der Verteilung ums Wasser sind ja auch Biotreibstoffe aus Kulturpflanzen. W. K.: Bis 2050 10 % des weltweiten Treibstoffverbrauchs durch Agrotreibstoffe zu ersetzen, wäre katastrophal. Die Wassermenge, die heute für die Landwirtschaft gebraucht wird, würde um ein Drittel steigen. Wie soll das gehen? Auf jeden Fall werden Nahrungsmittel teurer, was für uns zu ertragen ist, für die Entwicklungsländer aber einer Katastrophe gleichkommt. Gelingt es, Biotreibstoff aus Holz oder Öl aus Algen wirtschaftlich herzustellen, ist das in Ordnung. Solange Treibstoff aber aus Raps, Palmen und anderen Kulturpflanzen in Konkurrenz zur Nahrung hergestellt wird, ist dies hinsichtlich der Wasser- und Landressourcen unsinnig.
TEC21: Zum Schluss würden wir gern noch einen Blick in die Schweiz werfen: Bekommt die Natur bei uns genügend Wasser?
W. K.: Bei uns hat der Konflikt um das Wasser zwischen Mensch und Natur viel früher stattgefunden. Uns geht es jetzt besser, und wir haben keinen Bevölkerungsdruck mehr, deshalb haben wir heute das Privileg, darüber nachzudenken. Wir renaturieren zum Beispiel Flüsse oder versuchen, Feuchtgebiete wiederherzustellen. Wir können es uns leisten, der Natur etwas zurückzugeben. In der Dritten Welt wird es noch lange dauern, bis dieser Punkt erreicht ist. Prognosen gehen davon aus, dass 2050 das Maximum der Bevölkerungsentwicklung erreicht ist. Wenn man da optimistisch bleiben will, muss man weit in die Zukunft schauen, bis der Konflikt zwischen Mensch und Natur wieder entschärft werden kann.TEC21, Fr., 2011.10.07
07. Oktober 2011 Claudia Carle, Daniela Dietsche