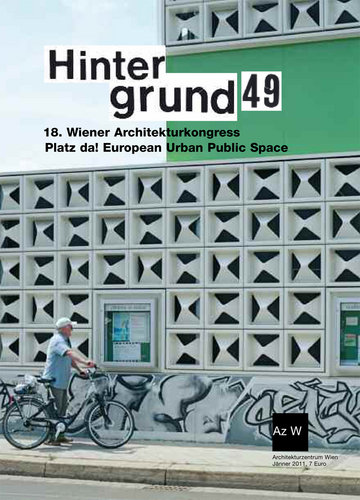Editorial
Der 18. Wiener Architekturkongress (19.11.–21.11.2010), der im Rahmen der Ausstellung „Platz da! European Urban Public Space“ (14.10.2010– 31.01.2011) stattfand, widmete sich folgerichtig erneut auf vielschichtige Art und Weise dem Thema des öffentlichen Raumes. Das Ergebnis waren zweieinhalb Tage dichter Information, vor allem aber eine Fülle von kontroversiellen Standpunkten. Wie bereits die Ausstellung gezeigt hat, haften dem Begriff des „öffentlichen Raumes“ inhaltlich äußerst unscharfe Konturen an, die zu diesen unterschiedlichen Ansätzen führen – und solche sind durchaus auch innerhalb ein und derselben Disziplin feststellbar. Eine schmale, wenn auch starke Basis eines gewissen Common Sense war jedoch sehr wohl unter den geladenen internationalen und heimischen Architekten, Urbanisten, Landschaftsplanern, Soziologen, Architekturtheoretikern und Kulturwissenschaftern zu orten: Der öffentliche Raum wird wiederholt als strategisches Instrument vereinnahmt, sei es von Stadtplanern, Politikern oder Verantwortlichen aus der Wirtschaft. Wenn die Definitionen auch differieren, er ist ein heiß umkämpftes, stets zu verhandelndes Gut.
Spannend war es, die Bandbreite der wechselnden Positionen mitzuverfolgen, die einerseits – auch das wurde diskutiert – vom nicht existenten öffentlichen Raum sprachen, sei es wegen verwaltungstechnischer Modalitäten oder auf Grund seiner physischen Auflösung durch die neuen Kommunikationsmittel wie z.B. das Internet. Andererseits wurde anhand partizipatorischer Initiativen und künstlich initiierter Aneignungsprozesse neues Potential für Transformationsprozesse im öffentlichen Raum aufgezeigt. Aber auch „gute“ Architektur allein, folgt sie ihrer traditionellen Aufgabe als gestaltende Disziplin, kann die Menschen selbst an unwirtlichen Tagen auf die Straßen, Plätze und Parks, sprich in den öffentlichen Raum, bringen. Dass die Art und Weise der Inbesitznahme jedoch nicht von den Gestaltern vorprogrammierbar ist, sondern von den BenutzerInnen selbst abhängt und eng mit sozialen Machtverhältnissen verbunden ist, all das schlägt wiederum etliche weitere Kapitel zum Begriff „öffentlicher Raum“ auf ... Das Journal greift themenbezogen die Az W Studio-Visits auf, die in Kooperation mit der Vienna Art Week und als Rahmenprogramm zur Ausstellung „Platz da! European Urban Public Space“ drei Wiener Architekturbüros besuchten. Zwei weitere Beiträge geben Aktuelles aus den umfangreichen Tätigkeitsfeldern des Az W wieder: Der Beitrag über Eilfried Huth nimmt Bezug auf das a_schaufenster 14, das dem Thema des nutzerbestimmten Wohnens gewidmet war und Pilotprojekte der 1960er Jahre ebenso wie aktuelle Beispiele diskutierte. In ihren „Bemerkungen zu einem Spalt-Haus aus fotografischer Sicht“ erzählt die Architektin und Fotografin Verena von Gagern von ihren beeindruckenden „Begegnungen“ mit dem Haus Schubert von Johannes Spalt (1920–2010) im oberösterreichischen Altmünster. Mit diesem abschließenden Essay würdigt der Hintergrund einen der einflussreichsten Vertreter der österreichischen Architekturszene nach 1945.
Gudrun Hausegger
Inhalt
04 Vorwort
Thema 18. Wiener Architekturkongress
06 Andrea Seidling: Wie öffentlich ist öffentlich?
14 Jens S. Dangschat: Wem gehört die urbane Öffentlichkeit?
22 6 Answers on Public Space by Benedetta Tagliabue and Elías Torres Tur
28 Liza Fior: Afterlife-Barking Town Square
32 Kamiel Klaasse: Catalyze! Program the Program
36 Stefan Rettich: Situative Öffentlichkeiten
44 Az W Photo Award
48 Karsten Buchholz: Zwischen Pragmatismus und Poesie
52 Boris Podrecca: Von Bedarf und Entbehrlichkeit des öffentlichen Raumes
62 Michael Zinganel: Programm – Gestalt – Gemeinschaft? Öffentlichkeiten in Bewegung
70 Daniel Zimmermann: Von der Partitur zum Public Space in aspern Seestadt
Az W Journal
76 Ute Waditschatka: Eilfried Huth: Partizipation im Wohnbau
78 Marion Kuzmany: Az W Studio-Visits
80 Verena von Gagern: Bemerkungen zu einem Spalt-Haus aus fotografischer Sicht
84 Kurzbios Autorinnen und Autoren
85 Team Az W
86 Mitglieder Architecture Lounge, xlarge Partner
Situative Öffentlichkeiten
Vor fast genau sechs Jahren stellte Horst Köhler, der damalige deutsche Bundespräsident in einem Zeitungsinterview fest, dass es innerhalb der föderalen Republik „große Unterschiede in den Lebensverhältnissen“ gibt und dass es diese zu akzeptieren gilt, um den Subventionsstaat hinter sich zu lassen. Mit dieser Forderung brach Köhler ein Tabu. Er stellte das Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse in Frage, das in Deutschland im Grundgesetz verbrieft ist, und löste damit einen Sturm der Entrüstung aus. – Dabei hatte Köhler nur den Status quo adressiert und laut ausgesprochen, was unter Urbanisten längst zum Allgemeingut gehörte: Wie unter dem Brennglas wiederholte sich im Osten Deutschlands die Raumentwicklung der alten BRD, mit allen Unzulänglichkeiten und Fehlern, nicht zuletzt angeheizt durch die neo-liberale Steuerpolitik der Kohl-Administration. Entscheidend dabei war, dass der Megatrend der Suburbanisierung, der sich in der alten BRD seit den frühen 1960er Jahren als Wachstumsphase abzeichnete, sich in den neuen Ländern unter demografischen und ökonomischen Schrumpfungsprozessen vollzog. Im Rückblick sieht es so aus, als hätten sich die Regionen und Städte in Ostdeutschland innerhalb einer Dekade nach einem dualen Prinzip neu konfiguriert.
Es sind die normativen Kräfte der Globalökonomie, die Manuel Castells in seiner Trilogie als das Informationszeitalter beschreibt. Entstanden sind polarisierte Raum- und Gesellschaftsstrukturen, die, nach dem digitalen Prinzip von „eins“ oder „null“, sich innerhalb oder außerhalb des Raumes der globalen Ströme wiederfinden. – Eine Tendenz, die sich auf allen Maßstabsebenen und für das gesamte Bundesgebiet abzeichnet.
Transformative Stadt
Innerhalb der neuen Bundesländer nimmt die aufstrebende Großstadt Leipzig auf Grund ihrer dynamischen Entwicklung mit sprunghaft wechselnden Vorzeichen eine Sonderrolle ein. Interessant ist dabei, dass die jeweilige allgemeine Einschätzung im Grunde nie der tatsächlichen Situation entsprach. Im Rückblick zeigt sich eine unberechenbare Stadt, die während ihrer Boomphase in den 1990er Jahren schrumpft und just in dem Moment, in dem sie sich zur Schrumpfung bekennt – das mag Zufall sein – wieder zu wachsen beginnt.
Zur Wende wies die gesamte Stadt erhebliche bauliche und funktionale Defizite auf. Leipzig war schon lange zuvor eine schrumpfende Stadt, die seit den 1950er Jahren bis zur Wende rund 60.000 Einwohner verlor. In die Nachwende- Jahre startete die Stadt deshalb nicht nur mit dem für ostdeutsche Großstädte typischen ökonomischen Strukturbruch, sondern auch mit einem Leerstandssockel von immerhin 35.000 Wohnungen in der gründerzeitlichen Kernstadt. Der dann einsetzende Bauboom war aus dieser Sicht unnötig und zielte an der tatsächlichen Marktsituation vorbei. Innerhalb einer Dekade wuchs an der Peripherie eine quantitativ und funktional gut bestückte Edge- City heran, die drohte, die Kernstadt auszutrocknen. Der Handel spielte sich fast ausschließlich auf der grünen Wiese ab, im suburbanen Raum der Stadtregion wurden weitere 34.000 Wohneinheiten neu errichtet. In der Folge stieg der Leerstand in der inneren Stadt auf 60.000 Wohnungen an.
Leipzig war die erste Stadt im Osten, die sich öffentlich zu ihrer Situation bekannte. Die Stadt eröffnete damit – sicherlich unbewusst – einen Diskursraum über ihre Zukunft. Über die Möglichkeit in der Unmöglichkeit, über das Wachsen im Schrumpfen. Der Diskurs hat im Rückblick nicht nur neue Denkräume eröffnet, sondern auch das Leerlaufen gestoppt. Im Gegenteil: Der Trend hat sich seither umgekehrt. Die Stadt im Gesamten verzeichnet ein sachtes Einwohnerwachstum und – viel erstaunlicher – sowohl die Stadtrandlagen als auch die Peripherie verlieren wieder, zu Gunsten der Kernstadt. Das erscheint paradox, verweist aber auf einen neuen Typus Stadt, dessen Raumproduktion sich aus einer Gleichzeitigkeit und Interaktion von Wachstumsund Schrumpfungsprozessen generiert – eine Art „Fluxus Stadt“, die jetzt um stabile Quartiere der Kernstadt und funktional aufgeladene Bereiche der Peripherie herum oszilliert. Fast scheint es, als bestünde die Kontinuität hier in der Transformation und als wäre das Temporäre das einzig Permanente. Diskontinuität und wechselhafte Polarisierung bilden denn auch die allgemeinen Parameter der „Transformativen Stadt“. Sie ist deshalb eine politisierte Stadt, in der das hohe Maß und die Permanenz an Veränderung situativ verhandelt werden muss.
Urbane Raumpolitik
Die räumlichen Verhältnisse in unseren Städten nur auf den Wirkungsgrad globaler Entwicklungen zu reduzieren, wäre zu einfach. Die Polarisierung der Räume in den Regionen wie in den urbanen Lagen ist eben auch das konkrete Ergebnis nationaler Politik sowie lokalen Handelns. Heutige Raumpolitik setzt wie die „unternehmerische Stadt“ auf Managementmethoden. Bereiche der öffentlichen Sphäre, die dem Funktionsgerüst unserer Städte nicht unmittelbar dienen, werden verleast, verkauft, verhökert. Die Erlöse aus dem Allgemeingut werden dagegen mehrheitlich in die Entwicklung weniger privilegierter Teilräume gelenkt, um im internationalen Konzert der Städte konkurrenzfähig zu bleiben.
Damit schafft die „unternehmerische Stadt“ das perfekte räumliche Pendant zu unserer fragmentierten Gesellschaft von heute, die von Polarisierung, Kontrolle und Exklusion geprägt ist. Das große Versprechen der Teilhabe ist dagegen eine verblasste Utopie, eine tägliche Ohrfeige für alle jene, die heute in den heruntergekommenen Räumen des Wohlfahrtsstaates leben müssen, die einst für gesellschaftliche Modernisierung, Aufstieg und Emanzipation standen.
Erst mit der jüngsten globalen Finanzkrise wurde offenbar, dass sich die öffentliche Hand in ihrem Privatisierungswahn selbst amputiert hat. Was aber passiert, wenn Städte nicht mehr handlungsfähig sind, wenn sie ihre Entwicklung nicht mehr selbst bestimmen und steuern können, oder wenn dem „Unternehmen Stadt“ gar der Konkurs droht? In Ostdeutschland müssen sich die Kommunen auf Grund der rasanten demografischen und ökonomischen Schrumpfung seit mehr als einer Dekade mit diesen Fragen auseinandersetzen. Diese unfreiwillige Avantgarde-Situation ist auch eine Probebühne für gesamteuropäische Entwicklungen und die Zeit nach dem ökonomischen Paradigma der letzten beiden Dekaden.
KARO* und L21
KARO* interessiert sich für das Design, den Entstehungsprozess und das soziale Regelwerk dieser Mikronetze und Raumpioniere. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Experimente unternommen, solche Prozesse der Aneignung und der Selbstorganisation künstlich zu initiieren. Im Fokus steht ein Raumbegriff, der sich über das Herstellen und Ordnen von sozialen Beziehungen definiert. Der öffentliche Raum wird dafür zweckentfremdet, er ist lediglich situative Bühne und Katalysator für weiterführende Transformationsprozesse. Die Experimente erfolgen in Form von temporären Testläufen. In scheinbar aussichtslose Situationen werden oftmals kleine kulturelle Zellen eingeschmuggelt, die das Potential besitzen, sich rasch zu vermehren oder die Fähigkeit haben, zu mutieren und selbstorganisierte Systeme zu bilden.
Ausgangspunkt dieser selbst initiierten Forschungsreihe war die Gründung der Architektengruppe L21. Die Gruppe nutzte über mehrere Jahre den öffentlichen Raum von Leipzig als Bühne für absurde Situationen und Interventionen. Zum einen, um politische Hintergründe urbaner Schrumpfung aufzudecken, zum anderen, um eine ernsthafte partizipatorische Praxis einzufordern. Dem informellen Netzwerk L21 ging es bei der Gründung in erster Linie darum, die negativ konnotierte Leerstandsdebatte und fortschreitende Perforation auf neue Möglichkeiten in der Stadtentwicklung hin zu untersuchen.
Wahllokal
Ein zweiter, wesentlicher Punkt, der adressiert wurde, ist das bestehende Eigentumsrecht, das die Mobilisierung von Grundstücken für öffentliche Zwecke oder die Möglichkeit zur Aneignung durch die Anwohner verhindert. Anfänglich diskutierte Ansätze wie eine progressive Grundbesteuerung, die marktgerechte Neubewertung von Grund und Immobilien oder Tauschpools für Grundstücke sind aus der offiziellen Debatte längst wieder verschwunden. Es bleibt alles beim Alten, die Stadt gehört den Grundbüchern und den verfälschten Buchwerten in den Bilanzen der Eigentümer.
Im September 2002, am Tag der Bundestagswahl, hat L21 auf den Trümmern eines seit längerer Zeit eingestürzten Gründerzeithauses deshalb ein „Wahllokal“ eingerichtet. „Aufbau Ost ist Chefsache“ war eines der Versprechen, die von den verschiedenen Kanzlerkandidaten vor der Wahl geäußert wurden. Ziel war es, mit den Besuchern des Wahllokals die politischen Ansätze der Parteien und ein von L21 entworfenes Sechs-Punkte-Papier zum Stadtumbau zu diskutieren. Es war fast symptomatisch und nicht unerwartet, dass über den Tag verteilt drei Polizeieinsätze erfolgten – das friedliche und rege frequentierte Sit-in war nicht legal. Weniger Dichte und mehr Grün, die allgemeinen Versprechen der „perforierten Stadt“, lösen sich in den meisten Fällen, wenn überhaupt, nur visuell ein. Spätestens an der Grundstücksgrenze zeigt sich die unsichtbare rechtliche Barriere und damit die vielleicht entscheidende Aufgabe der Politik: Ohne Möglichkeiten der Aneignung und der Bewirtschaftung von neu gewonnenen Freiräumen werden sich die Potenziale in schrumpfenden Räumen nicht entfalten können. Und auch sonst wird es immer mehr darum gehen, die komplexen Zusammenhänge eines Ortes sichtbar zu machen und darauf situativ zu reagieren.
Handgemachte Bibliothek in Magdeburg
Mehr als 30.000 Bücher umfasst der Bestand der Bürgerbibliothek im Magdeburger Stadtteil Salbke, der seit Juni 2009 in Teilen auch in der zugehörigen Freiluftbibliothek zugänglich ist. Die Regale sind nicht verschlossen, die Bücher können rund um die Uhr entnommen werden. Es ist eine Bibliothek des Vertrauens, ohne Bürokratie und Leihschein. Es ist eine Entwicklung, die zu Projektbeginn im Jahr 2004 kaum denkbar war, die ohne Partizipation und multiple Autorenschaft erst gar nicht möglich gewesen wäre. Partizipation oder die Auseinandersetzung mit dem urbanen Alltag sind keine neuen Phänomene. Sie tauchen sowohl in der Kunst als auch in der Architektur des 20. Jahrhunderts immer dann auf, wenn eine Distanz zum normalen Leben und der Gesellschaft erkannt wird. Es handelt sich im besten Sinne um Selbstkritik an der eigenen Praxis und um eine „Infragestellung des Autors“[1]. Fast könnte man meinen, es handle sich um ein notwendig wiederkehrendes, reinigendes Ritual.
Ein intimes Zwiegespräch zwischen Autor, Rezipienten und deren Alltag, mit dem Ziel, die Vorbedingungen von Stadt und Architektur für den nächsten Zeitraum neu zu definieren.
Stadt auf Probe
Salbke gilt in Magdeburg seit den 1990er Jahren auf Grund von hoher Arbeitslosigkeit und Leerständen als Sinnbild für Schrumpfung. Die Idee für ein temporäres Zeichen und den Bau einer Freiluftbibliothek – auf der Freifläche der ehemaligen abgebrannten Ortsbibliothek – wurde bereits zu Beginn des Jahres 2005 als Ergebnis einer von der Stadtverwaltung beauftragten Studie zur Entwicklung von Brachflächen diskutiert und im Stadtteil positiv aufgenommen. Allerdings fehlten die Mittel für die Umsetzung.
Nachdem die Architekten von der Berliner Galerie Aedes zu einer Gruppenausstellung eingeladen wurden, griffen sie das Konzept erneut auf, und das Projekt gewann wieder an Fahrt. Der Ausstellungsbeitrag war als ergebnisoffenes Experiment konzipiert und bestand darin, mittels einer temporären Intervention im öffentlichen Raum einen Partizipationsprozess zu initiieren und aus diesem die Form und die Funktion einer möglichen Freiluftbibliothek abzuleiten.
Ein leeres Ladenlokal, direkt an der Brachfläche gelegen, diente als Basislager für einen einwöchigen Workshop. Hier wurden an einem Stadtmodell Entwürfe und Möglichkeiten durchgespielt und verworfen, Modelle von Kindern und Bewohnern des Stadtteils gebaut, und am Ende der Woche wurde die tragfähigste Lösung als Modell im Maßstab 1:1 errichtet. Als Baumaterial für den temporären Funktionstest einer langen Bücherwand mit Bühne dienten 1.000 Bierkisten, die ein lokaler Getränkehändler bereit stellte. Ein Spendenaufruf nach Büchern fand in der gesamten Stadt Widerhall und die so zusammengetragenen Bücher füllten die Regale der temporären Installation. Obwohl das improvisierte Bibliotheksmöbel nur für zwei Tage den Stadtraum bestimmte, hat es eine dauerhafte Wirkung entfaltet. Direkt nach dem Abbau der Installation hat der Bürgerverein die Entscheidung getroffen, mit den 700 gespendeten Büchern eine informelle Bürgerbibliothek in dem Ladenlokal neben dem Grundstück zu gründen und diese ohne finanzielle Unterstützung selbst zu betreiben.
Innerhalb von zwölf Monaten wuchs der Buchbestand auf 10.000 Bände an. Auf Grund dieser dynamischen Entwicklung wurde auf Initiative der Architekten ein Förderantrag für ein ExWoSt-Forschungsprojekt des Bundes gestellt, mit dem Ziel, das Provisorium in eine dauerhafte Struktur zu überführen und auch die Idee der Freiluftbibliothek zu verwirklichen. Ende 2006 wurde das Projekt schließlich als Modellvorhaben in das Forschungsvorhaben aufgenommen. Damit war die Umsetzung der Freiluftbibliothek als dauerhaftes Stadtmöbel finanziell abgesichert.
Soziales Design
Die Beteiligung folgte bei der danach anstehenden Planung des Bauprojekts dem Muster der ersten Phase, in Form von gemeinsamer Arbeit, Diskussion und der Besetzung eines weiteren, leer stehenden Ladenlokals im Ortskern. In einem vierwöchigen Planungscamp wurde die Idee eines grünen Wohnzimmers, das, geschützt vom Straßenlärm, eine Ruhezone im Stadtteil bieten soll, weiter verfeinert. Neben der Kernfunktion als Bibliothek wurden differenzierte Begegnungsräume und Aktionsflächen wie etwa eine Bühne und ein Jugend- Corner definiert. Auch die Akteursdichte ist in diesem Zeitraum deutlich angewachsen: Es gibt jetzt acht Gruppen, die über das Projekt und eine dafür entwickelte Internetplattform miteinander vernetzt sind. Um den Bürgerverein, der die führende Rolle einnimmt, haben sich u.a. die Grundschule, ein Jugendclub, die Kirchgemeinde und die kommunale Wohnungsgenossenschaft gruppiert. Letztere stellt auch das Ladenlokal für die Bürgerbibliothek kostenfrei zur Verfügung.
Recycling der Nachkriegsmoderne
Auffälligstes Merkmal des Objektes ist zweifelsohne die Fassade aus tiefgezogenen Aluminiumformteilen, die mit ihrer modernistischen Ornamentik an eine Kaufhausfassade aus den 1960er Jahren erinnert. Tatsächlich stammt die Fassade samt Unterkonstruktion von einem ehemaligen Horten-Warenhaus, das im Jahr 2007 in der westfälischen Stadt Hamm abgebrochen wurde. Die dortige Stadtverwaltung hat die Fassade zur Unterstützung des sozialen Projektes in Magdeburg zu günstigen Konditionen abgegeben.
Ausgangspunkt der gesamten Fassadenüberlegung war wiederum der Beteiligungsprozess, bei dem sich mehrere Bürger für den Einsatz von Recyclingmaterial ausgesprochen hatten. Kontakte der Architekten zur Stadtverwaltung in Hamm führten letztlich zum Vorschlag dieser ungewöhnlichen Idee, die von den Bürgern mit Begeisterung aufgenommen wurde. Allerdings mussten zunächst heftige Widerstände – wie rechtliche Fragen, Klärung der Verkehrssicherheit in der Nutzung und Materialprüfungen – überwunden werden, bevor die Fassade heute als neues „Village Icon“ den Aufbruch des Stadtteils nach Jahren starker demografischer Schrumpfung signalisiert.
Situatives Design
Partizipative Wechselspiele wie bei der Fassade gab es zwischen den Akteuren und den Architekten zuhauf, sodass sich die Grenzen der Autorenschaft tatsächlich verwischen. Zum Beispiel wurde ein Wettbewerb ausgelobt, zu dem alle Jugendlichen aus Magdeburg ihr tag, d.h. ihre persönliche Graffiti-Unterschrift einreichen konnten. Die besten tags wurden dann von Jugendlichen selbst aufgebracht.
Vorgegeben war lediglich die Verwendung der Farben Weiß, Schwarz und Chrom. Es mag mit an dieser Aktion gelegen haben, dass Jugendliche, die an der Entwicklung des Projektes wenig Interesse zeigten, heute die größte Nutzergruppe stellen. Allerdings nicht ohne Konflikte, denn das von den Jugendlichen präferierte Chillen deckt sich nicht ganz mit der Idee des kontemplativen Lesens. Dennoch ist die Lage, auch nach einer ersten Vandalismusattacke Ende 2009, bis heute stabil. Dies zeigt aber auch, dass das Projekt nicht nur Katalysator der Stadtentwicklung ist, sondern auch Monitor bestehender sozialräumlicher Konflikte, die es weiterhin mit situativen Ansätzen zu begleiten und zu lösen gilt.
Anmerkung:
[01] Kravagna, Christian: Arbeit an der Gemeinschaft. Modelle partizipatorischer Praxis; in: Babias, Marius; Könneke, Achim (Hg.): Die Kunst des Öffentlichen; Verlag der Kunst, Dresden 1998Hintergrund, Mi., 2011.01.12
12. Januar 2011 Stefan Rettich
Wie öffentlich ist öffentlich?
In meinem Beitrag knüpfe ich an eine These an, die ich bereits zur Eröffnung der Ausstellung „Platz da! European Urban Public Space“ im Architekturzentrum Wien erwähnt habe, und die sich mir im Laufe meiner Forschungsarbeit aufdrängte: „Es gibt den öffentlichen Raum nicht.“ Ich meine damit, dass es in Österreich keinen öffentlichen Raum gibt, der dieser Bezeichnung entspricht. Ich werde dieser Behauptung in Form einer „fragmentierten Assoziationskette“ nachgehen, eine Form, die ich bereits in der Ausstellung als Verfahren angewendet habe. Grundprinzip dieses Verfahrens ist, dass in dessen Rahmen historische Beispiele auf aktuelle Probleme verweisen.
Ich beginne mit einem Zitat des französischen Mythographen Petrus Berchorius, eines Zeitgenossen Petrarcas. Dieses Zitat aus dem 14. Jahrhundert stellt eine frühe Huldigung an den öffentlichen Raum dar:
„Piazze sind Flächen in Dörfern oder Städten, frei von Häusern und ähnlichen Dingen und von Hindernissen, und ihre Bestimmung ist es, Platz zu schaffen, oder die Gelegenheit, dass Menschen sich versammeln können, also darf man annehmen, dass das Studium der Piazze Auskunft über das Leben der Menschen in dieser Welt geben kann.“ Spiro Kostof 1992[1]
Öffentlichkeit
Der Begriff „öffentlicher Raum“ scheint so sehr für sich zu sprechen, dass ihn kaum jemand hinterfragt. Obwohl mit dem Begriff „Raum“ allein bereits ganze Forschungsdisziplinen beschäftigt sind. Durch die Hinzufügung des Wortes „öffentlich“ findet die Begriffsdefinition keine Eingrenzung, sondern wird vielmehr dadurch noch erweitert. Ich möchte in diesem Zusammenhang folgende Fragen stellen: Was bedeutet „öffentlich“? Und wer bildet die Öffentlichkeit?
Unter „öffentlich“ kann „nicht geheim“ verstanden werden, aber auch „offen“, also eine Form der Zugänglichkeit meinen, aber ebenso die Bereitschaft des „In-Beziehung-Tretens“. Zum Beispiel wurden früher Gesetze „veröffentlicht“, indem sie in Form von Plakaten an Hauswänden angebracht wurden, um so der Bevölkerung Gebote und Verbote mitzuteilen. Das absolutistische Herrschaftssystem beispielsweise hatte großes Interesse daran, dass vor allem seine Verbote bekannt, also öffentlich wurden, andere Informationen wiederum streng geheim blieben.
Ein anderes Beispiel, wie „Öffentlichkeit“ verhandelt wurde, stellt die Straßenbeleuchtung dar: Mitte des 17. Jahrhunderts war die Beleuchtung der Pariser Straßen einem italienischen Unternehmer überlassen, dem Abbé Laudati de Caraffa. Diese Aufgabe oblag ihm in alleiniger Konzession „unter dem Privileg des königlichen Amtes“.
Davor war die Straßenbeleuchtung eine rein private Angelegenheit: Nur wer der Verpflichtung nachkam, eine Laterne mit sich zu führen, durfte rechtmäßig auf die Straße, anderenfalls herrschte Ausgangssperre. Wer kein Licht dabei hatte, war verdächtig und lief Gefahr, verhaftet zu werden. 1667 ließ Ludwig XIV. die erste flächendeckende Straßenbeleuchtung in Paris errichten, um die Vorgänge auf den Straßen besser kontrollieren zu können. Im selben Jahr installierte er konsequenterweise auch die Polizei, welcher die Überwachung dieser Öllampen übertragen wurde.[2]
Die Beleuchtung in Wien beginnt 20 Jahre später, am 7. November 1687, unter der Regentschaft des habsburgischen Kaisers Leopold I. 17 Laternen mit Talglichtern wurden an diesem Tag in der Dorotheergasse im 1. Bezirk zur Probe in Betrieb genommen. Ein Jahr später wurde die öffentliche Beleuchtung der Straßen Wiens per kaiserlicher Resolution verfügt, rund 2.000 Lampen wurden installiert.[3] Ausgenommen war unter anderem der breite Verteidigungsgürtel des Glacis, das sich in der Folge zu einem rege besuchten Freiraum entwickelte, denn es war ein Raum, in dem einander die Menschen „unbeleuchtet“ und so auch unabhängig von ihrer Standeszugehörigkeit begegnen konnten.[4] Dietmar Kammerer bezeichnet in seiner Studie „Bilder der Überwachung“ die Straßenlaterne als Überwachungswerkzeug von einst und als Vorläufer der heutigen Videoüberwachung.[5] Zusammenfassend möchte ich in dieser Einleitung festhalten: Das Sichtbarmachen bringt einerseits Information und andererseits Überwachung, bringt sowohl Begegnung als auch Regulierung.
Öffentlichkeit und Raum
Der Begriff „öffentlicher Raum“ ist sehr jung im deutschen Sprachgebrauch. Das erste Mal tritt er 1961 in einem soziologischen Fachbuch auf (Hans Paul Barth „Die moderne Großstadt“). Deutsche Fachbücher wie das „Baulexikon“ von 1965 oder das „Planungswörterbuch Wohnungswesen und Städtebau“ von 1974 kennen keinen öffentlichen Raum, nur öffentliche Flächen mit Bezug zu Straßen und Wegen. Erst der US-amerikanische Architekturhistoriker Spiro Kostof stellt in seiner Publikation „Anatomie der Stadt“ von 1992 den Begriff „public space“ bilderreich vor.[6]
Klickt man bei Wikipedia den Begriff „öffentlicher Raum“ in den unterschiedlichen Sprachen an, wie „public space“ und „l‘espace public“, erhält man sehr divergierende Antworten. Der öffentliche Raum der deutschen Wikipedia- Seite beschreibt ebenerdige Gemeindeflächen, die der Öffentlichkeit frei zugänglich sind. Gebäude sind ausdrücklich ausgeschlossen, sie zählen zu den öffentlichen Einrichtungen. Auf der englischsprachigen Wikipedia- Seite hingegen wird von der Zugänglichkeit für alle ausgegangen, bemerkenswerterweise auch ohne Unterscheidung, ob entgeltlich oder unentgeltlich. Dabei werden selbstverständlich auch Shopping-Malls und Bibliotheken zum „public space“ gezählt. Im ersten Fall wird also von Besitz beziehungsweise Verwaltungsverhältnissen ausgegangen, im zweiten Fall von der Benutzbarkeit. Im französischen Wikipedia-Eintrag wird am deutlichsten zwischen „l’espace public“ und „domaine public“ unterschieden, also zwischen öffentlichem Raum und öffentlicher Sphäre.
In Österreich wird der öffentliche Raum über die Straßenverkehrsordnung geregelt, welche am 1. Jänner 1961 in Kraft trat. Diese besagt, dass der öffentliche Raum allen zugänglich ist, insofern der Verkehr (Fußgänger, Fahrzeuge etc.) nicht behindert wird. Während die Verkehrsangelegenheiten durch genaue Regelungen definiert sind, bedarf alles andere einer Sondergenehmigung.
Fragmentierung des öffentlichen Raumes
Hier möchte ich zunächst auf die Funktionszuweisung des öffentlichen Raumes durch das Gesetz hinweisen, die die Grundlage seiner Fragmentierung darstellt. Der öffentliche Raum war lange Zeit unreguliert. Gerade der Absolutismus kannte keine Regulierung, alle Funktionen spielten sich parallel auf der Straße ab. Die Besitzverhältnisse waren so geregelt, dass aller Grund und Boden dem König gehörte, und „öffentlich“ meinte: zugänglich für das Volk.
Auch der Rom-Plan von Gianbattista Nolli von 1754 – ein Plan aller öffentlich zugänglichen Bereiche und Gebäude des damaligen Roms – thematisierte den öffentlichen Raum unabhängig von Eigentumsverhältnissen und spiegelte so allein den Besitz der Kirche wider, denn erst nach der Französischen Revolution von 1792 wurden Grund- und Bodeneigentum an Bürgerliche vergeben. Das heißt, auch das private Eigentum hat noch keine lange Geschichte.
Seit der Installierung von privatem Eigentum, das vererbt, verschenkt und auch gehandelt werden konnte, war es auch von ökonomischer Bedeutung, welche Lage, Formation und Bebauungshöhe ein Grundstück hatte. Zu dieser Wertsteigerung trug auch der öffentliche Raum bei. Die Städte Europas wurden zoniert, unterteilt in Parks und Marktplätze, Hauptdurchzugsstraßen und Nebenstraßen, in Flaniermeilen und Verkehrsstraßen. Die Hygienedebatte und der militärische Aufmarschvorteil gingen hier geschwisterlich Hand in Hand. Die öffentliche politische Debatte des Bürgertums und des Adels zog sich in Salons zurück. Die Straße blieb dem aufkommenden Proletariat als Ort der Meinungsäußerung, ihr Ruf ließ zu wünschen übrig.[7]
Zugänglichkeit für alle
In der österreichischen Gesetzgebung heißt es mit Bezug auf die Zugänglichkeit zum öffentlichen Raum: „Für alle zu gleichen Bedingungen.“ Der repräsentative öffentliche Raum, den es bis zur Französischen Revolution ausschließlich gab[8], war zwar tatsächlich für alle zugänglich, aber er war so gestaltet, dass auch die nicht anwesende Person des Herrschers in einer Art „unsichtbarem Sein“ omnipräsent war. Die Machtverhältnisse waren in dieser Sorte öffentlichem Raum unübersehbar in Stein gemeißelt und setzten ein zu beeindruckendes, loyales und jubelbereites Volk voraus. „Die Bühnen der Macht“ nennen wir diese repräsentativen öffentlichen Räume in der Ausstellung „Platz da!“. Heute ist, so kann man sagen, das Auto der Souverän, der den öffentlichen Raum der Städte prägt. Auch wenn hier das Publikum, das das Auto bedient, oft noch dem Glauben aufsitzt, selbst „the King of the Road“ zu sein.
Nachdem das Gottesgnadentum sich zu einem konstitutionellen Fürstentum gewandelt hatte, übernahmen militärische Aufmarschplätze die repräsentative Rolle des öffentlichen Raumes, noch später wurden öffentliche Räume Aufenthaltsorte des nach fürstlicher Anerkennung strebenden und den aristokratischen Habitus imitierenden Bürgertums. In diesem Prozess wird dem öffentlichen Raum „eine kultische Aufgabe zuteil, welcher durch suggestive Kräfte durch die Gestaltung direkten Einfluss auf das Verhalten der Teilnehmer oder Zuschauer zugesprochen wird“.[9] Eine weitere Form von absolutistischer Repräsentation waren Feste während der Barockzeit, zum Beispiel das Zeithainer Lustlager. Bei diesem demonstrierte August der Starke im Juni 1730 nicht nur die Stärke seiner militärischen Truppen, sondern zeigte seine Macht auch durch Kunst und Kultur sowie mit mehrstündigen Feuerwerken. Heute vermischen sich Repräsentationsöffentlichkeit und politische Öffentlichkeit im Event, während eine private Handlung wie das Frühstücken im öffentlichen Raum politische Öffentlichkeit produzieren kann.
Heute wird der öffentliche Raum, der nicht vom Auto beherrscht wird, oft zum Zankapfel zwischen Geschäftsleuten und der armen Bevölkerung. Die Verlierer stehen allerdings von vornherein fest. Denn die Politik unterstützt die Geschäftsleute durch Gesetze und Exekutivorgane, welche die Bettler, Suchtkranken und Obdachlosen aus dem öffentlichen Raum vertreiben. Wir haben es in diesem Jahr in Wien mit der Einführung des verschärften Wegweiserechts sowie mit dem Verbot des gewerbsmäßigen Bettelns sehr deutlich erlebt, wie bei solchen Konflikten im öffentlichen Raum vorgegangen wird: Von Verhandlung ist hier keine Rede mehr. Ich möchte behaupten, dass die globalen ökonomischen Machtstrukturen heute wieder eine Art globale Aristokratie herausgebildet haben, die sich um die Aufteilung der Welt streitet und die öffentlichen Räume als Konsumzonen unter ihrem Wappen – pardon, „Logo“ – vereinnahmt.
Freies Handeln
An dieser Stelle möchte ich Hannah Arendts Öffentlichkeitsbegriff zur Diskussion stellen.[10] Hannah Arendt unterscheidet sehr klar zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen. Als Modell gilt ihr das Leben in der Griechischen Polis. Dabei wird das private Leben dem Haushalt mit seinen hierarchischen Strukturen zugesprochen, während das öffentliche Leben politsch ist und egalitär ausgehandelt wird. Die Arbeit gilt hier als Aufrechterhaltung der Lebensnotwendigkeiten und als unfrei. Die egalitäre Meinungsäußerung hat nach Arendt zur Voraussetzung, dass ein freies Leben ohne Erwerbstätigkeit geführt werden kann, was de facto jedoch nur durch Erbschaft möglich ist. Auch das Streben nach Vermehrung von Besitz und Eigentum gilt als unfreie Handlung. Nur in der „vita contemplativa“ sei die wahre Unabhängigkeit zu finden. Die Agora, der Marktplatz einer griechischen Polis, war der Austragungsort dieser Demokratie. Einer Demokratie, die sich auch im Spektakel gefeiert hat, wie zum Beispiel in den Feierlichkeiten der Panathenäen, die jährlich zu Ehren der Stadtpatronin Athene abgehalten wurden. Das mehrtägige Fest umfasste Opfer, szenische Darstellungen, Wettkämpfe und als Höhepunkt einen Festzug, der am Dyplon-Stadttor begann, über die Agora und zur Akropolis führte, wo der Statue der Athene ein neu gewobenes Kleid überreicht wurde. Ab den Propyläen waren aber nur noch Athener mit Bürgerrecht, also ausschließlich Männer, zum Eintritt berechtigt. Es drängt sich die Frage auf, für welche Bevölkerungsgruppen Demokratie und Bürgerfreiheit tatsächlich Wirklichkeit waren. Die Antwort lautet, dass in der klassischen griechischen Gesellschaft Demokratie nur von 20 Prozent der Bevölkerung gelebt wurde.
Zusammenfassend kann mit Hannah Arendt behauptet werden, dass freies Handeln Voraussetzung jedes öffentlichen und politischen Lebens ist. Als Konsequenz stellt sich jedoch die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, dieses freie Handeln auf alle Personen einer heutigen Gesellschaft zu übertragen.
Disziplinar- und Kontrollgesellschaft
Michel Foucault sieht in seinem Buch „Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses“ in der Pest den Beginn der Reglementierung sämtlicher Lebensbereiche.[11] Im Gegensatz zu den Leprakranken, die verbannt wurden und so eine Art Gemeinschaft bilden konnten, eine Gemeinschaft der Ausgeschlossenen, hat die Pest „das Eindringen des Reglements bis in die feinsten Details der Existenz“ geschaffen. Die Eingeschlossenen werden lückenlos registriert, in Listen aufgenommen, welche täglich kontrolliert werden, um zu verhindern, dass weitere Todesopfer verheimlicht werden. „Die Verbannung der Lepra und die Bannung der Pest – das sind nicht dieselben politischen Träume“, sagt Foucault. So träumen die Regierenden vom Pestzustand, um die perfekte Disziplin funktionieren zu lassen.[12] Der Überwachungsmechansimus in Benthams bekanntem Panoptikum, auf das Foucault sich bezieht, individualisiert und verhindert Kommunikation. Es automatisiert das Funktionieren der Macht, welche somit sichergestellt ist. Die Macht ist sichtbar, aber uneinsehbar. Die Folge ist, dass wenige Personen Macht über viele haben und Intervention zu jedem Zeitpunkt möglich ist.
Als neuen politischen Diskurs und auch als Praxis, die uns aus diesen Verhältnissen herausführen kann, verweisen der italienische Philosoph Antonio Negri und der amerikanische Literaturwissenschafter Michael Hardt in ihrem aktuellen Werk „Commonwealth – Das Ende des Eigentums“ auf die gerade entstehende Commons-Bewegung, die sich auf die Gemeingüter besinnt, welche seit langem, ganz massiv aber im Neoliberalismus, verbraucht, beziehungsweise privatisiert wurden.[13] Die Commons-Bewegung beabsichtigt, dass wichtige Ressourcen (englisch Commons) nicht nur für wenige, sondern für alle zugänglich sein sollten. Das Spannende an diesem neuen Blickwinkel ist Folgendes: Die Idee der Commons ermöglicht einen Gesellschaftsentwurf, der jenseits von Markt und Staat die natürlichen, kulturellen und sozialen Ressourcen der Menschen wieder in die Hand der betroffenen Gemeinschaften legt.
Abschließend möchte ich zu meiner Eingangsthese zurückkommen: Ich behaupte, es gibt keinen urbanen Raum, der die Bezeichnung öffentlich verdient. Denn der Umgang mit dem sogenannten öffentlichen Raum ist kein öffentlicher. Nicht die Öffentlichkeit bestimmt über diesen öffentlichen Raum, sondern eine Stadtverwaltung, die paternalistisch im Interesse mächtiger Privatunternehmen agiert. Wenn nun der öffentliche Raum als politische Forderung konkret werden soll, als Raum der Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner, als politischer Freiraum, als Verhandlungsraum der Nutzerinnen und Nutzer, dann muss der urbane öffentliche Raum zum Gemeingut werden und wie ein Gemeingut verwaltet werden. Das geschieht im besten Fall durch die Betroffenen und daran interessierten Bürgerinnen und Bürger selbst.
Anmerkungen:
[01] Spiro Kostof: Anatomie der Stadt. Geschichte städtischer Strukturen, Frankfurt am Main 1993 (engl. Erstausgabe 1992).
[02] http://www.geopedia.fr/histoire-eclairage.htm
[03] http://www.wien.gv.at/verkehr/licht/beleuchtung/oeffentlich/geschichte.html
[04] Othmar Birkner, „Der öffentliche Raum vor und nach der Entfestigung der Stadt. Fallbeispiel Wien“; Vortrag 20. Mai 1987, Museum für Gestaltung Zürich im Rahmen von „Venedig ohne Wasser“.
[05] Dietmar Kammerer: Bilder der Überwachung, Frankfurt am Main 2008.
[06] Gerhard Fehl nimmt in folgendem Artikel Bezug dazu, „Öffentlicher Raum. Öffentlichkeit, Städtebau: Eine Skizze ihrer Transformation zwischen Absolutismus und Liberalismus (ca. 1760-1890)“, in: Christoph Bernhardt, Gerhard Fehl, Gerd Kuhn, Ursula von Petz (Hg.): Geschichte der Planung des öffentlichen Raums, Dortmunder Beiträge zur Raumplanung 122, Dortmund 2005.
[07] ebda.
[08] Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt am Main 1990 (Originalausgabe 1962).
[09] siehe Anm. 6.
[10] Hannah Arendt: Vita Activa oder Vom tätigen Leben, München 1981 (engl. Erstausgabe 1958; dt. 1960).
[11] Michel Foucault: Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt am Main, 1976 (franz. Erstausgabe 1975).
[12] ebda.
[13] Michael Hardt, Antonio Negri u.a.: Common Wealth – Das Ende des Eigentums, Frankfurt am Main 2010 (engl. Originalausgabe 2009).Hintergrund, Mi., 2011.01.12
12. Januar 2011 Andrea Seidling