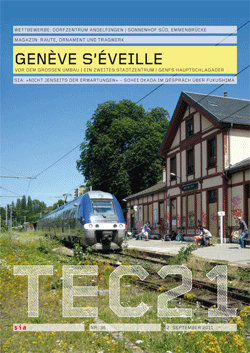Editorial
Wohl nirgends in der Schweiz ist das gegenwärtige Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft so deutlich zu spüren wie im Arc Lémanique. Vor allem Genf erlebt einen Boom. Es ist in den letzten Jahren zum grössten Rohstoffhandelsplatz der Welt geworden und bildet die am fünftschnellsten wachsende Agglomeration Europas.
Als diese Dynamik nach der Jahrhundertwende einsetzte, waren weder die politische Kultur noch die Infrastruktur Genfs darauf vorbereitet. Die Stadtentwicklung war seit langem politisch blockiert.
Den Genferinnen und Genfern gefiel es in ihrer dichten, schönen und von einem geschützten Grüngürtel umgebenen Stadt so gut, dass sie sie nicht mehr verändern wollten. Sie bauten kaum mehr Wohnungen, darum fand das Wachstum vor allem in Frankreich statt. Sie bauten auch keine S-Bahn, deshalb wuchs der grenzüberquerende Autoverkehr.
Doch jetzt erwacht Genf. Es baut nun die S-Bahn – deren zentrale Strecke 1850 zum ersten Mal projektiert worden war. Und eine neue Generation von Politikern und Planern hat Projekte für neue Stadtteile und für die Nachverdichtung bestehender Quartiere entwickelt, die alles in den Schatten stellen, was in den letzten zwanzig Jahren in Deutschschweizer Städten geschehen ist. Das betrifft nicht nur die Quantität, die Grösse der Gebiete und die Zahl der geplanten Wohnungen und Arbeitsplätze. Auch bei der Qualität der Planungen, bei der baulichen Dichte, der funktionalen und der sozialen Durchmischung, der Gestaltung der öffentlichen Räume usw. gehen die Vorhaben deutlich weiter in Richtung einer nachhaltigen Siedlungsform – einer attraktiven, dichten Stadt der kurzen Strecken.
Es ist ein besonderer Moment in Genf: Die Tische vieler Planerinnen und Planer quellen über mit Projekten, die kantonale und die kommunalen Bauverwaltungen summen von den vielen Sitzungen, die Stimmung knistert vor Produktivität – doch noch ist nichts gebaut, noch ist alles erst Projekt. Die Beteiligten scheinen es kaum mehr erwarten zu können, bis endlich die ersten Bauten stehen und beweisen, dass der Stillstand überwunden ist. Wenn Genf nun umsetzt, was die Pläne versprechen, wird es in Sachen nachhaltiger Stadt-entwicklung rasch auf- und überholen. Und die Schweiz wird eine zweite Grossstadt erhalten, was ihr guttun wird.
Unsere französischsprachige Schwesterzeitschrift Tracés widmet übrigens ihre neuste Nummer der Planungsgeschichte Genfs und bringt ausserdem ein Interview mit dem Leiter der kantonalen Richtplanungsbehörde über den neuen Genfer Richtplan, der Pioniercharakter hat und der zurzeit öffentlich aufliegt (Tracés 16/17 2011, bestellen unter: aho@revue-traces.ch).
Ruedi Weidmann
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Dorfzentrum Andelfingen | Sonnenhof Süd, Emmenbrücke
12 MAGAZIN
Raute, Ornament und Tragwerk
18 VOR DEM GROSSEN UMBAU
Ruedi Weidmann
Genf boomt, war aber planerisch lange blockiert. Nun erwacht die Stadt: Sie baut eine S-Bahn und plant mehrere neue Stadtteile für die 2000-Watt-Gesellschaft.
22 EIN ZWEITES STADTZENTRUM
Ruedi Weidmann
Im Industriegebiet Praille - Acacias - Vernets (PAV), einem der grössten Stadtentwicklungsprojek-te Europas, soll Genfs Innenstadt erweitert werden.
27 GENFS HAUPTSCHLAGADER
Antoine Da Trindade, Annick Monbaron-Jalade, Caroline Monod
Die Ceva wird das Herzstück der Genfer S-Bahn. Rund um ihre Stationen gibt sie der Stadtentwicklung bereits kräftige Impulse.
34 SIA
«Nicht jenseits der Erwartungen» – Sohei Okada im Gespräch über Fukushima
36 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Vor dem grossen Umbau
Genf wächst seit Jahren stark, aber planerisch war es lange blockiert. Der öffentliche Verkehr wurde kaum ausgebaut, Wohnungen entstanden vor allem in den französischen Vororten. Doch nun erwacht der Kanton. Eine S-Bahn und neue Tramlinien entstehen. Entlang diesen neuen ÖV-Achsen sollen durch gezieltes Einzonen und das Verdichten von Industriegebieten neue Stadtteile entstehen. Zum Beispiel in Praille - Acacias - vernets, einem der grössten Entwicklungsgebiete in Europa.
«Ich fürchte nur, dass es uns bereits zum Charakter geworden ist, Projekte nicht zu verwirklichen. » Dieser Satz fällt so oder ähnlich fast in allen Gesprächen mit Leuten, die mit der Zukunft von Stadt und Kanton Genf beschäftigt sind. Die tiefe Skepsis wurzelt in der jüngeren Geschichte: Mindestens drei Jahrzehnte lang litt die Stadtrepublik unter einer fast völligen Blockade der Stadtentwicklungspolitik. Projekte zur Linderung der notorischen Wohnungsnot, zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur oder zur Raumentwicklung wurden von den Parteien und vom Souverän konstant verworfen.
Für Besucher aus der Deutschschweiz ist Genf eine fremde Welt: Ein Heer von Beamten wacht über die Einhaltung hunderter von Regeln, die der liberale Nordosten nicht kennt. Drei Beispiele: Mieten dürfen nur bei Mieterwechseln angepasst werden, die Art der Erdgeschossnutzung darf nicht verändert werden, und um die Stadt zieht sich eine grosse Agrarzone, die seit den frühen 1960er-Jahren vor Bebauung geschützt ist. All das ist sehr angenehm für die, die schon hier sind: Sie wohnen günstig, geniessen eine schweizweit einmalige Dichte an Restaurants und Läden und sind schnell im Grünen. Aber es ist unmöglich für alle, die gerne nach Genf ziehen würden. Denn unter diesen Umständen wurde nie eine Wohnung frei, und neue wurden zu wenig gebaut. Die Genferinnen und Genfer hatten sich bequem eingerichtet in ihrer schönen, dichten Stadt und liessen es lange dabei bewenden.
Genf ist aber äusserst attraktiv. Die internationalen Organisationen, das Forschungszentrum Cern, die guten Hochschulen und die schöne Lage ziehen Menschen und wirtschaftliche Aktivitäten an. In den letzten Jahren ist Genf, von der Öffentlichkeit lange kaum bemerkt, zum wichtigsten Rohstoffhandelsplatz der Welt geworden.[1] Die Agglomeration ist kräftig auf fast 900 000 Einwohner angewachsen – allerdings vor allem in Frankreich. Dort gibt es Bauland und Wohnungen, aber keine urbane Dichte, kein Tram und keine S-Bahn. Die Folge: Fast eine halbe Million Personen und 350 000 Autos überqueren täglich die Kantonsgrenzen. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs in der Agglomeration ist mit 12 % katastrophal tief (Abb. 1), Lärm- und Schadstoffwerte sind entsprechend hoch und Staus an der Tagesordnung. Seit einiger Zeit ziehen auch junge Genfer Familien nach Frankreich, weil sie in ihrer Stadt keine Wohnung mehr finden. Damit aber drohen die traditionell regierenden Parteien ihre Wählerbasis zu verlieren. Vielleicht hat gerade diese Sorge, zusammen mit der wachsenden Verkehrs misere, der Wohnungsnot und dem Nachdrängen einer wohl weniger auf das Lokale fixierten, weltoffeneren Generation endlich zu einem Umdenken geführt.
Genf erwacht
Genf erwacht – und wie! Noch ist alles Projekt, doch die Pläne klingen vielversprechend, und die Zahlen, die genannt werden, können einen schwindlig machen: Bis in 20 Jahren sollen 200 000 Einwohner und 100 000 Arbeitsplätze hinzukommen, die Hälfte davon im Kanton Genf, wo 50 000 neue Wohnungen gebaut werden sollen – das wären 2500 pro Jahr. Dieses Wachstum soll aber nicht in ein planloses Ausufern der Stadt münden, sondern landschaftsschonend, umwelt- und sozialverträglich ablaufen. Gefördert durch das Agglomerationsprogramm sind im «Bassin franco-valdo-genevois» grenzüberschreitende Gespräche in Gang gekommen: Auf verschiedenen Ebenen koordinieren seither Vertreter der Kantone Genf und Waadt und der französischen Departemente Ain und Haute-Savoie die Planung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. Resultate davon sind der grenzüberschreitende Verkehrsverbund, neue Buslinien und das Konzept der S-Bahn. Mit dem Bau von deren Herzstück, der Ceva, der in wenigen Wochen beginnen soll (vgl. «Genfs Hauptschlagader», S. 27), wird Genf ein zeitgemässes ÖV-Netz erhalten – und gleichzeitig sein ältestes Blockadetrauma überwinden, denn das Projekt wird seit 1850 diskutiert. Trotz wiederholten Anläufen blieb es Stückwerk; 1888 und 1949 wurden Teilstrecken eröffnet.[2] Seit 1995 baut Genf auch das Tramnetz wieder aus. Vier Linien sollen bis nach Frankreich verlängert werden. 2010 wurde das Agglomerationsprogramm im kantonalen Richtplan verankert. Die Siedlungsentwicklung wird darin – und noch stärker in der laufenden Richtplanrevision – auf die neuen ÖV-Achsen ausgerichtet.[3] Als «axes forts» greifen diese wie Finger einer Hand aus und verschränken sich mit Grünzügen, die bis in die Kernstadt hineinreichen (Abb. 3). Entlang den «axes forts» soll die Bebauung verdichtet werden. An deren Enden werden etwa 4 % der Landwirtschaftszone eingezont. Hier sollen neue Quartiere von der Dichte und mit dem Nutzungsmix der Innenstadt entstehen. Entsprechende Ideen- und Projektwettbewerbe sind in Vorbereitung.[4] Diese Abstimmung von Siedlungsentwicklung und Verkehr entspricht den Anforderungen des Bundes an die Agglomerationsprogramme. Genf hat deshalb seit 2008 für den Bau der Ceva und den Ausbau des Trams 900 Mio. Fr. erhalten.
Ceva-Stationen als dichte Zentren
Abgesehen von den Schlafgemeinden in Frankreich bietet Genf eine gute Ausgangslage für eine Stadt der kurzen Strecken. Das eigentliche Stadtgebiet ist das dichteste der Schweiz, und die Bevölkerung schätzt dies als urbane Qualität. Doch auch die Kernstadt birgt noch Verdichungspotenzial, etwa an vier der fünf neuen Ceva-Stationen. Kanton und SBB wollen diese zu intermodalen Umsteigeplattformen ausbauen und arbeiten bei der Planung eng zusammen. Sie legen dabei viel Wert auf Benutzerfreundlichkeit: Möglichst einfach und angenehm soll von der S-Bahn auf Tram, Bus, Velo und Fusswege ge wechselt werden können. Für die Gestaltung der öffentlichen Räume an den Ceva- Stationen hat der Kanton einen Wettbewerb ausgeschrieben (TEC21 23/2011, S. 12).
Um die Stationen herum sollen dichte, gemischte Bebauungen mit hohem Wohnanteil entstehen. Mittels Studienaufträgen wurden Masterpläne entwickelt, daraufhin die Quartierpläne erneuert, für die Bauten sind Projektwettbewerbe vorgesehen. So an den Bahnhöfen Chêne- Bourg und Eaux-Vives, wo durch die unterirdische Führung der Ceva die 1887 angelegten Gleisfelder und Güterareale frei werden. In Chêne-Bourg sind 230 bis 330 Wohnungen und 10 000 m² Dienstleistungen geplant (Abb. 5–6); in Eaux-Vives, wo auch die Stadt beteiligt ist, sollen von 2015 bis 2018 etwa 250 Wohnungen, Läden, Büros, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die neue Comédie de Genève gebaut werden (Abb. 7, 9).
Ein Schlüsselprojekt für die neue Ära ist das Vorhaben an der Station Lancy-Pont-Rouge. Es gehört zum Entwicklungsgebiet Praille - Acacias - Vernets (PAV) und wird dessen Umstrukturierung einleiten (vgl. «Ein zweites Stadtzentrum», S. 22). Die Société de valorisation Lancy- Pont Rouge (SOVALP), bestehend aus SBB und Kanton, plant hier eine gemischte Überbauung mit über 180 000 m² Bruttogeschossfläche: 8 Geschäftsbauten mit bis zu 16 Etagen und mehrere Wohnhöfe, 4600 Arbeitsplätze, 550 Wohnungen, Läden, Restaurants, ein Hotel, öffentliche Einrichtungen und eine Schule. Ein Bahnhofplatz und weitere öffentliche Räume sollen die S-Bahn-Station mit ihrer Umgebung verbinden (Abb. 10–11). Denn das SOVALPProjekt ist nur ein kleiner Teil eines viel grösseren Entwicklungsgebiets. – Dies ist der zweite Satz, den man in Genf gegenwärtig ständig hört: Alle Projekte sind immer nur Teil eines noch grösseren. So wie die Ceva nur ein Teil der S-Bahn ist und diese nur ein Element im geplanten ÖV-Netz mit Trams und Hochleistungsbussen, so ist das SOVALP-Projekt nur ein Teil des Entwicklungsgebiets PAV und dieses wiederum nur ein Element in umfassenden Plänen zur Verdichtung und Erweiterung des Genfer Siedlungsgebiets.
Anmerkungen:
[01] Martin Gollmer: «Genf – Stadt des Rohstoffhandels», Finanz und Wirtschaft 2.4.2011, S. 22 f.; Daniel P. Bernet: «Genf wächst zum Mekka des globalen Rohstoffhandels», NZZ am Sonntag, 24.1.2010.
[02] www.ceva.ch>Ceva dans le temps
[03] http://etat.geneve.ch/dt/amenagement > Plan directeur cantonal
[04] http://etat.geneve.ch/dt/amenagement > Grands ProjetsTEC21, Fr., 2011.09.02
02. September 2011 Ruedi Weidmann
Ein zweites Stadtzentrum
Das Industriegebiet Praille - Acacias - Vernets (PAV) ist eines der grössten Stadtentwicklungsprojekte Europas. Unmittelbar südlich der Innenstadt gelegen, soll es in den nächsten Jahren zu einem dichten, gemischten Stadtteil für die 2000-Watt-Gesellschaft ausgebaut werden.
Auf der Ebene südlich der Arve zwischen Genf, Carouge und Lancy befanden sich bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts einzelne Fabriken, Werkstätten und Schrebergärten. In den 1930er-Jahren wurden die Flüsschen Aire und Drize eingedolt, 1950 bis 1960 entstand der Güterbahnhof, ab 1960 liess der Kanton die Ebene mit einem Raster von Industriegleisen und Stichstrassen erschliessen und die Flächen im Baurecht an Lager- und Transportfirmen vergeben.[1] Das 230 ha grosse Gebiet liegt nur 2 bis 3 km vom Genfer Stadtzentrum entfernt in den Gemeindegebieten von Genf, Carouge und Lancy und ist zu 82 % im Besitz der öffentlichen Hand (Abb. 2). Es ist keine Brache, sondern wird von 1800 Betrieben mit fast 20 000 Angestellten genutzt, und es gibt rund 3000 Wohnungen. Mit seinen meist flachen Gebäuden und grossen Verkehrsflächen birgt es dennoch ein enormes Potenzial für die Stadtentwicklung.
Nach nur sechs Jahren Planung (vgl. Kasten zur Projektgeschichte) konnte das Gebiet dieses Jahr von der Industrie- in eine gemischte Zone umgezont werden, die deutlich mehr Ausnutzung erlaubt und so Anreiz für neue Nutzungen und dichtere Bauten schafft. Das PAV hat im Kantonalen Baudepartement seit 2008 eine eigene Direktion (DGPAV, heute DPAV). Die kleine, multidisziplinäre, junge und motivierte Gruppe ist für die Koordination zwischen den vielen involvierten kantonalen und kommunalen Amtsstellen sowie den betroffenen öffentlichen und privaten Betrieben verantwortlich. Von einem internationalen Expertenkollegium begleitet, treibt sie die Planung voran und entwickelt eine rege Informationstätigkeit.[2] Angestrebt wird nicht etwa eine Tabula-rasa-Strategie – das wäre wegen der laufenden Baurechtsverträge gar nicht möglich, und manche der vorhandenen Nutzungen sind auch durchaus weiterhin erwünscht. Vielmehr soll sich der Bestand nach und nach verdichten.
Ein neues Stadtzentrum
In dieser Innenstadterweiterung soll eine nachhaltige und verkehrsarme Lebensweise im Sinn der 2000-Watt-Gesellschaft möglich sein. Die detaillierten Rahmenbedingungen werden gegenwärtig in Studien, Studienaufträgen, Wettbewerben und partizipativen Workshops erarbeitet. Sie beschäftigen sich mit einzelnen Teilgebieten oder Sachfragen wie der Qualität des öffentlichen Raums oder der Entwicklung multifunktionaler Bautypologien und konkretisieren laufend den Masterplan von 2007 (Abb. 3). Die Grundprinzipien stehen aber fest: Bis in 20 Jahren soll das Gebiet 25 000 Bewohner und 25 000 Arbeitsplätze zählen und von der Dichte, dem Nutzungsmix und der Sozialstruktur her der heutigen Innenstadt entsprechen. Um das Verhältnis «1 Einwohner / 1 Arbeitsplatz» zu erreichen, ist bei den Neubauten, bezogen auf den ganzen PAV-Perimeter, ein Wohnanteil von 80 % nötig. Das ergibt rund 10 000 neue Wohnungen und ebenso viele neue Arbeitsplätze. Um Verkehr zu vermeiden, sollen Wohnen und Arbeiten, Einkaufen und Erholen wieder näher zusammenrücken, wenn möglich in Fuss- oder Velodistanz. Es werden Ausnützungsziffern von 2 bis 4 angestrebt, im zentralen Gebiet «Etoile» mit Hochhäusern und deutlich höherem Büroanteil soll sie gar 5 [5] betragen. Das sind Dichten, die im gesamten 20. Jahrhundert in der Schweiz als unvereinbar mit Lebensqualität galten. Es sind durchweg gemischte Überbauungen vorgesehen. Als mögliche Typologie der Bebauung wurde ein Turm entwickelt, der Wohnungen und Büros enthält, mit einem mehrstöckigen Sockelbau, in dem sich Dienstleistungen befinden, und einem von Läden und Restaurants genutzten Erdgeschoss. Je nach Ort, Parzellenform und im Zusammenspiel mit bestehenden Bauten können auch ganz neue Typologien entstehen, die mit ungewöhnlichen funktionalen Mischungen experimentieren. Der neue Stadtteil soll keinesfalls Gutbetuchten vorbehalten sein. Auf öffentlichem Grund wird deshalb ein Drittel der Wohnungen subventioniert sein, ein Drittel gemeinnützig und ein Drittel freitragend.
Das Gebiet wird künftig von den Ceva-Stationen Lancy-Pont-Rouge und Carouge-Bachet, drei Tramlinien und einem engen Netz von Velo- und Fusswegen mit neuen Passerellen über die Arve und die Bahn erschlossen. Es wurde in sieben Quartiere mit je eigenem Charakter unterteilt. Zwei grüne Achsen durchziehen es und verbinden es mit den regionalen Grünzügen entlang der Arve und auf der Moräne von Lancy. In diesem grünen Kreuz fliessen der Langsamverkehr und die renaturierten Flüsschen Drize und Aire, daran angedockt liegen Plätze, Parks und Gärten, Schulen, Kultureinrichtungen und Sportanlagen. Ergänzend dazu soll eine zweite Abfolge öffentlicher Räume das Quartier strukturieren. Dieser sogenannte «Ring» verbindet den Park «Bois de la Bâtie» im Norden mit dem Fussballstadion im Sü - den. Viel Gewicht wird der Lebensqualität im öffentlichen Raum beigemessen. Für dessen sorgfältige und benutzerfreundliche Gestaltung sind Projektwettbewerbe vorgesehen. Besonders platzintensive und lärmige Betriebe erhalten Unterstützung bei der Umsiedlung in andere Gewerbezonen. Bleiben können unter anderem rund zehn Recyclingfirmen, die man aber an einem Ort konzentrieren möchte. Für die Bauzeit soll ein Recyclinghof eingerichtet werden, denn rund 30 % des Abbruch- und Aushubmaterials soll vor Ort wieder Verwendung finden. Die Gleisanschlüsse will man zur Reduktion von Lastwagenfahrten nutzen, sie sollen aber modernisiert und zu einer Logistikplattform konzentriert werden.
Planungsablauf und erste Projekte
Bis 2013 muss der Quartierrichtplan erarbeitet sein, bis spätestens 2015 die sieben Quartierpläne. Um aus den kommenden Veränderungsschritten laufend Lehren für die weitere Entwicklung ziehen zu können, hat die DPAV diese Pläne als dynamische Instrumente ausgebildet. Sie geben kein starres Bild vor, sondern vielmehr eine starke Vision der strukturierenden Elemente, etwa die Qualität der öffentlichen Räume, an der sich einzelne Projekte jeweils orientieren sollen. Die Inkraftsetzung des Masterplans 2007 hat bereits etliche private Projekte ausgelöst. Diese werden gegenwärtig an die neuen Vorgaben angepasst. Erste Bauprojekte können bereits vor 2015 starten, Bedingung ist ein Projektwettbewerb nach SIA-Norm. Generell soll in Genf die Wettbewerbskultur gefördert werden, vor allem im Wohnungsbau, wo die Romandie in den letzten Jahren kaum Innovatives hervorgebracht hat.[6] In diesem Zusammenhang wird auch eine Debatte über die einschränkenden Bestimmungen im gemeinnützigen Wohnungsbau nötig sein.
Lernschritte über den Röstigraben
Noch ist von alldem nichts zu sehen, und noch begegnet man allenthalben der eingangs zitierten Skepsis. Doch die Zeichen dafür, dass der Wind gedreht hat bzw. die lange Flaute vorüber ist, sind deutlich. Seit einiger Zeit stimmt das Volk allen Vorlagen zur Raumentwicklung zu, dieses Jahr etwa einer Einzonung im lange heiligen Grüngürtel. Der Kantonsrat hat die Umzonung des PAV ohne Gegenstimme beschlossen. Und ganz offensichtlich ist eine neue Generation von weltoffenen Planerinnen und Planern am Werk, die die Stadtentwicklung in der Deutschschweiz kritisch verfolgt und genau besichtigt haben, nun aber deutlich weiter gehen wollen. So gesehen, erweist sich die Flaute als Chance für einen Lernschritt. Genfs Erwachen wird deshalb der ganzen Schweiz guttun. Selbst wenn einige der vielen Projekte noch nach alter Genfer Manier im Sand verlaufen sollten, wird es sich in nächster Zeit lohnen, über den Röstigraben zu schauen, um sich über ausgeschriebene Wettbewerbe zu informieren und um von den Erfahrungen zu profitieren, die man in den Genfer Entwicklungsgebieten machen wird.
Anmerkungen:
[01] Ausgeführt von der zu diesem Zweck gegründeten Fondation des terrains industriels Praille et Acacias (Fipa), heute Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI)
[02] «Le PAV s’expose» Nr. 1, Januar 2011 sowie: www.ge.ch/pav
[03] Tracés 20/2005, S. 6–16
[04] www.enf.ch > projekte > städtebau > Masterplan PAV
[05] «La ville en Arve»
[06] Vgl. auch Mike Guyer: «2e Distinction romande d‘architecture», Tracés 18/2010, S. 26 (www.baugedaechtnis.ethz.ch)TEC21, Fr., 2011.09.02
02. September 2011 Ruedi Weidmann